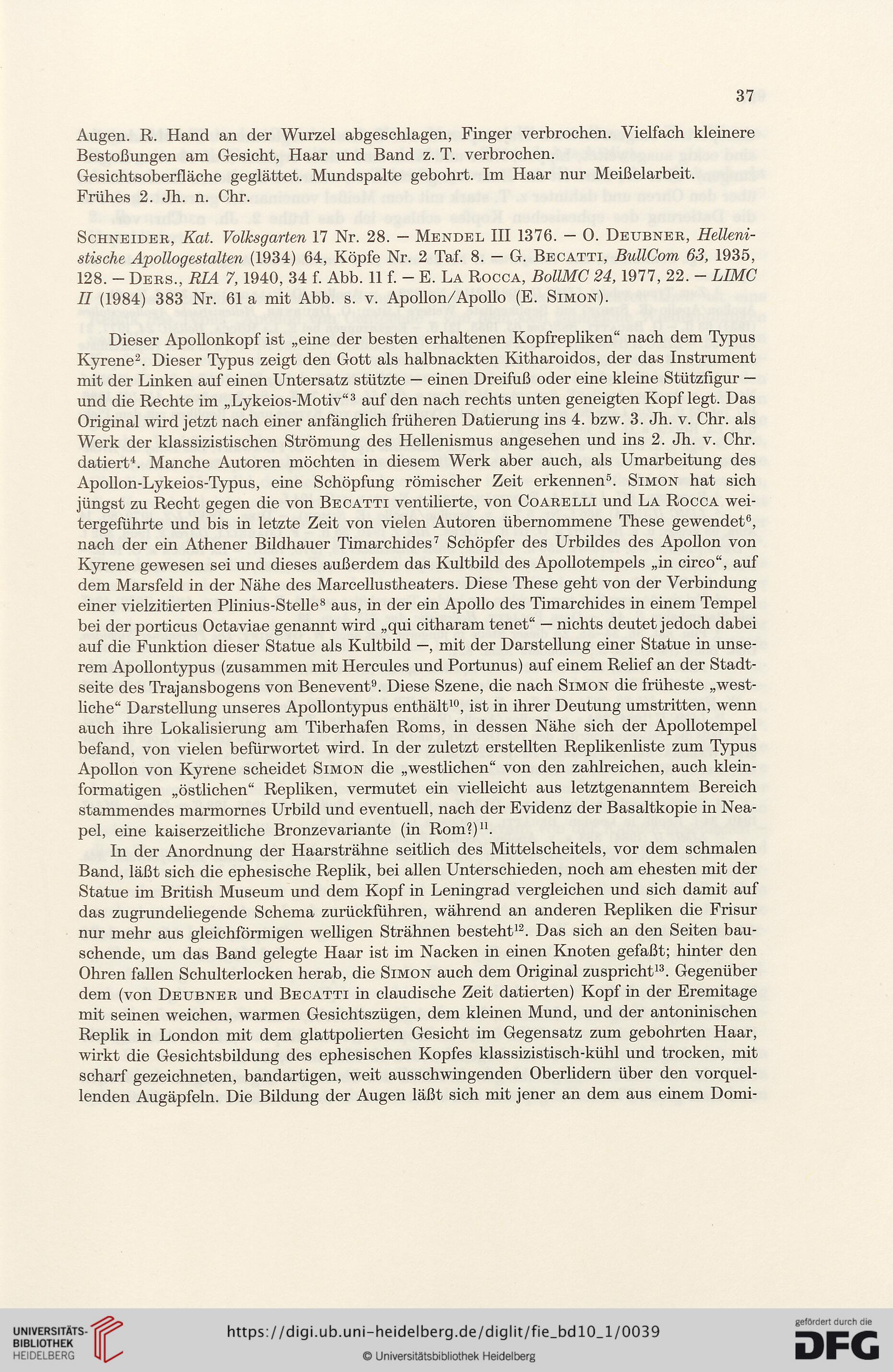37
Augen. R. Hand an der Wurzel abgeschlagen, Finger verbrochen. Vielfach kleinere
Bestoßungen am Gesicht, Haar und Band z. T. verbrochen.
Gesichtsoberfläche geglättet. Mundspalte gebohrt. Im Haar nur Meißelarbeit.
Frühes 2. Jh. n. Chr.
Schneider, Kat. Volksgarten 17 Nr. 28. — Mendel III 1376. — 0. Deubner, Helleni-
stische Apollogestalten (1934) 64, Köpfe Nr. 2 Taf. 8. — G. Becatti, BullCom 63, 1935,
128. - Ders., RIA 7, 1940, 34 f. Abb. 11 f. - E. La Rocca, BollMC 24,1977, 22. - LIMC
II (1984) 383 Nr. 61 a mit Abb. s. v. Apollon/Apollo (E. Simon).
Dieser Apollonkopf ist „eine der besten erhaltenen Kopfrepliken“ nach dem Typus
Kyrene2. Dieser Typus zeigt den Gott als halbnackten Kitharoidos, der das Instrument
mit der Linken auf einen Untersatz stützte — einen Dreifuß oder eine kleine Stützflgur —
und die Rechte im „Lykeios-Motiv“3 auf den nach rechts unten geneigten Kopf legt. Das
Original wird jetzt nach einer anfänglich früheren Datierung ins 4. bzw. 3. Jh. v. Chr. als
Werk der klassizistischen Strömung des Hellenismus angesehen und ins 2. Jh. v. Chr.
datiert4. Manche Autoren möchten in diesem Werk aber auch, als Umarbeitung des
Apollon-Lykeios-Typus, eine Schöpfung römischer Zeit erkennen5. Simon hat sich
jüngst zu Recht gegen die von Becatti ventilierte, von Coarelli und La Rocca wei-
tergeführte und bis in letzte Zeit von vielen Autoren übernommene These gewendet6,
nach der ein Athener Bildhauer Timarchides7 Schöpfer des Urbildes des Apollon von
Kyrene gewesen sei und dieses außerdem das Kultbild des Apollotempels „in circo“, auf
dem Marsfeld in der Nähe des Marcellustheaters. Diese These geht von der Verbindung
einer vielzitierten Plinius-Stelle8 aus, in der ein Apollo des Timarchides in einem Tempel
bei der porticus Octaviae genannt wird „qui citharam tenet“ — nichts deutet jedoch dabei
auf die Funktion dieser Statue als Kultbild —, mit der Darstellung einer Statue in unse-
rem Apollontypus (zusammen mit Hercules und Portunus) auf einem Relief an der Stadt-
seite des Trajansbogens von Benevent9. Diese Szene, die nach Simon die früheste „west-
liche“ Darstellung unseres Apollontypus enthält10, ist in ihrer Deutung umstritten, wenn
auch ihre Lokalisierung am Tiberhafen Roms, in dessen Nähe sich der Apollotempel
befand, von vielen befürwortet wird. In der zuletzt erstellten Replikenliste zum Typus
Apollon von Kyrene scheidet Simon die „westlichen“ von den zahlreichen, auch klein-
formatigen „östlichen“ Repliken, vermutet ein vielleicht aus letztgenanntem Bereich
stammendes marmornes Urbild und eventuell, nach der Evidenz der Basaltkopie in Nea-
pel, eine kaiserzeitliche Bronzevariante (in Rom?)11.
In der Anordnung der Haarsträhne seitlich des Mittelscheitels, vor dem schmalen
Band, läßt sich die ephesische Replik, bei allen Unterschieden, noch am ehesten mit der
Statue im British Museum und dem Kopf in Leningrad vergleichen und sich damit auf
das zugrundeliegende Schema zurückführen, während an anderen Repliken die Frisur
nur mehr aus gleichförmigen welligen Strähnen besteht12. Das sich an den Seiten bau-
schende, um das Band gelegte Haar ist im Nacken in einen Knoten gefaßt; hinter den
Ohren fallen Schulterlocken herab, die Simon auch dem Original zuspricht13. Gegenüber
dem (von Deubner und Becatti in claudische Zeit datierten) Kopf in der Eremitage
mit seinen weichen, warmen Gesichtszügen, dem kleinen Mund, und der antoninischen
Replik in London mit dem glattpolierten Gesicht im Gegensatz zum gebohrten Haar,
wirkt die Gesichtsbildung des ephesischen Kopfes klassizistisch-kühl und trocken, mit
scharf gezeichneten, bandartigen, weit ausschwingenden Oberlidern über den vorquel-
lenden Augäpfeln. Die Bildung der Augen läßt sich mit jener an dem aus einem Domi-
Augen. R. Hand an der Wurzel abgeschlagen, Finger verbrochen. Vielfach kleinere
Bestoßungen am Gesicht, Haar und Band z. T. verbrochen.
Gesichtsoberfläche geglättet. Mundspalte gebohrt. Im Haar nur Meißelarbeit.
Frühes 2. Jh. n. Chr.
Schneider, Kat. Volksgarten 17 Nr. 28. — Mendel III 1376. — 0. Deubner, Helleni-
stische Apollogestalten (1934) 64, Köpfe Nr. 2 Taf. 8. — G. Becatti, BullCom 63, 1935,
128. - Ders., RIA 7, 1940, 34 f. Abb. 11 f. - E. La Rocca, BollMC 24,1977, 22. - LIMC
II (1984) 383 Nr. 61 a mit Abb. s. v. Apollon/Apollo (E. Simon).
Dieser Apollonkopf ist „eine der besten erhaltenen Kopfrepliken“ nach dem Typus
Kyrene2. Dieser Typus zeigt den Gott als halbnackten Kitharoidos, der das Instrument
mit der Linken auf einen Untersatz stützte — einen Dreifuß oder eine kleine Stützflgur —
und die Rechte im „Lykeios-Motiv“3 auf den nach rechts unten geneigten Kopf legt. Das
Original wird jetzt nach einer anfänglich früheren Datierung ins 4. bzw. 3. Jh. v. Chr. als
Werk der klassizistischen Strömung des Hellenismus angesehen und ins 2. Jh. v. Chr.
datiert4. Manche Autoren möchten in diesem Werk aber auch, als Umarbeitung des
Apollon-Lykeios-Typus, eine Schöpfung römischer Zeit erkennen5. Simon hat sich
jüngst zu Recht gegen die von Becatti ventilierte, von Coarelli und La Rocca wei-
tergeführte und bis in letzte Zeit von vielen Autoren übernommene These gewendet6,
nach der ein Athener Bildhauer Timarchides7 Schöpfer des Urbildes des Apollon von
Kyrene gewesen sei und dieses außerdem das Kultbild des Apollotempels „in circo“, auf
dem Marsfeld in der Nähe des Marcellustheaters. Diese These geht von der Verbindung
einer vielzitierten Plinius-Stelle8 aus, in der ein Apollo des Timarchides in einem Tempel
bei der porticus Octaviae genannt wird „qui citharam tenet“ — nichts deutet jedoch dabei
auf die Funktion dieser Statue als Kultbild —, mit der Darstellung einer Statue in unse-
rem Apollontypus (zusammen mit Hercules und Portunus) auf einem Relief an der Stadt-
seite des Trajansbogens von Benevent9. Diese Szene, die nach Simon die früheste „west-
liche“ Darstellung unseres Apollontypus enthält10, ist in ihrer Deutung umstritten, wenn
auch ihre Lokalisierung am Tiberhafen Roms, in dessen Nähe sich der Apollotempel
befand, von vielen befürwortet wird. In der zuletzt erstellten Replikenliste zum Typus
Apollon von Kyrene scheidet Simon die „westlichen“ von den zahlreichen, auch klein-
formatigen „östlichen“ Repliken, vermutet ein vielleicht aus letztgenanntem Bereich
stammendes marmornes Urbild und eventuell, nach der Evidenz der Basaltkopie in Nea-
pel, eine kaiserzeitliche Bronzevariante (in Rom?)11.
In der Anordnung der Haarsträhne seitlich des Mittelscheitels, vor dem schmalen
Band, läßt sich die ephesische Replik, bei allen Unterschieden, noch am ehesten mit der
Statue im British Museum und dem Kopf in Leningrad vergleichen und sich damit auf
das zugrundeliegende Schema zurückführen, während an anderen Repliken die Frisur
nur mehr aus gleichförmigen welligen Strähnen besteht12. Das sich an den Seiten bau-
schende, um das Band gelegte Haar ist im Nacken in einen Knoten gefaßt; hinter den
Ohren fallen Schulterlocken herab, die Simon auch dem Original zuspricht13. Gegenüber
dem (von Deubner und Becatti in claudische Zeit datierten) Kopf in der Eremitage
mit seinen weichen, warmen Gesichtszügen, dem kleinen Mund, und der antoninischen
Replik in London mit dem glattpolierten Gesicht im Gegensatz zum gebohrten Haar,
wirkt die Gesichtsbildung des ephesischen Kopfes klassizistisch-kühl und trocken, mit
scharf gezeichneten, bandartigen, weit ausschwingenden Oberlidern über den vorquel-
lenden Augäpfeln. Die Bildung der Augen läßt sich mit jener an dem aus einem Domi-