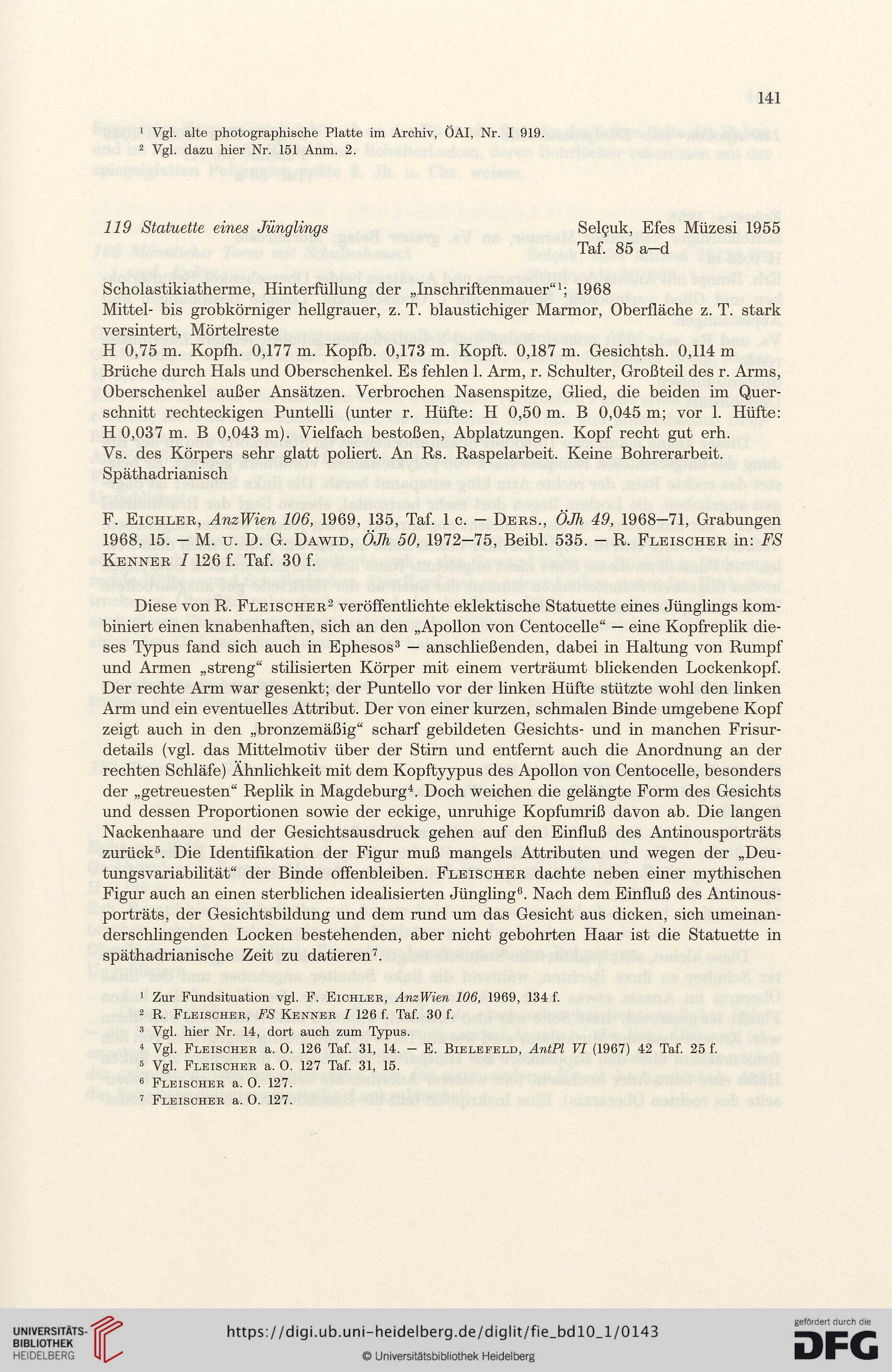141
1 Vgl. alte photographische Platte im Archiv, ÖAI, Nr. I 919.
2 Vgl. dazu hier Nr. 151 Anm. 2.
119 Statuette eines Jünglings Sekjuk, Efes Müzesi 1955
Taf. 85 a—d
Scholastikiatherme, Hinterfullung der „Inschriftenmauer“1; 1968
Mittel- bis grobkörniger hellgrauer, z. T. blaustichiger Marmor, Oberfläche z. T. stark
versintert, Mörtelreste
H 0,75 m. Kopfh. 0,177 m. Kopfb. 0,173 m. Köpft. 0,187 m. Gesichtsh. 0,114 m
Brüche durch Hals und Oberschenkel. Es fehlen 1. Arm, r. Schulter, Großteil des r. Arms,
Oberschenkel außer Ansätzen. Verbrochen Nasenspitze, Glied, die beiden im Quer-
schnitt rechteckigen Puntelli (unter r. Hüfte: H 0,50 m. B 0,045 m; vor 1. Hüfte:
H 0,037 m. B 0,043 m). Vielfach bestoßen, Abplatzungen. Kopf recht gut erh.
Vs. des Körpers sehr glatt poliert. An Rs. Raspelarbeit. Keine Bohrerarbeit.
Späthadrianisch
F. Eichler, AnzWien 106, 1969, 135, Taf. 1 c. — Ders., ÖJh 49, 1968—71, Grabungen
1968, 15. — M. u. D. G. Dawid, ÖJh 50, 1972—75, Beibl. 535. — R. Fleischer in: FS
Kenner I 126 f. Taf. 30 f.
Diese von R. Fleischer2 veröffentlichte eklektische Statuette eines Jünglings kom-
biniert einen knabenhaften, sich an den „Apollon von Centocelle“ — eine Kopfreplik die-
ses Typus fand sich auch in Ephesos3 — anschließenden, dabei in Haltung von Rumpf
und Armen „streng“ stilisierten Körper mit einem verträumt blickenden Lockenkopf.
Der rechte Arm war gesenkt; der Puntello vor der linken Hüfte stützte wohl den linken
Arm und ein eventuelles Attribut. Der von einer kurzen, schmalen Binde umgebene Kopf
zeigt auch in den „bronzemäßig“ scharf gebildeten Gesichts- und in manchen Frisur-
details (vgl. das Mittelmotiv über der Stirn und entfernt auch die Anordnung an der
rechten Schläfe) Ähnlichkeit mit dem Kopftyypus des Apollon von Centocelle, besonders
der „getreuesten“ Replik in Magdeburg4. Doch weichen die gelängte Form des Gesichts
und dessen Proportionen sowie der eckige, unruhige Kopfumriß davon ab. Die langen
Nackenhaare und der Gesichtsausdruck gehen auf den Einfluß des Antinousporträts
zurück5. Die Identifikation der Figur muß mangels Attributen und wegen der „Deu-
tungsvariabilität“ der Binde offenbleiben. Fleischer dachte neben einer mythischen
Figur auch an einen sterblichen idealisierten Jüngling6. Nach dem Einfluß des Antinous-
porträts, der Gesichtsbildung und dem rund um das Gesicht aus dicken, sich umeinan-
derschlingenden Locken bestehenden, aber nicht gebohrten Haar ist die Statuette in
späthadrianische Zeit zu datieren7.
1 Zur Fundsituation vgl. F. Eichler, AnzWien 106, 1969, 134 f.
2 R. Fleischer, FS Kenner I 126 f. Taf. 30 f.
3 Vgl. hier Nr. 14, dort auch zum Typus.
4 Vgl. Fleischer a. O. 126 Taf. 31, 14. — E. Bielefeld, AntPl VI (1967) 42 Taf. 25 f.
5 Vgl. Fleischer a. O. 127 Taf. 31, 15.
6 Fleischer a. O. 127.
7 Fleischer a. O. 127.
1 Vgl. alte photographische Platte im Archiv, ÖAI, Nr. I 919.
2 Vgl. dazu hier Nr. 151 Anm. 2.
119 Statuette eines Jünglings Sekjuk, Efes Müzesi 1955
Taf. 85 a—d
Scholastikiatherme, Hinterfullung der „Inschriftenmauer“1; 1968
Mittel- bis grobkörniger hellgrauer, z. T. blaustichiger Marmor, Oberfläche z. T. stark
versintert, Mörtelreste
H 0,75 m. Kopfh. 0,177 m. Kopfb. 0,173 m. Köpft. 0,187 m. Gesichtsh. 0,114 m
Brüche durch Hals und Oberschenkel. Es fehlen 1. Arm, r. Schulter, Großteil des r. Arms,
Oberschenkel außer Ansätzen. Verbrochen Nasenspitze, Glied, die beiden im Quer-
schnitt rechteckigen Puntelli (unter r. Hüfte: H 0,50 m. B 0,045 m; vor 1. Hüfte:
H 0,037 m. B 0,043 m). Vielfach bestoßen, Abplatzungen. Kopf recht gut erh.
Vs. des Körpers sehr glatt poliert. An Rs. Raspelarbeit. Keine Bohrerarbeit.
Späthadrianisch
F. Eichler, AnzWien 106, 1969, 135, Taf. 1 c. — Ders., ÖJh 49, 1968—71, Grabungen
1968, 15. — M. u. D. G. Dawid, ÖJh 50, 1972—75, Beibl. 535. — R. Fleischer in: FS
Kenner I 126 f. Taf. 30 f.
Diese von R. Fleischer2 veröffentlichte eklektische Statuette eines Jünglings kom-
biniert einen knabenhaften, sich an den „Apollon von Centocelle“ — eine Kopfreplik die-
ses Typus fand sich auch in Ephesos3 — anschließenden, dabei in Haltung von Rumpf
und Armen „streng“ stilisierten Körper mit einem verträumt blickenden Lockenkopf.
Der rechte Arm war gesenkt; der Puntello vor der linken Hüfte stützte wohl den linken
Arm und ein eventuelles Attribut. Der von einer kurzen, schmalen Binde umgebene Kopf
zeigt auch in den „bronzemäßig“ scharf gebildeten Gesichts- und in manchen Frisur-
details (vgl. das Mittelmotiv über der Stirn und entfernt auch die Anordnung an der
rechten Schläfe) Ähnlichkeit mit dem Kopftyypus des Apollon von Centocelle, besonders
der „getreuesten“ Replik in Magdeburg4. Doch weichen die gelängte Form des Gesichts
und dessen Proportionen sowie der eckige, unruhige Kopfumriß davon ab. Die langen
Nackenhaare und der Gesichtsausdruck gehen auf den Einfluß des Antinousporträts
zurück5. Die Identifikation der Figur muß mangels Attributen und wegen der „Deu-
tungsvariabilität“ der Binde offenbleiben. Fleischer dachte neben einer mythischen
Figur auch an einen sterblichen idealisierten Jüngling6. Nach dem Einfluß des Antinous-
porträts, der Gesichtsbildung und dem rund um das Gesicht aus dicken, sich umeinan-
derschlingenden Locken bestehenden, aber nicht gebohrten Haar ist die Statuette in
späthadrianische Zeit zu datieren7.
1 Zur Fundsituation vgl. F. Eichler, AnzWien 106, 1969, 134 f.
2 R. Fleischer, FS Kenner I 126 f. Taf. 30 f.
3 Vgl. hier Nr. 14, dort auch zum Typus.
4 Vgl. Fleischer a. O. 126 Taf. 31, 14. — E. Bielefeld, AntPl VI (1967) 42 Taf. 25 f.
5 Vgl. Fleischer a. O. 127 Taf. 31, 15.
6 Fleischer a. O. 127.
7 Fleischer a. O. 127.