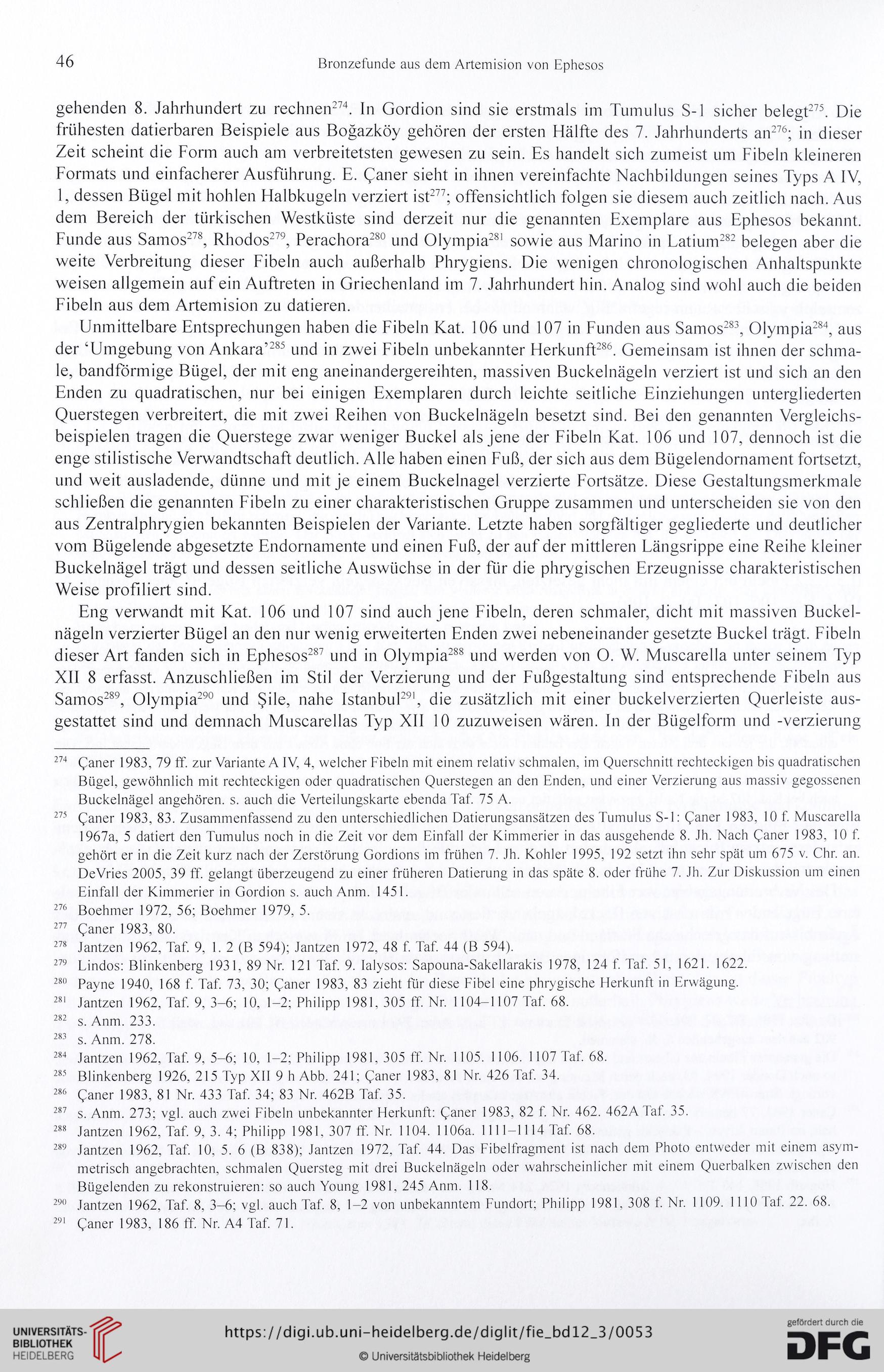46
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
gehenden 8. Jahrhundert zu rechnen274. In Gordion sind sie erstmals im Tumulus S-l sicher belegt275. Die
frühesten datierbaren Beispiele aus Bogazköy gehören der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts an276; in dieser
Zeit scheint die Form auch am verbreitetsten gewesen zu sein. Es handelt sich zumeist um Fibeln kleineren
Formats und einfacherer Ausführung. E. Qaner sieht in ihnen vereinfachte Nachbildungen seines Typs A IV,
1, dessen Bügel mit hohlen Halbkugeln verziert ist277; offensichtlich folgen sie diesem auch zeitlich nach. Aus
dem Bereich der türkischen Westküste sind derzeit nur die genannten Exemplare aus Ephesos bekannt.
Funde aus Samos278, Rhodos279, Perachora280 und Olympia281 sowie aus Marino in Latium282 belegen aber die
weite Verbreitung dieser Fibeln auch außerhalb Phrygiens. Die wenigen chronologischen Anhaltspunkte
weisen allgemein auf ein Auftreten in Griechenland im 7. Jahrhundert hin. Analog sind wohl auch die beiden
Fibeln aus dem Artemision zu datieren.
Unmittelbare Entsprechungen haben die Fibeln Kat. 106 und 107 in Funden aus Samos283, Olympia284, aus
der ‘Umgebung von Ankara’285 und in zwei Fibeln unbekannter Herkunft286. Gemeinsam ist ihnen der schma-
le, bandförmige Bügel, der mit eng aneinandergereihten, massiven Buckelnägeln verziert ist und sich an den
Enden zu quadratischen, nur bei einigen Exemplaren durch leichte seitliche Einziehungen untergliederten
Querstegen verbreitert, die mit zwei Reihen von Buckelnägeln besetzt sind. Bei den genannten Vergleichs-
beispielen tragen die Querstege zwar weniger Buckel als jene der Fibeln Kat. 106 und 107, dennoch ist die
enge stilistische Verwandtschaft deutlich. Alle haben einen Fuß, der sich aus dem Bügelendornament fortsetzt,
und weit ausladende, dünne und mit je einem Buckelnagel verzierte Fortsätze. Diese Gestaltungsmerkmale
schließen die genannten Fibeln zu einer charakteristischen Gruppe zusammen und unterscheiden sie von den
aus Zentralphrygien bekannten Beispielen der Variante. Letzte haben sorgfältiger gegliederte und deutlicher
vom Bügelende abgesetzte Endornamente und einen Fuß, der auf der mittleren Längsrippe eine Reihe kleiner
Buckelnägel trägt und dessen seitliche Auswüchse in der für die phrygischen Erzeugnisse charakteristischen
Weise profiliert sind.
Eng verwandt mit Kat. 106 und 107 sind auch jene Fibeln, deren schmaler, dicht mit massiven Buckel-
nägeln verzierter Bügel an den nur wenig erweiterten Enden zwei nebeneinander gesetzte Buckel trägt. Fibeln
dieser Art fanden sich in Ephesos287 und in Olympia288 und werden von O. W. Muscarella unter seinem Typ
XII 8 erfasst. Anzuschließen im Stil der Verzierung und der Fußgestaltung sind entsprechende Fibeln aus
Samos289, Olympia290 und §ile, nahe Istanbul291, die zusätzlich mit einer buckelverzierten Querleiste aus-
gestattet sind und demnach Muscarellas Typ XII 10 zuzuweisen wären. In der Bügelform und -Verzierung
274 Qaner 1983, 79 ff. zur Variante A IV, 4, welcher Fibeln mit einem relativ schmalen, im Querschnitt rechteckigen bis quadratischen
Bügel, gewöhnlich mit rechteckigen oder quadratischen Querstegen an den Enden, und einer Verzierung aus massiv gegossenen
Buckelnägel angehören, s. auch die Verteilungskarte ebenda Taf. 75 A.
275 Qaner 1983, 83. Zusammenfassend zu den unterschiedlichen Datierungsansätzen des Tumulus S-l: Qaner 1983, 10 f. Muscarella
1967a, 5 datiert den Tumulus noch in die Zeit vor dem Einfall der Kimmerier in das ausgehende 8. Jh. Nach Qaner 1983, 10 f.
gehört er in die Zeit kurz nach der Zerstörung Gordions im frühen 7. Jh. Kohler 1995. 192 setzt ihn sehr spät um 675 v. Chr. an.
DeVries 2005, 39 ff. gelangt überzeugend zu einer früheren Datierung in das späte 8. oder frühe 7. Jh. Zur Diskussion um einen
Einfall der Kimmerier in Gordion s. auch Anm. 1451.
276 Boehmer 1972. 56; Boehmer 1979, 5.
277 Qaner 1983, 80.
278 Jantzen 1962, Taf. 9, 1. 2 (B 594); Jantzen 1972, 48 f. Taf. 44 (B 594).
279 Lindos: Blinkenberg 1931, 89 Nr. 121 Taf. 9. lalysos: Sapouna-Sakellarakis 1978. 124 f. Taf. 51. 1621. 1622.
280 Payne 1940, 168 f. Taf. 73, 30; Qaner 1983, 83 zieht für diese Fibel eine phrygische Flerkunft in Erwägung.
281 Jantzen 1962. Taf. 9, 3-6; 10, 1-2; Philipp 1981. 305 ff. Nr. 1104-1107 Taf. 68.
282 s. Anm. 233.
283 s. Anm. 278.
284 Jantzen 1962, Taf. 9, 5-6: 10, 1-2; Philipp 1981, 305 ff. Nr. 1105. 1106. 1107 Taf. 68.
285 Blinkenberg 1926, 215 Typ Xll 9 h Abb. 241; Qaner 1983, 81 Nr. 426 Taf. 34.
286 Qaner 1983, 81 Nr. 433 Taf. 34; 83 Nr. 462B Taf. 35.
287 s. Anm. 273; vgl. auch zwei Fibeln unbekannter Herkunft: Qaner 1983, 82 f. Nr. 462. 462A Taf. 35.
288 Jantzen 1962, Taf. 9, 3. 4; Philipp 1981. 307 ff. Nr. 1104. 1106a. 1111-1114 Taf. 68.
289 Jantzen 1962, Taf. 10, 5. 6 (B 838); Jantzen 1972, Taf. 44. Das Fibelfragment ist nach dem Photo entweder mit einem asym-
metrisch angebrachten, schmalen Quersteg mit drei Buckelnägeln oder wahrscheinlicher mit einem Querbalken zwischen den
Bügelenden zu rekonstruieren: so auch Young 1981. 245 Anm. 118.
29,1 Jantzen 1962. Taf. 8. 3-6; vgl. auch Taf. 8. 1-2 von unbekanntem Fundort; Philipp 1981, 308 f. Nr. 1109. 1110 Taf. 22. 68.
291 Qaner 1983, 186 ff. Nr. A4 Taf. 71.
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
gehenden 8. Jahrhundert zu rechnen274. In Gordion sind sie erstmals im Tumulus S-l sicher belegt275. Die
frühesten datierbaren Beispiele aus Bogazköy gehören der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts an276; in dieser
Zeit scheint die Form auch am verbreitetsten gewesen zu sein. Es handelt sich zumeist um Fibeln kleineren
Formats und einfacherer Ausführung. E. Qaner sieht in ihnen vereinfachte Nachbildungen seines Typs A IV,
1, dessen Bügel mit hohlen Halbkugeln verziert ist277; offensichtlich folgen sie diesem auch zeitlich nach. Aus
dem Bereich der türkischen Westküste sind derzeit nur die genannten Exemplare aus Ephesos bekannt.
Funde aus Samos278, Rhodos279, Perachora280 und Olympia281 sowie aus Marino in Latium282 belegen aber die
weite Verbreitung dieser Fibeln auch außerhalb Phrygiens. Die wenigen chronologischen Anhaltspunkte
weisen allgemein auf ein Auftreten in Griechenland im 7. Jahrhundert hin. Analog sind wohl auch die beiden
Fibeln aus dem Artemision zu datieren.
Unmittelbare Entsprechungen haben die Fibeln Kat. 106 und 107 in Funden aus Samos283, Olympia284, aus
der ‘Umgebung von Ankara’285 und in zwei Fibeln unbekannter Herkunft286. Gemeinsam ist ihnen der schma-
le, bandförmige Bügel, der mit eng aneinandergereihten, massiven Buckelnägeln verziert ist und sich an den
Enden zu quadratischen, nur bei einigen Exemplaren durch leichte seitliche Einziehungen untergliederten
Querstegen verbreitert, die mit zwei Reihen von Buckelnägeln besetzt sind. Bei den genannten Vergleichs-
beispielen tragen die Querstege zwar weniger Buckel als jene der Fibeln Kat. 106 und 107, dennoch ist die
enge stilistische Verwandtschaft deutlich. Alle haben einen Fuß, der sich aus dem Bügelendornament fortsetzt,
und weit ausladende, dünne und mit je einem Buckelnagel verzierte Fortsätze. Diese Gestaltungsmerkmale
schließen die genannten Fibeln zu einer charakteristischen Gruppe zusammen und unterscheiden sie von den
aus Zentralphrygien bekannten Beispielen der Variante. Letzte haben sorgfältiger gegliederte und deutlicher
vom Bügelende abgesetzte Endornamente und einen Fuß, der auf der mittleren Längsrippe eine Reihe kleiner
Buckelnägel trägt und dessen seitliche Auswüchse in der für die phrygischen Erzeugnisse charakteristischen
Weise profiliert sind.
Eng verwandt mit Kat. 106 und 107 sind auch jene Fibeln, deren schmaler, dicht mit massiven Buckel-
nägeln verzierter Bügel an den nur wenig erweiterten Enden zwei nebeneinander gesetzte Buckel trägt. Fibeln
dieser Art fanden sich in Ephesos287 und in Olympia288 und werden von O. W. Muscarella unter seinem Typ
XII 8 erfasst. Anzuschließen im Stil der Verzierung und der Fußgestaltung sind entsprechende Fibeln aus
Samos289, Olympia290 und §ile, nahe Istanbul291, die zusätzlich mit einer buckelverzierten Querleiste aus-
gestattet sind und demnach Muscarellas Typ XII 10 zuzuweisen wären. In der Bügelform und -Verzierung
274 Qaner 1983, 79 ff. zur Variante A IV, 4, welcher Fibeln mit einem relativ schmalen, im Querschnitt rechteckigen bis quadratischen
Bügel, gewöhnlich mit rechteckigen oder quadratischen Querstegen an den Enden, und einer Verzierung aus massiv gegossenen
Buckelnägel angehören, s. auch die Verteilungskarte ebenda Taf. 75 A.
275 Qaner 1983, 83. Zusammenfassend zu den unterschiedlichen Datierungsansätzen des Tumulus S-l: Qaner 1983, 10 f. Muscarella
1967a, 5 datiert den Tumulus noch in die Zeit vor dem Einfall der Kimmerier in das ausgehende 8. Jh. Nach Qaner 1983, 10 f.
gehört er in die Zeit kurz nach der Zerstörung Gordions im frühen 7. Jh. Kohler 1995. 192 setzt ihn sehr spät um 675 v. Chr. an.
DeVries 2005, 39 ff. gelangt überzeugend zu einer früheren Datierung in das späte 8. oder frühe 7. Jh. Zur Diskussion um einen
Einfall der Kimmerier in Gordion s. auch Anm. 1451.
276 Boehmer 1972. 56; Boehmer 1979, 5.
277 Qaner 1983, 80.
278 Jantzen 1962, Taf. 9, 1. 2 (B 594); Jantzen 1972, 48 f. Taf. 44 (B 594).
279 Lindos: Blinkenberg 1931, 89 Nr. 121 Taf. 9. lalysos: Sapouna-Sakellarakis 1978. 124 f. Taf. 51. 1621. 1622.
280 Payne 1940, 168 f. Taf. 73, 30; Qaner 1983, 83 zieht für diese Fibel eine phrygische Flerkunft in Erwägung.
281 Jantzen 1962. Taf. 9, 3-6; 10, 1-2; Philipp 1981. 305 ff. Nr. 1104-1107 Taf. 68.
282 s. Anm. 233.
283 s. Anm. 278.
284 Jantzen 1962, Taf. 9, 5-6: 10, 1-2; Philipp 1981, 305 ff. Nr. 1105. 1106. 1107 Taf. 68.
285 Blinkenberg 1926, 215 Typ Xll 9 h Abb. 241; Qaner 1983, 81 Nr. 426 Taf. 34.
286 Qaner 1983, 81 Nr. 433 Taf. 34; 83 Nr. 462B Taf. 35.
287 s. Anm. 273; vgl. auch zwei Fibeln unbekannter Herkunft: Qaner 1983, 82 f. Nr. 462. 462A Taf. 35.
288 Jantzen 1962, Taf. 9, 3. 4; Philipp 1981. 307 ff. Nr. 1104. 1106a. 1111-1114 Taf. 68.
289 Jantzen 1962, Taf. 10, 5. 6 (B 838); Jantzen 1972, Taf. 44. Das Fibelfragment ist nach dem Photo entweder mit einem asym-
metrisch angebrachten, schmalen Quersteg mit drei Buckelnägeln oder wahrscheinlicher mit einem Querbalken zwischen den
Bügelenden zu rekonstruieren: so auch Young 1981. 245 Anm. 118.
29,1 Jantzen 1962. Taf. 8. 3-6; vgl. auch Taf. 8. 1-2 von unbekanntem Fundort; Philipp 1981, 308 f. Nr. 1109. 1110 Taf. 22. 68.
291 Qaner 1983, 186 ff. Nr. A4 Taf. 71.