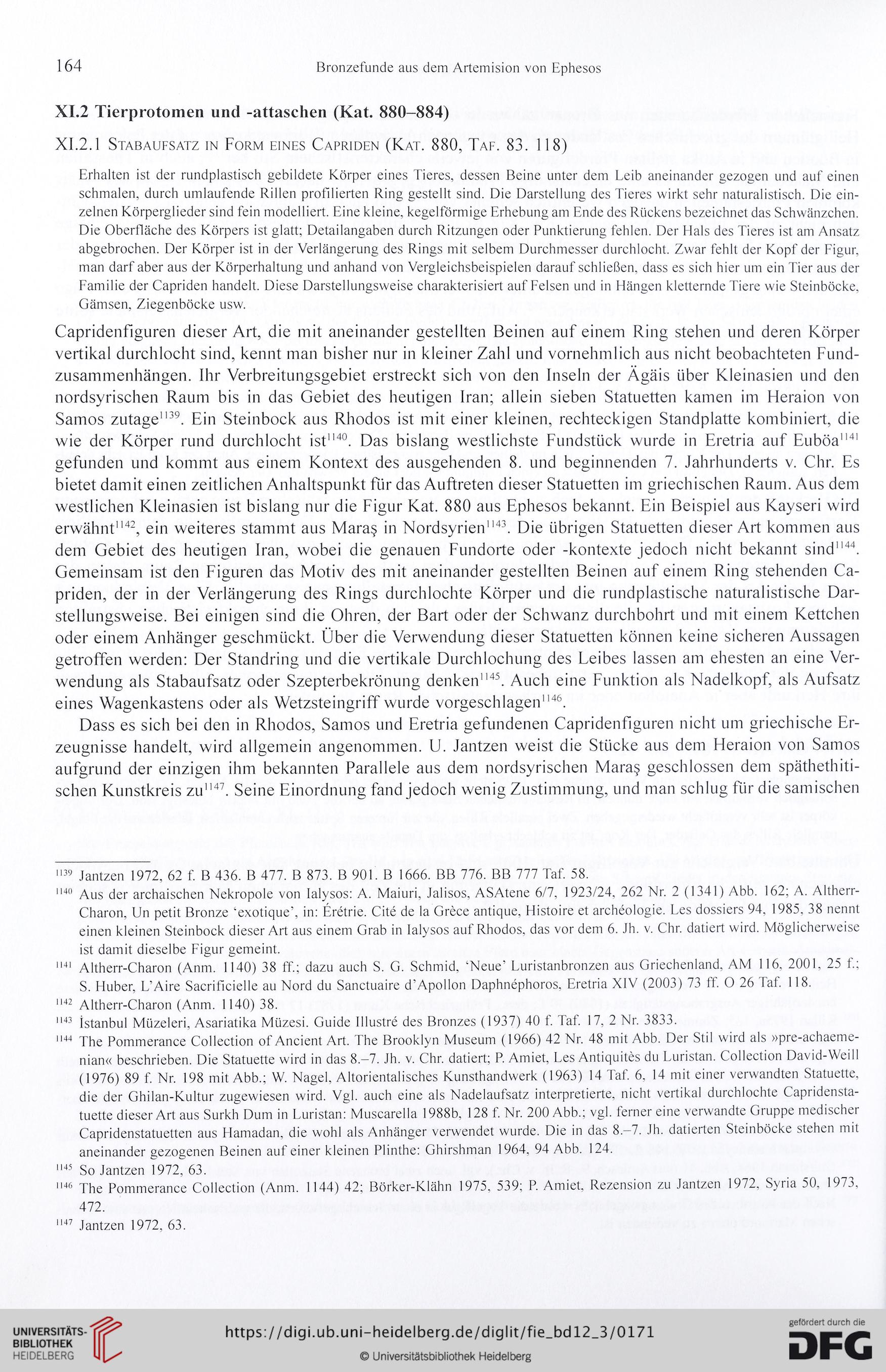164
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
XL2 Tierprotomen und -attaschen (Kat. 880-884)
XI.2.1 Stabaufsatz in Form eines Capriden (Kat. 880, Taf. 83. 118)
Erhalten ist der rundplastisch gebildete Körper eines Tieres, dessen Beine unter dem Leib aneinander gezogen und auf einen
schmalen, durch umlaufende Rillen profilierten Ring gestellt sind. Die Darstellung des Tieres wirkt sehr naturalistisch. Die ein-
zelnen Körperglieder sind fein modelliert. Eine kleine, kegelförmige Erhebung am Ende des Rückens bezeichnet das Schwänzchen.
Die Oberfläche des Körpers ist glatt; Detailangaben durch Ritzungen oder Punktierung fehlen. Der Hals des Tieres ist am Ansatz
abgebrochen. Der Körper ist in der Verlängerung des Rings mit selbem Durchmesser durchlocht. Zwar fehlt der Kopf der Figur,
man darf aber aus der Körperhaltung und anhand von Vergleichsbeispielen darauf schließen, dass es sich hier um ein Tier aus der
Familie der Capriden handelt. Diese Darstellungsweise charakterisiert auf Felsen und in Hängen kletternde Tiere wie Steinböcke,
Gämsen, Ziegenböcke usw.
Capridenfiguren dieser Art, die mit aneinander gestellten Beinen auf einem Ring stehen und deren Körper
vertikal durchlocht sind, kennt man bisher nur in kleiner Zahl und vornehmlich aus nicht beobachteten Fund-
zusammenhängen. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von den Inseln der Ägäis über Kleinasien und den
nordsyrischen Raum bis in das Gebiet des heutigen Iran; allein sieben Statuetten kamen im Heraion von
Samos zutage"39. Ein Steinbock aus Rhodos ist mit einer kleinen, rechteckigen Standplatte kombiniert, die
wie der Körper rund durchlocht ist1139 1140. Das bislang westlichste Fundstück wurde in Eretria auf Euböa1141
gefunden und kommt aus einem Kontext des ausgehenden 8. und beginnenden 7. Jahrhunderts v. Chr. Es
bietet damit einen zeitlichen Anhaltspunkt für das Auftreten dieser Statuetten im griechischen Raum. Aus dem
westlichen Kleinasien ist bislang nur die Figur Kat. 880 aus Ephesos bekannt. Ein Beispiel aus Kayseri wird
erwähnt"42, ein weiteres stammt aus Mara§ in Nordsyrien1143. Die übrigen Statuetten dieser Art kommen aus
dem Gebiet des heutigen Iran, wobei die genauen Fundorte oder -kontexte jedoch nicht bekannt sind"44.
Gemeinsam ist den Figuren das Motiv des mit aneinander gestellten Beinen auf einem Ring stehenden Ca-
priden, der in der Verlängerung des Rings durchlochte Körper und die rundplastische naturalistische Dar-
stellungsweise. Bei einigen sind die Ohren, der Bart oder der Schwanz durchbohrt und mit einem Kettchen
oder einem Anhänger geschmückt. Über die Verwendung dieser Statuetten können keine sicheren Aussagen
getroffen werden: Der Standring und die vertikale Durchlochung des Leibes lassen am ehesten an eine Ver-
wendung als Stabaufsatz oder Szepterbekrönung denken"45. Auch eine Funktion als Nadelkopf, als Aufsatz
eines Wagenkastens oder als Wetzsteingriff wurde vorgeschlagen1146 1147.
Dass es sich bei den in Rhodos, Samos und Eretria gefundenen Capridenfiguren nicht um griechische Er-
zeugnisse handelt, wird allgemein angenommen. U. Jantzen weist die Stücke aus dem Heraion von Samos
aufgrund der einzigen ihm bekannten Parallele aus dem nordsyrischen Mara§ geschlossen dem späthethiti-
schen Kunstkreis zu"47. Seine Einordnung fand jedoch wenig Zustimmung, und man schlug für die samischen
1139 Jantzen 1972, 62 f. B 436. B 477. B 873. B 901. B 1666. BB 776. BB 777 Taf. 58.
1140 Aus der archaischen Nekropole von lalysos: A. Maiuri, Jalisos, ASAtene 6/7, 1923/24, 262 Nr. 2 (1341) Abb. 162; A. Altherr-
Charon, Un petit Bronze ‘exotique’, in: Eretrie. Cite de la Grece antique, Histoire et archeologie. Les dossiers 94, 1985, 38 nennt
einen kleinen Steinbock dieser Art aus einem Grab in lalysos auf Rhodos, das vor dem 6. Jh. v. Chr. datiert wird. Möglicherweise
ist damit dieselbe Figur gemeint.
1141 Altherr-Charon (Anm. 1140) 38 ff; dazu auch S. G. Schmid. 'Neue’ Luristanbronzen aus Griechenland, AM 116. 2001, 25 f.;
S. Huber, L’Aire Sacrificielle au Nord du Sanctuaire d’Apollon Daphnephoros, Eretria XIV (2003) 73 ff. O 26 Taf. 118.
1142 Altherr-Charon (Anm. 1140) 38.
1143 Istanbul Müzeleri, Asariatika Müzesi. Guide Illustre des Bronzes (1937) 40 f. Taf. 17, 2 Nr. 3833.
1144 The Pommerance Collection of Ancient Art. The Brooklyn Museum (1966) 42 Nr. 48 mit Abb. Der Stil wird als »pre-achaeme-
nian« beschrieben. Die Statuette wird in das 8.-7. Jh. v. Chr. datiert; P. Amiet, Les Antiquites du Luristan. Collection David-Weill
(1976) 89 f. Nr. 198 mit Abb.: W. Nagel, Altorientalisches Kunsthandwerk (1963) 14 Taf. 6, 14 mit einer verwandten Statuette,
die der Ghilan-Kultur zugewiesen wird. Vgl. auch eine als Nadelaufsatz interpretierte, nicht vertikal durchlochte Capridensta-
tuette dieser Art aus Surkh Dum in Luristan: Muscarella 1988b, 128 f. Nr. 200 Abb.; vgl. fernereine verwandte Gruppe medischer
Capridenstatuetten aus I lamadan, die wohl als Anhänger verwendet wurde. Die in das 8.-7. Jh. datierten Steinböcke stehen mit
aneinander gezogenen Beinen auf einer kleinen Plinthe: Ghirshman 1964, 94 Abb. 124.
1145 So Jantzen 1972, 63.
1146 The Pommerance Collection (Anm. 1144) 42; Börker-Klähn 1975, 539; P. Amiet, Rezension zu Jantzen 1972, Syria 50, 1973,
472.
1147 Jantzen 1972, 63.
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
XL2 Tierprotomen und -attaschen (Kat. 880-884)
XI.2.1 Stabaufsatz in Form eines Capriden (Kat. 880, Taf. 83. 118)
Erhalten ist der rundplastisch gebildete Körper eines Tieres, dessen Beine unter dem Leib aneinander gezogen und auf einen
schmalen, durch umlaufende Rillen profilierten Ring gestellt sind. Die Darstellung des Tieres wirkt sehr naturalistisch. Die ein-
zelnen Körperglieder sind fein modelliert. Eine kleine, kegelförmige Erhebung am Ende des Rückens bezeichnet das Schwänzchen.
Die Oberfläche des Körpers ist glatt; Detailangaben durch Ritzungen oder Punktierung fehlen. Der Hals des Tieres ist am Ansatz
abgebrochen. Der Körper ist in der Verlängerung des Rings mit selbem Durchmesser durchlocht. Zwar fehlt der Kopf der Figur,
man darf aber aus der Körperhaltung und anhand von Vergleichsbeispielen darauf schließen, dass es sich hier um ein Tier aus der
Familie der Capriden handelt. Diese Darstellungsweise charakterisiert auf Felsen und in Hängen kletternde Tiere wie Steinböcke,
Gämsen, Ziegenböcke usw.
Capridenfiguren dieser Art, die mit aneinander gestellten Beinen auf einem Ring stehen und deren Körper
vertikal durchlocht sind, kennt man bisher nur in kleiner Zahl und vornehmlich aus nicht beobachteten Fund-
zusammenhängen. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von den Inseln der Ägäis über Kleinasien und den
nordsyrischen Raum bis in das Gebiet des heutigen Iran; allein sieben Statuetten kamen im Heraion von
Samos zutage"39. Ein Steinbock aus Rhodos ist mit einer kleinen, rechteckigen Standplatte kombiniert, die
wie der Körper rund durchlocht ist1139 1140. Das bislang westlichste Fundstück wurde in Eretria auf Euböa1141
gefunden und kommt aus einem Kontext des ausgehenden 8. und beginnenden 7. Jahrhunderts v. Chr. Es
bietet damit einen zeitlichen Anhaltspunkt für das Auftreten dieser Statuetten im griechischen Raum. Aus dem
westlichen Kleinasien ist bislang nur die Figur Kat. 880 aus Ephesos bekannt. Ein Beispiel aus Kayseri wird
erwähnt"42, ein weiteres stammt aus Mara§ in Nordsyrien1143. Die übrigen Statuetten dieser Art kommen aus
dem Gebiet des heutigen Iran, wobei die genauen Fundorte oder -kontexte jedoch nicht bekannt sind"44.
Gemeinsam ist den Figuren das Motiv des mit aneinander gestellten Beinen auf einem Ring stehenden Ca-
priden, der in der Verlängerung des Rings durchlochte Körper und die rundplastische naturalistische Dar-
stellungsweise. Bei einigen sind die Ohren, der Bart oder der Schwanz durchbohrt und mit einem Kettchen
oder einem Anhänger geschmückt. Über die Verwendung dieser Statuetten können keine sicheren Aussagen
getroffen werden: Der Standring und die vertikale Durchlochung des Leibes lassen am ehesten an eine Ver-
wendung als Stabaufsatz oder Szepterbekrönung denken"45. Auch eine Funktion als Nadelkopf, als Aufsatz
eines Wagenkastens oder als Wetzsteingriff wurde vorgeschlagen1146 1147.
Dass es sich bei den in Rhodos, Samos und Eretria gefundenen Capridenfiguren nicht um griechische Er-
zeugnisse handelt, wird allgemein angenommen. U. Jantzen weist die Stücke aus dem Heraion von Samos
aufgrund der einzigen ihm bekannten Parallele aus dem nordsyrischen Mara§ geschlossen dem späthethiti-
schen Kunstkreis zu"47. Seine Einordnung fand jedoch wenig Zustimmung, und man schlug für die samischen
1139 Jantzen 1972, 62 f. B 436. B 477. B 873. B 901. B 1666. BB 776. BB 777 Taf. 58.
1140 Aus der archaischen Nekropole von lalysos: A. Maiuri, Jalisos, ASAtene 6/7, 1923/24, 262 Nr. 2 (1341) Abb. 162; A. Altherr-
Charon, Un petit Bronze ‘exotique’, in: Eretrie. Cite de la Grece antique, Histoire et archeologie. Les dossiers 94, 1985, 38 nennt
einen kleinen Steinbock dieser Art aus einem Grab in lalysos auf Rhodos, das vor dem 6. Jh. v. Chr. datiert wird. Möglicherweise
ist damit dieselbe Figur gemeint.
1141 Altherr-Charon (Anm. 1140) 38 ff; dazu auch S. G. Schmid. 'Neue’ Luristanbronzen aus Griechenland, AM 116. 2001, 25 f.;
S. Huber, L’Aire Sacrificielle au Nord du Sanctuaire d’Apollon Daphnephoros, Eretria XIV (2003) 73 ff. O 26 Taf. 118.
1142 Altherr-Charon (Anm. 1140) 38.
1143 Istanbul Müzeleri, Asariatika Müzesi. Guide Illustre des Bronzes (1937) 40 f. Taf. 17, 2 Nr. 3833.
1144 The Pommerance Collection of Ancient Art. The Brooklyn Museum (1966) 42 Nr. 48 mit Abb. Der Stil wird als »pre-achaeme-
nian« beschrieben. Die Statuette wird in das 8.-7. Jh. v. Chr. datiert; P. Amiet, Les Antiquites du Luristan. Collection David-Weill
(1976) 89 f. Nr. 198 mit Abb.: W. Nagel, Altorientalisches Kunsthandwerk (1963) 14 Taf. 6, 14 mit einer verwandten Statuette,
die der Ghilan-Kultur zugewiesen wird. Vgl. auch eine als Nadelaufsatz interpretierte, nicht vertikal durchlochte Capridensta-
tuette dieser Art aus Surkh Dum in Luristan: Muscarella 1988b, 128 f. Nr. 200 Abb.; vgl. fernereine verwandte Gruppe medischer
Capridenstatuetten aus I lamadan, die wohl als Anhänger verwendet wurde. Die in das 8.-7. Jh. datierten Steinböcke stehen mit
aneinander gezogenen Beinen auf einer kleinen Plinthe: Ghirshman 1964, 94 Abb. 124.
1145 So Jantzen 1972, 63.
1146 The Pommerance Collection (Anm. 1144) 42; Börker-Klähn 1975, 539; P. Amiet, Rezension zu Jantzen 1972, Syria 50, 1973,
472.
1147 Jantzen 1972, 63.