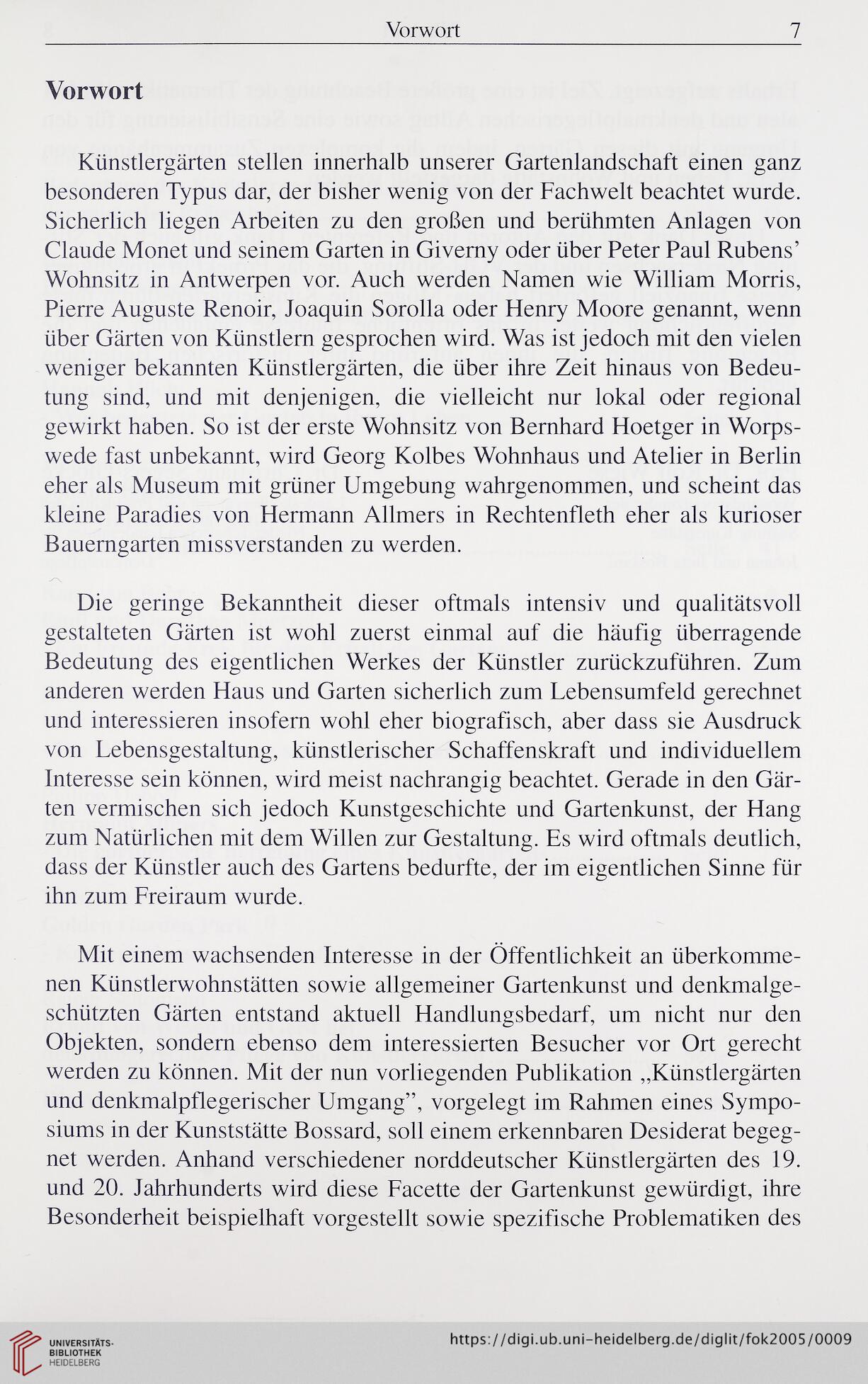Vorwort
7
Vorwort
Künstlergärten stellen innerhalb unserer Gartenlandschaft einen ganz
besonderen Typus dar, der bisher wenig von der Fachwelt beachtet wurde.
Sicherlich liegen Arbeiten zu den großen und berühmten Anlagen von
Claude Monet und seinem Garten in Givemy oder über Peter Paul Rubens’
Wohnsitz in Antwerpen vor. Auch werden Namen wie William Morris,
Pierre Auguste Renoir, Joaquin Sorolla oder Henry Moore genannt, wenn
über Gärten von Künstlern gesprochen wird. Was ist jedoch mit den vielen
weniger bekannten Künstlergärten, die über ihre Zeit hinaus von Bedeu-
tung sind, und mit denjenigen, die vielleicht nur lokal oder regional
gewirkt haben. So ist der erste Wohnsitz von Bernhard Hoetger in Worps-
wede fast unbekannt, wird Georg Kolbes Wohnhaus und Atelier in Berlin
eher als Museum mit grüner Umgebung wahrgenommen, und scheint das
kleine Paradies von Hermann Allmers in Rechtenfleth eher als kurioser
Bauemgarten missverstanden zu werden.
Die geringe Bekanntheit dieser oftmals intensiv und qualitätsvoll
gestalteten Gärten ist wohl zuerst einmal auf die häufig überragende
Bedeutung des eigentlichen Werkes der Künstler zurückzuführen. Zum
anderen werden Haus und Garten sicherlich zum Lebensumfeld gerechnet
und interessieren insofern wohl eher biografisch, aber dass sie Ausdruck
von Lebensgestaltung, künstlerischer Schaffenskraft und individuellem
Interesse sein können, wird meist nachrangig beachtet. Gerade in den Gär-
ten vermischen sich jedoch Kunstgeschichte und Gartenkunst, der Hang
zum Natürlichen mit dem Willen zur Gestaltung. Es wird oftmals deutlich,
dass der Künstler auch des Gartens bedurfte, der im eigentlichen Sinne für
ihn zum Freiraum wurde.
Mit einem wachsenden Interesse in der Öffentlichkeit an überkomme-
nen Künstlerwohnstätten sowie allgemeiner Gartenkunst und denkmalge-
schützten Gärten entstand aktuell Handlungsbedarf, um nicht nur den
Objekten, sondern ebenso dem interessierten Besucher vor Ort gerecht
werden zu können. Mit der nun vorliegenden Publikation „Künstlergärten
und denkmalpflegerischer Umgang”, vorgelegt im Rahmen eines Sympo-
siums in der Kunststätte Bossard, soll einem erkennbaren Desiderat begeg-
net werden. Anhand verschiedener norddeutscher Künstlergärten des 19.
und 20. Jahrhunderts wird diese Facette der Gartenkunst gewürdigt, ihre
Besonderheit beispielhaft vorgestellt sowie spezifische Problematiken des
7
Vorwort
Künstlergärten stellen innerhalb unserer Gartenlandschaft einen ganz
besonderen Typus dar, der bisher wenig von der Fachwelt beachtet wurde.
Sicherlich liegen Arbeiten zu den großen und berühmten Anlagen von
Claude Monet und seinem Garten in Givemy oder über Peter Paul Rubens’
Wohnsitz in Antwerpen vor. Auch werden Namen wie William Morris,
Pierre Auguste Renoir, Joaquin Sorolla oder Henry Moore genannt, wenn
über Gärten von Künstlern gesprochen wird. Was ist jedoch mit den vielen
weniger bekannten Künstlergärten, die über ihre Zeit hinaus von Bedeu-
tung sind, und mit denjenigen, die vielleicht nur lokal oder regional
gewirkt haben. So ist der erste Wohnsitz von Bernhard Hoetger in Worps-
wede fast unbekannt, wird Georg Kolbes Wohnhaus und Atelier in Berlin
eher als Museum mit grüner Umgebung wahrgenommen, und scheint das
kleine Paradies von Hermann Allmers in Rechtenfleth eher als kurioser
Bauemgarten missverstanden zu werden.
Die geringe Bekanntheit dieser oftmals intensiv und qualitätsvoll
gestalteten Gärten ist wohl zuerst einmal auf die häufig überragende
Bedeutung des eigentlichen Werkes der Künstler zurückzuführen. Zum
anderen werden Haus und Garten sicherlich zum Lebensumfeld gerechnet
und interessieren insofern wohl eher biografisch, aber dass sie Ausdruck
von Lebensgestaltung, künstlerischer Schaffenskraft und individuellem
Interesse sein können, wird meist nachrangig beachtet. Gerade in den Gär-
ten vermischen sich jedoch Kunstgeschichte und Gartenkunst, der Hang
zum Natürlichen mit dem Willen zur Gestaltung. Es wird oftmals deutlich,
dass der Künstler auch des Gartens bedurfte, der im eigentlichen Sinne für
ihn zum Freiraum wurde.
Mit einem wachsenden Interesse in der Öffentlichkeit an überkomme-
nen Künstlerwohnstätten sowie allgemeiner Gartenkunst und denkmalge-
schützten Gärten entstand aktuell Handlungsbedarf, um nicht nur den
Objekten, sondern ebenso dem interessierten Besucher vor Ort gerecht
werden zu können. Mit der nun vorliegenden Publikation „Künstlergärten
und denkmalpflegerischer Umgang”, vorgelegt im Rahmen eines Sympo-
siums in der Kunststätte Bossard, soll einem erkennbaren Desiderat begeg-
net werden. Anhand verschiedener norddeutscher Künstlergärten des 19.
und 20. Jahrhunderts wird diese Facette der Gartenkunst gewürdigt, ihre
Besonderheit beispielhaft vorgestellt sowie spezifische Problematiken des