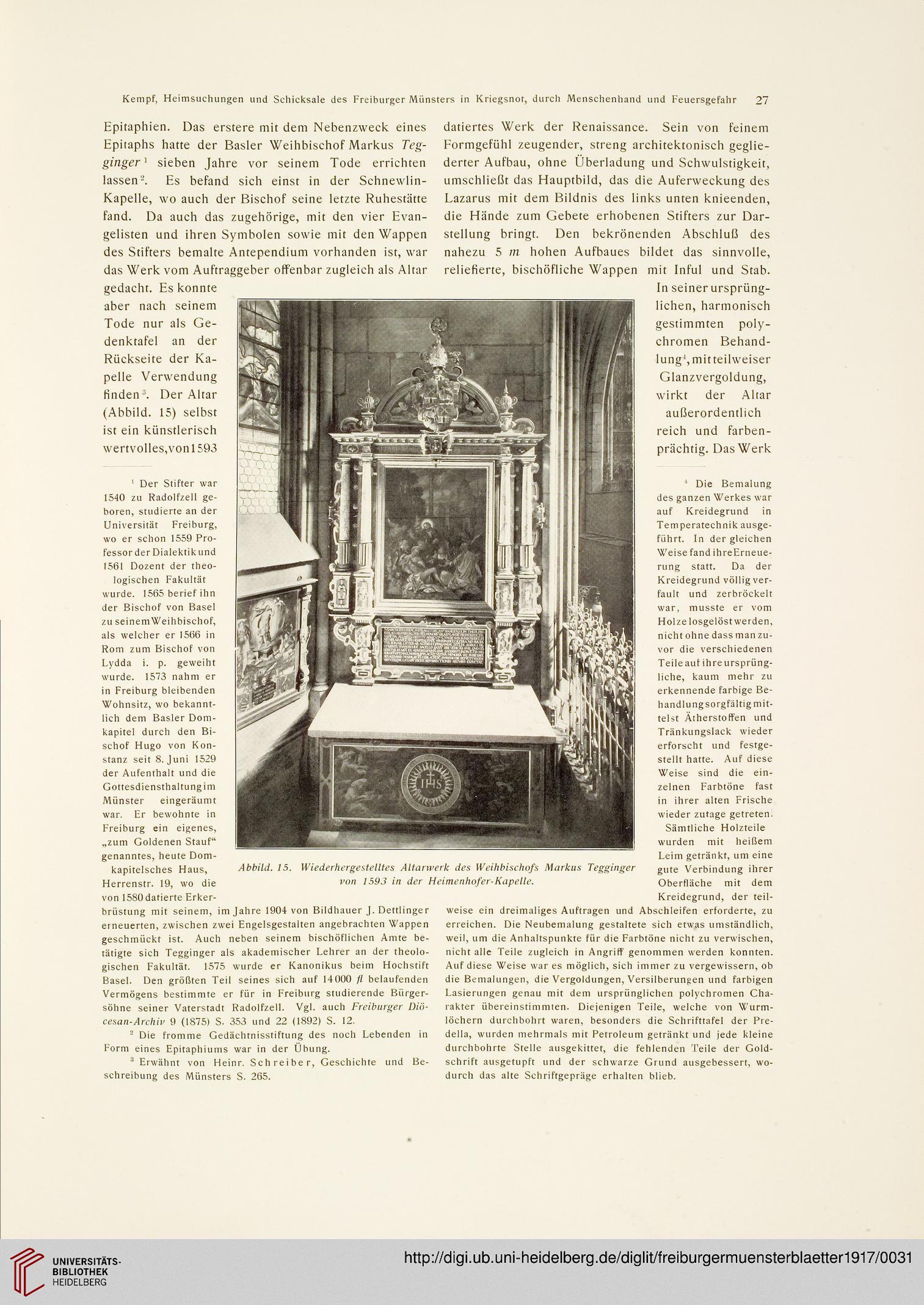Kempf, Heimsuchungen und Schicksale des Freiburger Münsters in Kriegsnot, durch Menschenhand und Feuersgefahr 27
Epitaphien. Das erstere mit dem Nebenzweck eines
Epitaphs hatte der Basler Weihbischof Markus Teg-
ginger1 sieben Jahre vor seinem Tode errichten
lassen2. Es befand sich einst in der Schnewlin-
Kapelle, wo auch der Bischof seine letzte Ruhestätte
fand. Da auch das zugehörige, mit den vier Evan-
gelisten und ihren Symbolen sowie mit den Wappen
des Stifters bemalte Antependium vorhanden ist, war
das Werk vom Auftraggeber offenbar zugleich als Altar
gedacht. Es konnte
aber nach seinem
Tode nur als Ge-
denktafel an der
Rückseite der Ka-
pelle Verwendung
finden3. Der Altar
(Abbild. 15) selbst
ist ein künstlerisch
wertvolles,vonl593
1 Der Stifter war
1540 zu Radolfzell ge-
boren, studierte an der
Universität Freiburg,
wo er schon 1559 Pro-
fessor der Dialektik und
1561 Dozent der theo-
logischen Fakultät
wurde. 1565 berief ihn
der Bischof von Basel
zu seinemWeihbischof,
als welcher er 1566 in
Rom zum Bischof von
Lydda i. p. geweiht
wurde. 1573 nahm er
in Freiburg bleibenden
Wohnsitz, wo bekannt-
lich dem Basler Dom-
kapitel durch den Bi-
schof Hugo von Kon-
stanz seit 8. Juni 1529
der Aufenthalt und die
Gottesdiensthaltung im
Münster eingeräumt
war. Er bewohnte in
Freiburg ein eigenes,
„zum Goldenen Stauf"
genanntes, heute Dom-
kapitelsches Haus,
Herrenstr. 19, wo die
von 1580 datierte Erker-
brüstung mit seinem, im Jahre 1904 von Bildhauer J. Dettlinger
erneuerten, zwischen zwei Engelsgestalten angebrachten Wappen
geschmückt ist. Auch neben seinem bischöflichen Amte be-
tätigte sich Tegginger als akademischer Lehrer an der theolo-
gischen Fakultät. 1575 wurde er Kanonikus beim Hochstift
Basel. Den größten Teil seines sich auf 14000 fl belaufenden
Vermögens bestimmte er für in Freibtirg studierende Biirger-
söhne seiner Vaterstadt Radolfzell. Vgl. auch Freiburger Diö-
cesan-Archiv 9 (1875) S. 353 und 22 (1892) S. 12.
2 Die fromme Gedächtnisstiftung des noch Lebenden in
Form eines Epitaphiums war in der Übung.
3 Erwähnt von Heinr. Schreiber, Geschichte und Be-
schreibung des Münsters S. 265.
Abbild. 15. Wiederhergestelltes Altarwerk des Weihbischofs Markus Tegginger
von 1593 in der Heimenhofer-Kapelle.
datiertes Werk der Renaissance. Sein von feinem
Formgefühl zeugender, streng architektonisch geglie-
derter Aufbau, ohne Überladung und Schwulstigkeit,
umschließt das Hauptbild, das die Auferweckung des
Lazarus mit dem Bildnis des links unten knieenden,
die Hände zum Gebete erhobenen Stifters zur Dar-
stellung bringt. Den bekrönenden Abschluß des
nahezu 5 m hohen Aufbaues bildet das sinnvolle,
reliefierte, bischöfliche Wappen mit Inful und Stab.
In seiner ursprüng-
lichen, harmonisch
gestimmten poly-
chromen Behand-
lung4,mitteilweiser
Glanzvergoldung,
wirkt der Altar
außerordentlich
reich und farben-
prächtig. Das Werk
1 Die Bemalung
des ganzen Werkes war
auf Kreidegrund in
Temperatechnik ausge-
führt. In der gleichen
Weise fand ihreErneue-
rung statt. Da der
Kreidegrund völlig ver-
fault und zerbröckelt
war, musste er vom
Holze losgelöst werden,
nicht ohne dass man zu-
vor die verschiedenen
Teile autihre ursprüng-
liche, kaum mehr zu
erkennende farbige Be-
handlungsorgfältig mit-
telst Ätherstoffen und
Tränkungslack wieder
erforscht und festge-
stellt hatte. Auf diese
Weise sind die ein-
zelnen Farbtöne fast
in ihrer alten Frische
wieder zutage getreten.
Sämtliche Holzteile
wurden mit heißem
Leim getränkt, um eine
gute Verbindung ihrer
Oberfläche mit dem
Kreidegrund, der teil-
weise ein dreimaliges Auftragen und Abschleifen erforderte, zu
erreichen. Die Neubemalung gestaltete sich etwas umständlich,
weil, um die Anhaltspunkte für die Farbtöne nicht zu verwischen,
nicht alle Teile zugleich in Angriff genommen werden konnten.
Auf diese Weise war es möglich, sich immer zu vergewissern, ob
die Bemalungen, die Vergoldungen, Versilberungen und farbigen
Lasierungen genau mit dem ursprünglichen polychromen Cha-
rakter übereinstimmten. Diejenigen Teile, welche von Wurm-
löchern durchbohrt waren, besonders die Schrifttafel der Pre-
della, wurden mehrmals mit Petroleum getränkt und jede kleine
durchbohrte Stelle ausgekittet, die fehlenden Teile der Gold-
schrift ausgetupft und der schwarze Grund ausgebessert, wo-
durch das alte Schriftgepräge erhalten blieb.
Epitaphien. Das erstere mit dem Nebenzweck eines
Epitaphs hatte der Basler Weihbischof Markus Teg-
ginger1 sieben Jahre vor seinem Tode errichten
lassen2. Es befand sich einst in der Schnewlin-
Kapelle, wo auch der Bischof seine letzte Ruhestätte
fand. Da auch das zugehörige, mit den vier Evan-
gelisten und ihren Symbolen sowie mit den Wappen
des Stifters bemalte Antependium vorhanden ist, war
das Werk vom Auftraggeber offenbar zugleich als Altar
gedacht. Es konnte
aber nach seinem
Tode nur als Ge-
denktafel an der
Rückseite der Ka-
pelle Verwendung
finden3. Der Altar
(Abbild. 15) selbst
ist ein künstlerisch
wertvolles,vonl593
1 Der Stifter war
1540 zu Radolfzell ge-
boren, studierte an der
Universität Freiburg,
wo er schon 1559 Pro-
fessor der Dialektik und
1561 Dozent der theo-
logischen Fakultät
wurde. 1565 berief ihn
der Bischof von Basel
zu seinemWeihbischof,
als welcher er 1566 in
Rom zum Bischof von
Lydda i. p. geweiht
wurde. 1573 nahm er
in Freiburg bleibenden
Wohnsitz, wo bekannt-
lich dem Basler Dom-
kapitel durch den Bi-
schof Hugo von Kon-
stanz seit 8. Juni 1529
der Aufenthalt und die
Gottesdiensthaltung im
Münster eingeräumt
war. Er bewohnte in
Freiburg ein eigenes,
„zum Goldenen Stauf"
genanntes, heute Dom-
kapitelsches Haus,
Herrenstr. 19, wo die
von 1580 datierte Erker-
brüstung mit seinem, im Jahre 1904 von Bildhauer J. Dettlinger
erneuerten, zwischen zwei Engelsgestalten angebrachten Wappen
geschmückt ist. Auch neben seinem bischöflichen Amte be-
tätigte sich Tegginger als akademischer Lehrer an der theolo-
gischen Fakultät. 1575 wurde er Kanonikus beim Hochstift
Basel. Den größten Teil seines sich auf 14000 fl belaufenden
Vermögens bestimmte er für in Freibtirg studierende Biirger-
söhne seiner Vaterstadt Radolfzell. Vgl. auch Freiburger Diö-
cesan-Archiv 9 (1875) S. 353 und 22 (1892) S. 12.
2 Die fromme Gedächtnisstiftung des noch Lebenden in
Form eines Epitaphiums war in der Übung.
3 Erwähnt von Heinr. Schreiber, Geschichte und Be-
schreibung des Münsters S. 265.
Abbild. 15. Wiederhergestelltes Altarwerk des Weihbischofs Markus Tegginger
von 1593 in der Heimenhofer-Kapelle.
datiertes Werk der Renaissance. Sein von feinem
Formgefühl zeugender, streng architektonisch geglie-
derter Aufbau, ohne Überladung und Schwulstigkeit,
umschließt das Hauptbild, das die Auferweckung des
Lazarus mit dem Bildnis des links unten knieenden,
die Hände zum Gebete erhobenen Stifters zur Dar-
stellung bringt. Den bekrönenden Abschluß des
nahezu 5 m hohen Aufbaues bildet das sinnvolle,
reliefierte, bischöfliche Wappen mit Inful und Stab.
In seiner ursprüng-
lichen, harmonisch
gestimmten poly-
chromen Behand-
lung4,mitteilweiser
Glanzvergoldung,
wirkt der Altar
außerordentlich
reich und farben-
prächtig. Das Werk
1 Die Bemalung
des ganzen Werkes war
auf Kreidegrund in
Temperatechnik ausge-
führt. In der gleichen
Weise fand ihreErneue-
rung statt. Da der
Kreidegrund völlig ver-
fault und zerbröckelt
war, musste er vom
Holze losgelöst werden,
nicht ohne dass man zu-
vor die verschiedenen
Teile autihre ursprüng-
liche, kaum mehr zu
erkennende farbige Be-
handlungsorgfältig mit-
telst Ätherstoffen und
Tränkungslack wieder
erforscht und festge-
stellt hatte. Auf diese
Weise sind die ein-
zelnen Farbtöne fast
in ihrer alten Frische
wieder zutage getreten.
Sämtliche Holzteile
wurden mit heißem
Leim getränkt, um eine
gute Verbindung ihrer
Oberfläche mit dem
Kreidegrund, der teil-
weise ein dreimaliges Auftragen und Abschleifen erforderte, zu
erreichen. Die Neubemalung gestaltete sich etwas umständlich,
weil, um die Anhaltspunkte für die Farbtöne nicht zu verwischen,
nicht alle Teile zugleich in Angriff genommen werden konnten.
Auf diese Weise war es möglich, sich immer zu vergewissern, ob
die Bemalungen, die Vergoldungen, Versilberungen und farbigen
Lasierungen genau mit dem ursprünglichen polychromen Cha-
rakter übereinstimmten. Diejenigen Teile, welche von Wurm-
löchern durchbohrt waren, besonders die Schrifttafel der Pre-
della, wurden mehrmals mit Petroleum getränkt und jede kleine
durchbohrte Stelle ausgekittet, die fehlenden Teile der Gold-
schrift ausgetupft und der schwarze Grund ausgebessert, wo-
durch das alte Schriftgepräge erhalten blieb.