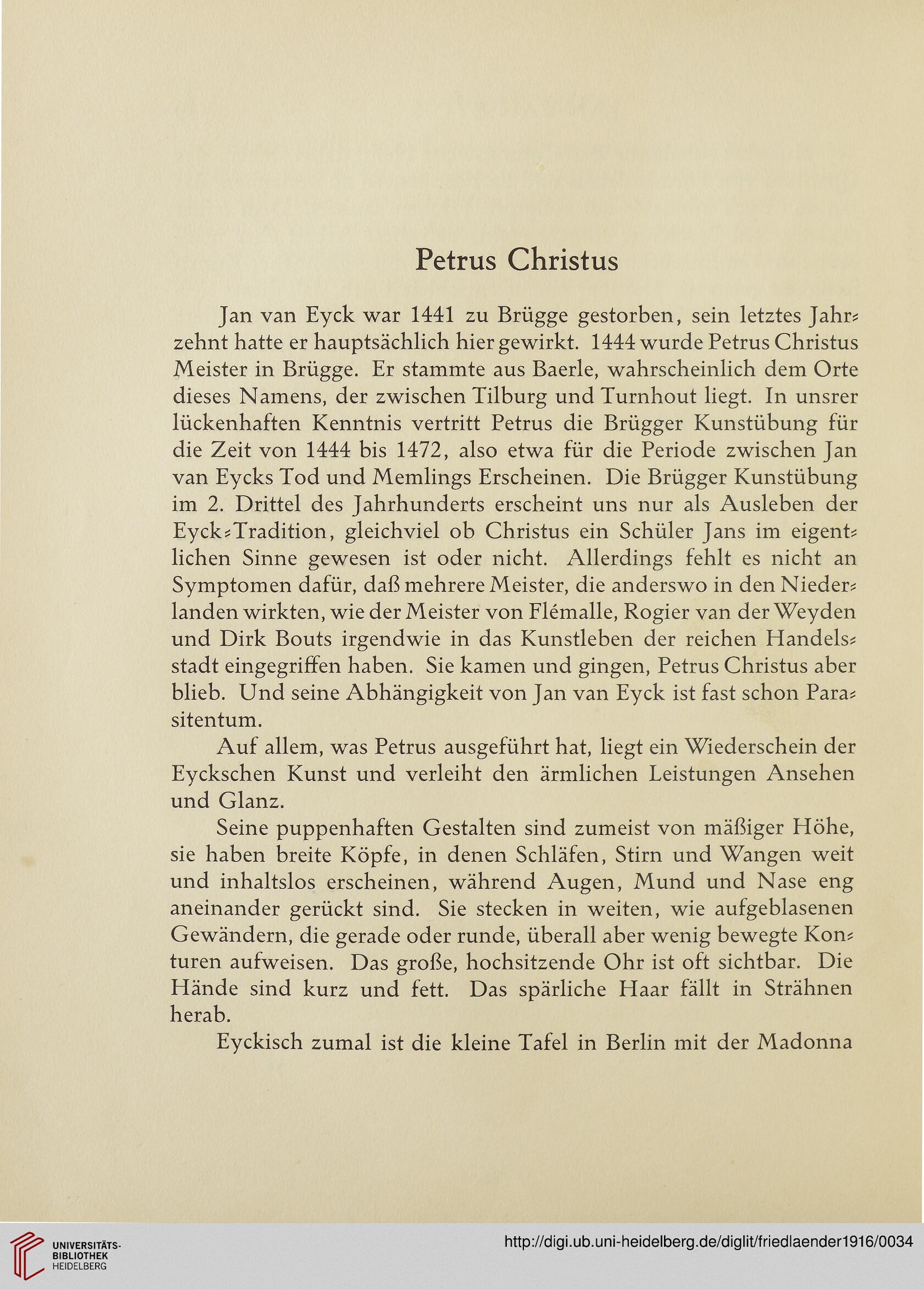Petrus Christus
Jan van Eyck war 1441 zu Brügge gestorben, sein letztes Jahr*
zehnt hatte er hauptsächlich hier gewirkt. 1444 wurde Petrus Christus
Meister in Brügge. Er stammte aus Baerle, wahrscheinlich dem Orte
dieses Namens, der zwischen Tilburg und Turnhout liegt. In unsrer
lückenhaften Kenntnis vertritt Petrus die Brügger Kunstübung für
die Zeit von 1444 bis 1472, also etwa für die Periode zwischen Jan
van Eycks Tod und Memlings Erscheinen. Die Brügger Kunstübung
im 2. Drittel des Jahrhunderts erscheint uns nur als Ausleben der
Eyck*Tradition, gleichviel ob Christus ein Schüler Jans im eigent*
liehen Sinne gewesen ist oder nicht. Allerdings fehlt es nicht an
Symptomen dafür, daß mehrere Meister, die anderswo in den Nieder*
landen wirkten, wie der Meister von Flemalle, Rogier van der Weyden
und Dirk Bouts irgendwie in das Kunstleben der reichen Handels*
stadt eingegriffen haben. Sie kamen und gingen, Petrus Christus aber
blieb. Und seine Abhängigkeit von Jan van Eyck ist fast schon Para*
sitentum.
Auf allem, was Petrus ausgeführt hat, liegt ein Wiederschein der
Eyckschen Kunst und verleiht den ärmlichen Leistungen Ansehen
und Glanz.
Seine puppenhaften Gestalten sind zumeist von mäßiger Höhe,
sie haben breite Köpfe, in denen Schläfen, Stirn und Wangen weit
und inhaltslos erscheinen, während Augen, Mund und Nase eng
aneinander gerückt sind. Sie stecken in weiten, wie aufgeblasenen
Gewändern, die gerade oder runde, überall aber wenig bewegte Kon*
turen aufweisen. Das große, hochsitzende Ohr ist oft sichtbar. Die
Hände sind kurz und fett. Das spärliche Haar fällt in Strähnen
herab.
Eyckisch zumal ist die kleine Tafel in Berlin mit der Madonna
Jan van Eyck war 1441 zu Brügge gestorben, sein letztes Jahr*
zehnt hatte er hauptsächlich hier gewirkt. 1444 wurde Petrus Christus
Meister in Brügge. Er stammte aus Baerle, wahrscheinlich dem Orte
dieses Namens, der zwischen Tilburg und Turnhout liegt. In unsrer
lückenhaften Kenntnis vertritt Petrus die Brügger Kunstübung für
die Zeit von 1444 bis 1472, also etwa für die Periode zwischen Jan
van Eycks Tod und Memlings Erscheinen. Die Brügger Kunstübung
im 2. Drittel des Jahrhunderts erscheint uns nur als Ausleben der
Eyck*Tradition, gleichviel ob Christus ein Schüler Jans im eigent*
liehen Sinne gewesen ist oder nicht. Allerdings fehlt es nicht an
Symptomen dafür, daß mehrere Meister, die anderswo in den Nieder*
landen wirkten, wie der Meister von Flemalle, Rogier van der Weyden
und Dirk Bouts irgendwie in das Kunstleben der reichen Handels*
stadt eingegriffen haben. Sie kamen und gingen, Petrus Christus aber
blieb. Und seine Abhängigkeit von Jan van Eyck ist fast schon Para*
sitentum.
Auf allem, was Petrus ausgeführt hat, liegt ein Wiederschein der
Eyckschen Kunst und verleiht den ärmlichen Leistungen Ansehen
und Glanz.
Seine puppenhaften Gestalten sind zumeist von mäßiger Höhe,
sie haben breite Köpfe, in denen Schläfen, Stirn und Wangen weit
und inhaltslos erscheinen, während Augen, Mund und Nase eng
aneinander gerückt sind. Sie stecken in weiten, wie aufgeblasenen
Gewändern, die gerade oder runde, überall aber wenig bewegte Kon*
turen aufweisen. Das große, hochsitzende Ohr ist oft sichtbar. Die
Hände sind kurz und fett. Das spärliche Haar fällt in Strähnen
herab.
Eyckisch zumal ist die kleine Tafel in Berlin mit der Madonna