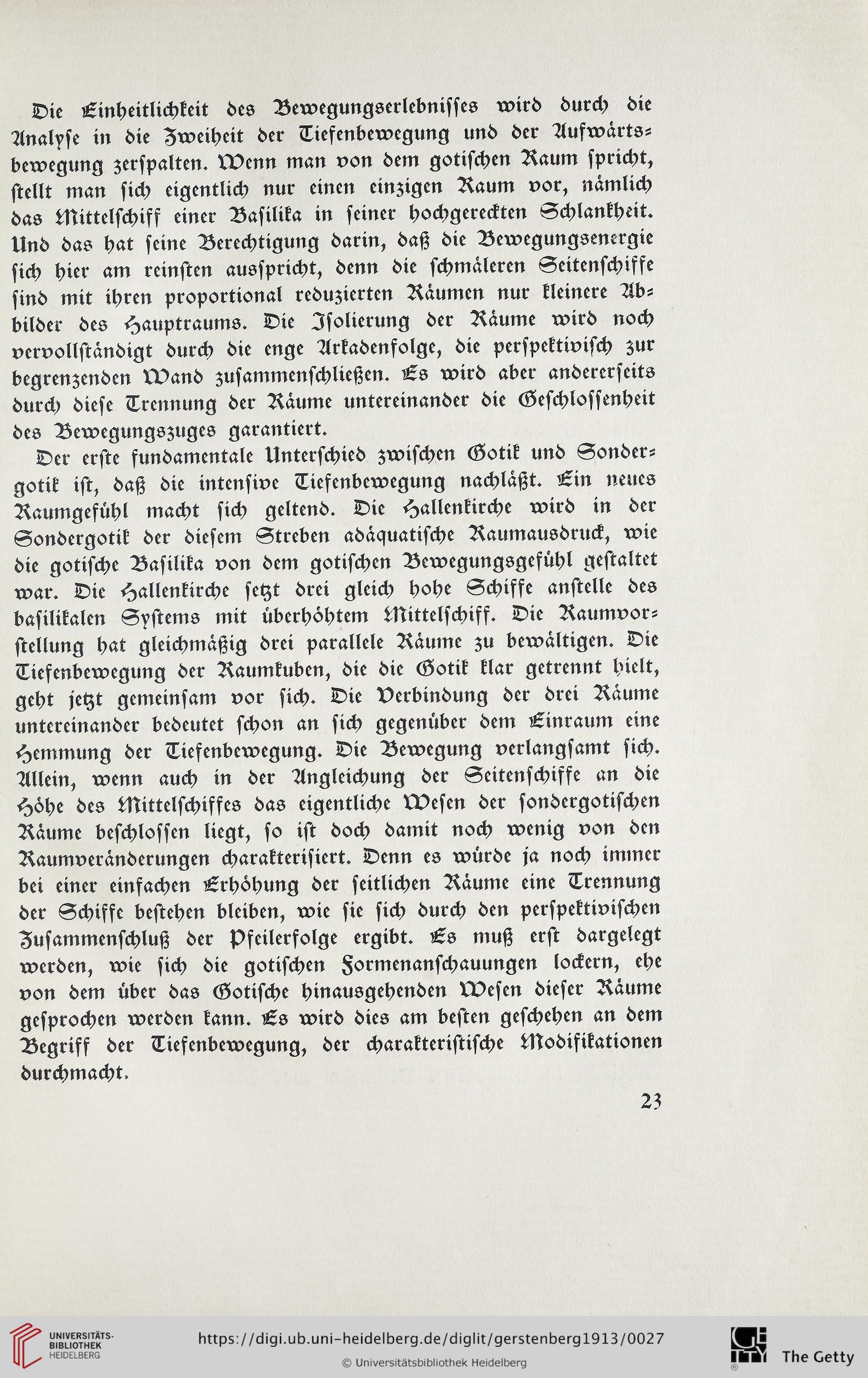Die Einheitlichkeit des Bewegungserlebnisses wird durch die
Analyse in die Zweiheit der Tiefenbewegung und der Aufwärts-
bewegung zerspalten. Wenn man von dem gotischen Raum spricht,
stellt man sich eigentlich nur einen einzigen Raum vor, nämlich
das Mittelschiff einer Basilika in seiner hochgereckten Schlankheit.
Und das hat seine Berechtigung darin, daß die Bewegungsenergie
sich hier am reinsten ausspricht, denn die schmäleren Seitenschiffe
sind mit ihren proportional reduzierten Räumen nur kleinere Ab-
bilder des Hauptraums. Die Isolierung der Räume wird noch
vervollständigt durch die enge Arkadenfolge, die perspektivisch zur
begrenzenden Wand zusammenschließen. Ls wird aber andererseits
durch diese Trennung der Räume untereinander die Geschlossenheit
des Bewegungszuges garantiert.
Der erste fundamentale Unterschied zwischen Gotik und Sonder-
gotik ist, daß die intensive Tiefenbewegung nachläßt. Lin neues
Raumgefühl macht sich geltend. Die Hallenkirche wird in der
Sondergotik der diesem Streben adäquatische Raumausdruck, wie
die gotische Basilika von dem gotischen Bewegungsgefühl gestaltet
war. Die Hallenkirche setzt drei gleich hohe Schiffe anstelle des
basilikalen Systems mit überhöhtem Mittelschiff. Die Raumvor-
stellung hat gleichmäßig drei parallele Räume zu bewältigen. Die
Tiefenbewegung der Raumkuben, die die Gotik klar getrennt hielt,
geht jetzt gemeinsam vor sich. Die Verbindung der drei Räume
untereinander bedeutet schon an sich gegenüber dem Einraum eine
Hemmung der Tiesenbewegung. Die Bewegung verlangsamt sich.
Allein, wenn auch in der Angleichung der Seitenschiffe an die
Höhe des Mittelschiffes das eigentliche Wesen der sondergotischen
Räume beschlossen liegt, so ist doch damit noch wenig von den
Raumveränderungen charakterisiert. Denn es würde ja noch immer
bei einer einfachen Erhöhung der seitlichen Räume eine Trennung
der Schiffe bestehen bleiben, wie sie sich durch den perspektivischen
Zusammenschluß der Pfeilerfolge ergibt. Es muß erst dargelegt
werden, wie sich die gotischen Formenanschauungen lockern, ehe
von dem über das Gotische hinausgehenden Wesen dieser Räume
gesprochen werden kann. Ls wird dies am besten geschehen an dem
Begriff der Tiefenbewegung, der charakteristische Modifikationen
durchmacht.
2Z
Analyse in die Zweiheit der Tiefenbewegung und der Aufwärts-
bewegung zerspalten. Wenn man von dem gotischen Raum spricht,
stellt man sich eigentlich nur einen einzigen Raum vor, nämlich
das Mittelschiff einer Basilika in seiner hochgereckten Schlankheit.
Und das hat seine Berechtigung darin, daß die Bewegungsenergie
sich hier am reinsten ausspricht, denn die schmäleren Seitenschiffe
sind mit ihren proportional reduzierten Räumen nur kleinere Ab-
bilder des Hauptraums. Die Isolierung der Räume wird noch
vervollständigt durch die enge Arkadenfolge, die perspektivisch zur
begrenzenden Wand zusammenschließen. Ls wird aber andererseits
durch diese Trennung der Räume untereinander die Geschlossenheit
des Bewegungszuges garantiert.
Der erste fundamentale Unterschied zwischen Gotik und Sonder-
gotik ist, daß die intensive Tiefenbewegung nachläßt. Lin neues
Raumgefühl macht sich geltend. Die Hallenkirche wird in der
Sondergotik der diesem Streben adäquatische Raumausdruck, wie
die gotische Basilika von dem gotischen Bewegungsgefühl gestaltet
war. Die Hallenkirche setzt drei gleich hohe Schiffe anstelle des
basilikalen Systems mit überhöhtem Mittelschiff. Die Raumvor-
stellung hat gleichmäßig drei parallele Räume zu bewältigen. Die
Tiefenbewegung der Raumkuben, die die Gotik klar getrennt hielt,
geht jetzt gemeinsam vor sich. Die Verbindung der drei Räume
untereinander bedeutet schon an sich gegenüber dem Einraum eine
Hemmung der Tiesenbewegung. Die Bewegung verlangsamt sich.
Allein, wenn auch in der Angleichung der Seitenschiffe an die
Höhe des Mittelschiffes das eigentliche Wesen der sondergotischen
Räume beschlossen liegt, so ist doch damit noch wenig von den
Raumveränderungen charakterisiert. Denn es würde ja noch immer
bei einer einfachen Erhöhung der seitlichen Räume eine Trennung
der Schiffe bestehen bleiben, wie sie sich durch den perspektivischen
Zusammenschluß der Pfeilerfolge ergibt. Es muß erst dargelegt
werden, wie sich die gotischen Formenanschauungen lockern, ehe
von dem über das Gotische hinausgehenden Wesen dieser Räume
gesprochen werden kann. Ls wird dies am besten geschehen an dem
Begriff der Tiefenbewegung, der charakteristische Modifikationen
durchmacht.
2Z