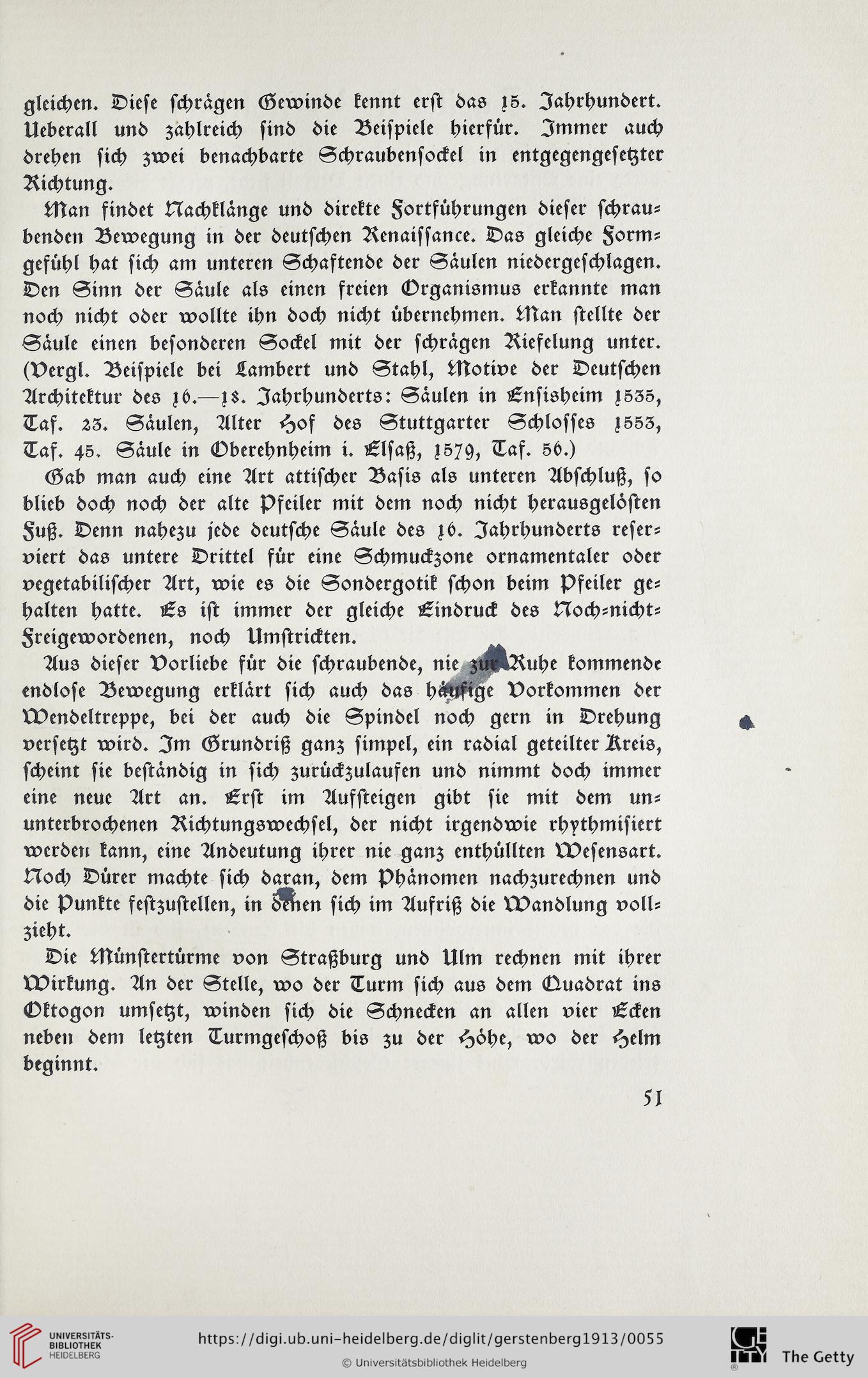gleichen. Diese schrägen Gewinde kennt erst das ;s. Jahrhundert.
Ueberall und zahlreich sind die Beispiele hierfür. Immer auch
drehen sich zwei benachbarte Schraubensockel in entgegengesetzter
Richtung.
Man findet Nachklänge und direkte Fortführungen dieser schrau-
benden Bewegung in der deutschen Renaissance. Das gleiche Form-
gefühl hat sich am unteren Schaftende der Säulen niedergeschlagen.
Den Sinn der Säule als einen freien Organismus erkannte man
noch nicht oder wollte ihn doch nicht übernehmen. Man stellte der
Säule einen besonderen Sockel mit der schrägen Riefelung unter.
(Vergl. Beispiele bei Lambert und Stahl, Motive der Deutschen
Architektur des )6.—Jahrhunderts: Säulen in Lnsisheim zsss,
Taf. 23. Säulen, Alter Hof des Stuttgarter Schlosses )333,
Taf. 4s. Säule in Oberehnheim i. Elsaß, )57tz, Taf. 5ö.)
Gab man auch eine Art attischer Basis als unteren Abschluß, so
blieb doch noch der alte Pfeiler mit dem noch nicht herausgelösten
Fuß. Denn nahezu jede deutsche Säule des ;b. Jahrhunderts reser-
viert das untere Drittel für eine Schmuckzone ornamentaler oder
vegetabilischer Art, wie es die Sondergotik schon beim Pfeiler ge-
halten hatte. Ls ist immer der gleiche Eindruck des Noch-nicht-
Freigewordenen, noch Umstrickten.
Aus dieser Vorliebe für die schraubende, nie zur^Ruhe kommende
endlose Bewegung erklärt sich auch das HHMge Vorkommen der
Wendeltreppe, bei der auch die Spindel noch gern in Drehung
versetzt wird. Im Grundriß ganz simpel, ein radial geteilter Rreis,
scheint sie beständig in sich zurückzulaufen und nimmt doch immer
eine neue Art an. Erst im Aufsteigen gibt sie mit dem un-
unterbrochenen Richtungswechsel, der nicht irgendwie rhythmisiert
werden kann, eine Andeutung ihrer nie ganz enthüllten Wesensart.
Noch Dürer machte sich daran, dem Phänomen nachzurechnen und
die Punkte festzustellen, in ÄRien sich im Aufriß die Wandlung voll-
zieht.
Die Münstertürme von Straßburg und Ulm rechnen mit ihrer
Wirkung. An der Stelle, wo der Turm sich aus dem Ouadrat ins
Oktogon umsetzt, winden sich die Schnecken an allen vier Ecken
neben dem letzten Turmgeschoß bis zu der Höhe, wo der Helm
beginnt.
51
4
Ueberall und zahlreich sind die Beispiele hierfür. Immer auch
drehen sich zwei benachbarte Schraubensockel in entgegengesetzter
Richtung.
Man findet Nachklänge und direkte Fortführungen dieser schrau-
benden Bewegung in der deutschen Renaissance. Das gleiche Form-
gefühl hat sich am unteren Schaftende der Säulen niedergeschlagen.
Den Sinn der Säule als einen freien Organismus erkannte man
noch nicht oder wollte ihn doch nicht übernehmen. Man stellte der
Säule einen besonderen Sockel mit der schrägen Riefelung unter.
(Vergl. Beispiele bei Lambert und Stahl, Motive der Deutschen
Architektur des )6.—Jahrhunderts: Säulen in Lnsisheim zsss,
Taf. 23. Säulen, Alter Hof des Stuttgarter Schlosses )333,
Taf. 4s. Säule in Oberehnheim i. Elsaß, )57tz, Taf. 5ö.)
Gab man auch eine Art attischer Basis als unteren Abschluß, so
blieb doch noch der alte Pfeiler mit dem noch nicht herausgelösten
Fuß. Denn nahezu jede deutsche Säule des ;b. Jahrhunderts reser-
viert das untere Drittel für eine Schmuckzone ornamentaler oder
vegetabilischer Art, wie es die Sondergotik schon beim Pfeiler ge-
halten hatte. Ls ist immer der gleiche Eindruck des Noch-nicht-
Freigewordenen, noch Umstrickten.
Aus dieser Vorliebe für die schraubende, nie zur^Ruhe kommende
endlose Bewegung erklärt sich auch das HHMge Vorkommen der
Wendeltreppe, bei der auch die Spindel noch gern in Drehung
versetzt wird. Im Grundriß ganz simpel, ein radial geteilter Rreis,
scheint sie beständig in sich zurückzulaufen und nimmt doch immer
eine neue Art an. Erst im Aufsteigen gibt sie mit dem un-
unterbrochenen Richtungswechsel, der nicht irgendwie rhythmisiert
werden kann, eine Andeutung ihrer nie ganz enthüllten Wesensart.
Noch Dürer machte sich daran, dem Phänomen nachzurechnen und
die Punkte festzustellen, in ÄRien sich im Aufriß die Wandlung voll-
zieht.
Die Münstertürme von Straßburg und Ulm rechnen mit ihrer
Wirkung. An der Stelle, wo der Turm sich aus dem Ouadrat ins
Oktogon umsetzt, winden sich die Schnecken an allen vier Ecken
neben dem letzten Turmgeschoß bis zu der Höhe, wo der Helm
beginnt.
51
4