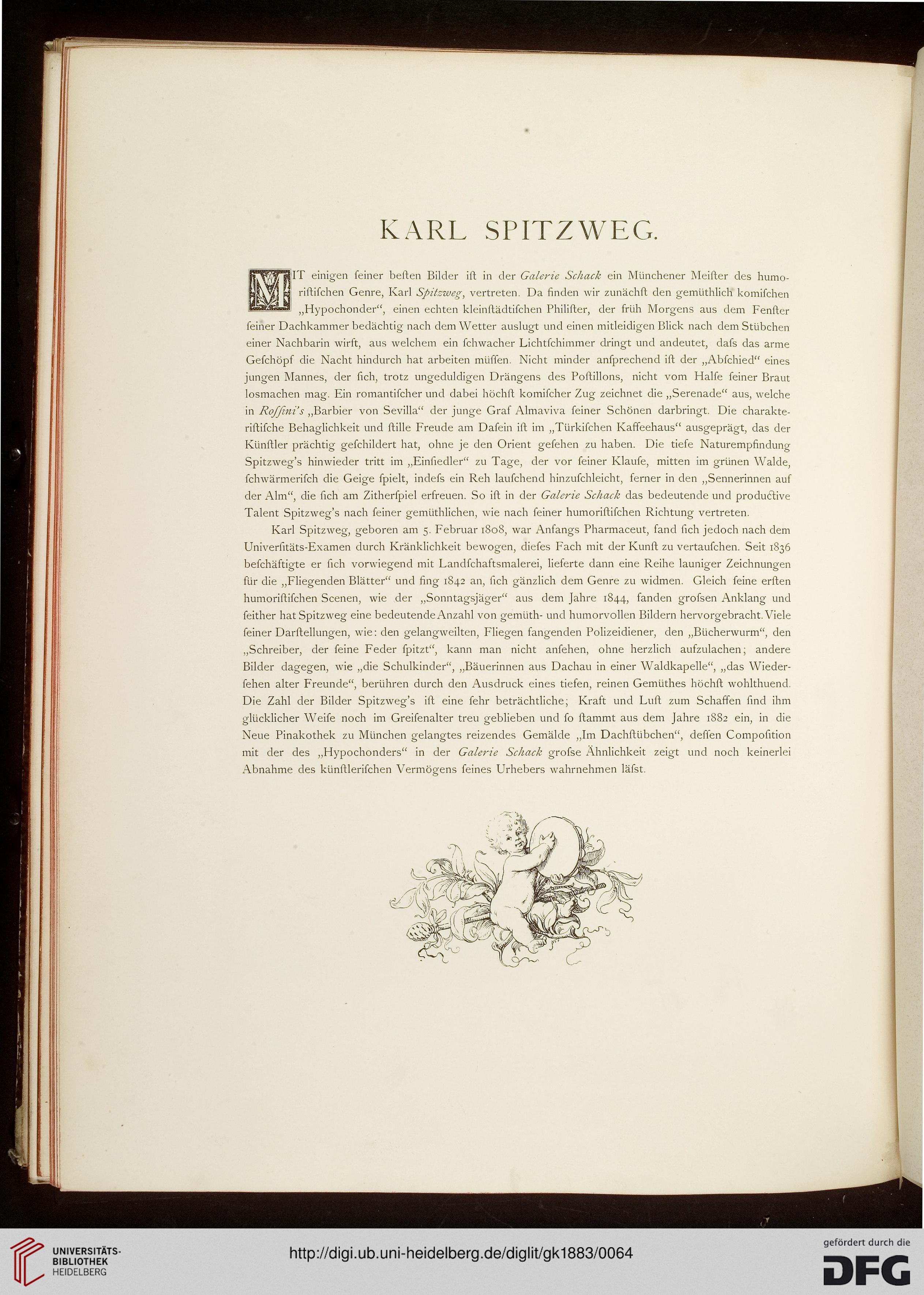KARL SPITZWEG.
IT einigen seiner besten Bilder ist in der Galerie Schuck ein Münchener Meister des humo-
ristischen Genre, Karl Spitzweg, vertreten. Da finden wir zunächst den gemüthlich komischen
„Hypochonder", einen echten kleinstädtischen Philister, der früh Morgens aus dem Fenster
seiner Dachkammer bedächtig nach dem Wetter auslugt und einen mitleidigen Blick nach dem Stübchen
einer Nachbarin wirft, aus welchem ein schwacher Lichtschimmer dringt und andeutet, dass das arme
Geschöpf die Nacht hindurch hat arbeiten musfen. Nicht minder ansprechend ist der „Abschied" eines
jungen Mannes, der sich, trotz ungeduldigen Drängens des Postillons, nicht vom Hälse seiner Braut
losmachen mag. Ein romantischer und dabei höchst komischer Zug zeichnet die „Serenade" aus, welche
in Rofsini's „Barbier von Sevilla" der junge Graf Almaviva seiner Schönen darbringt. Die charakte-
ristische Behaglichkeit und sülle Freude am Dasein ist im „Türkischen Kasfeehaus" ausgeprägt, das der
Künstler prächtig geschildert hat, ohne je den Orient gesehen zu haben. Die tiefe Naturempfindung
Spitzweg's hinwieder tritt im „Einsiedler" zu Tage, der vor seiner Klause, mitten im grünen Walde,
schwärmerisch die Geige spielt, indess ein Reh lauschend hinzuschleicht, ferner in den „Sennerinnen auf
der Alm", die sich am Zitherspiel erfreuen. So ist in der Galerie Schack das bedeutende und produktive
Talent Spitzweg's nach seiner gemüthlichen, wie nach seiner humoristischen Richtung vertreten.
Karl Spitzweg, geboren am 5. Februar 1808, war Anfangs Pharmaceut, fand sich jedoch nach dem
Universitäts-Examen durch Kränklichkeit bewogen, dieses Fach mit der Kunst zu vertauschen. Seit 1836
beschäftigte er sich vorwiegend mit Landschaftsmalerei, lieferte dann eine Reihe launiger Zeichnungen
für die „Fliegenden Blätter" und fing 1842 an, sich gänzlich dem Genre zu widmen. Gleich seine ersten
humoristischen Scenen, wie der „Sonntagsjäger" aus dem Jahre 1844, fanden grossen Anklang und
seither hat Spitzweg eine bedeutendeAnzahl von gemüth- und humorvollen Bildern hervorgebracht. Viele
seiner Darstelluneen, wie: den g-elano-weilten, Fliegen fangenden Polizeidiener, den „Bücherwurm", den
„Schreiber, der seine Feder spitzt", kann man nicht ansehen, ohne herzlich aufzulachen; andere
Bilder dagegen, wie „die Schulkinder", „Bäuerinnen aus Dachau in einer Waldkapelle", „das Wieder-
sehen alter Freunde", berühren durch den Ausdruck eines tiefen, reinen Gemüthes höchst wohlthuend.
Die Zahl der Bilder Spitzweg's ist eine sehr beträchtliche; Kraft und Lust zum Schasfen sind ihm
glücklicher Weise noch im Greisenalter treu geblieben und so slammt aus dem Jahre 1882 ein, in die
Neue Pinakothek zu München gelangtes reizendes Gemälde „Im Dachstübchen", dessen Composition
mit der des „Hypochonders" in der Galerie Schack grosse Ähnlichkeit zeigt und noch keinerlei
Abnahme des künstlerischen Vermöo-ens seines Urhebers wahrnehmen lässt.
IT einigen seiner besten Bilder ist in der Galerie Schuck ein Münchener Meister des humo-
ristischen Genre, Karl Spitzweg, vertreten. Da finden wir zunächst den gemüthlich komischen
„Hypochonder", einen echten kleinstädtischen Philister, der früh Morgens aus dem Fenster
seiner Dachkammer bedächtig nach dem Wetter auslugt und einen mitleidigen Blick nach dem Stübchen
einer Nachbarin wirft, aus welchem ein schwacher Lichtschimmer dringt und andeutet, dass das arme
Geschöpf die Nacht hindurch hat arbeiten musfen. Nicht minder ansprechend ist der „Abschied" eines
jungen Mannes, der sich, trotz ungeduldigen Drängens des Postillons, nicht vom Hälse seiner Braut
losmachen mag. Ein romantischer und dabei höchst komischer Zug zeichnet die „Serenade" aus, welche
in Rofsini's „Barbier von Sevilla" der junge Graf Almaviva seiner Schönen darbringt. Die charakte-
ristische Behaglichkeit und sülle Freude am Dasein ist im „Türkischen Kasfeehaus" ausgeprägt, das der
Künstler prächtig geschildert hat, ohne je den Orient gesehen zu haben. Die tiefe Naturempfindung
Spitzweg's hinwieder tritt im „Einsiedler" zu Tage, der vor seiner Klause, mitten im grünen Walde,
schwärmerisch die Geige spielt, indess ein Reh lauschend hinzuschleicht, ferner in den „Sennerinnen auf
der Alm", die sich am Zitherspiel erfreuen. So ist in der Galerie Schack das bedeutende und produktive
Talent Spitzweg's nach seiner gemüthlichen, wie nach seiner humoristischen Richtung vertreten.
Karl Spitzweg, geboren am 5. Februar 1808, war Anfangs Pharmaceut, fand sich jedoch nach dem
Universitäts-Examen durch Kränklichkeit bewogen, dieses Fach mit der Kunst zu vertauschen. Seit 1836
beschäftigte er sich vorwiegend mit Landschaftsmalerei, lieferte dann eine Reihe launiger Zeichnungen
für die „Fliegenden Blätter" und fing 1842 an, sich gänzlich dem Genre zu widmen. Gleich seine ersten
humoristischen Scenen, wie der „Sonntagsjäger" aus dem Jahre 1844, fanden grossen Anklang und
seither hat Spitzweg eine bedeutendeAnzahl von gemüth- und humorvollen Bildern hervorgebracht. Viele
seiner Darstelluneen, wie: den g-elano-weilten, Fliegen fangenden Polizeidiener, den „Bücherwurm", den
„Schreiber, der seine Feder spitzt", kann man nicht ansehen, ohne herzlich aufzulachen; andere
Bilder dagegen, wie „die Schulkinder", „Bäuerinnen aus Dachau in einer Waldkapelle", „das Wieder-
sehen alter Freunde", berühren durch den Ausdruck eines tiefen, reinen Gemüthes höchst wohlthuend.
Die Zahl der Bilder Spitzweg's ist eine sehr beträchtliche; Kraft und Lust zum Schasfen sind ihm
glücklicher Weise noch im Greisenalter treu geblieben und so slammt aus dem Jahre 1882 ein, in die
Neue Pinakothek zu München gelangtes reizendes Gemälde „Im Dachstübchen", dessen Composition
mit der des „Hypochonders" in der Galerie Schack grosse Ähnlichkeit zeigt und noch keinerlei
Abnahme des künstlerischen Vermöo-ens seines Urhebers wahrnehmen lässt.