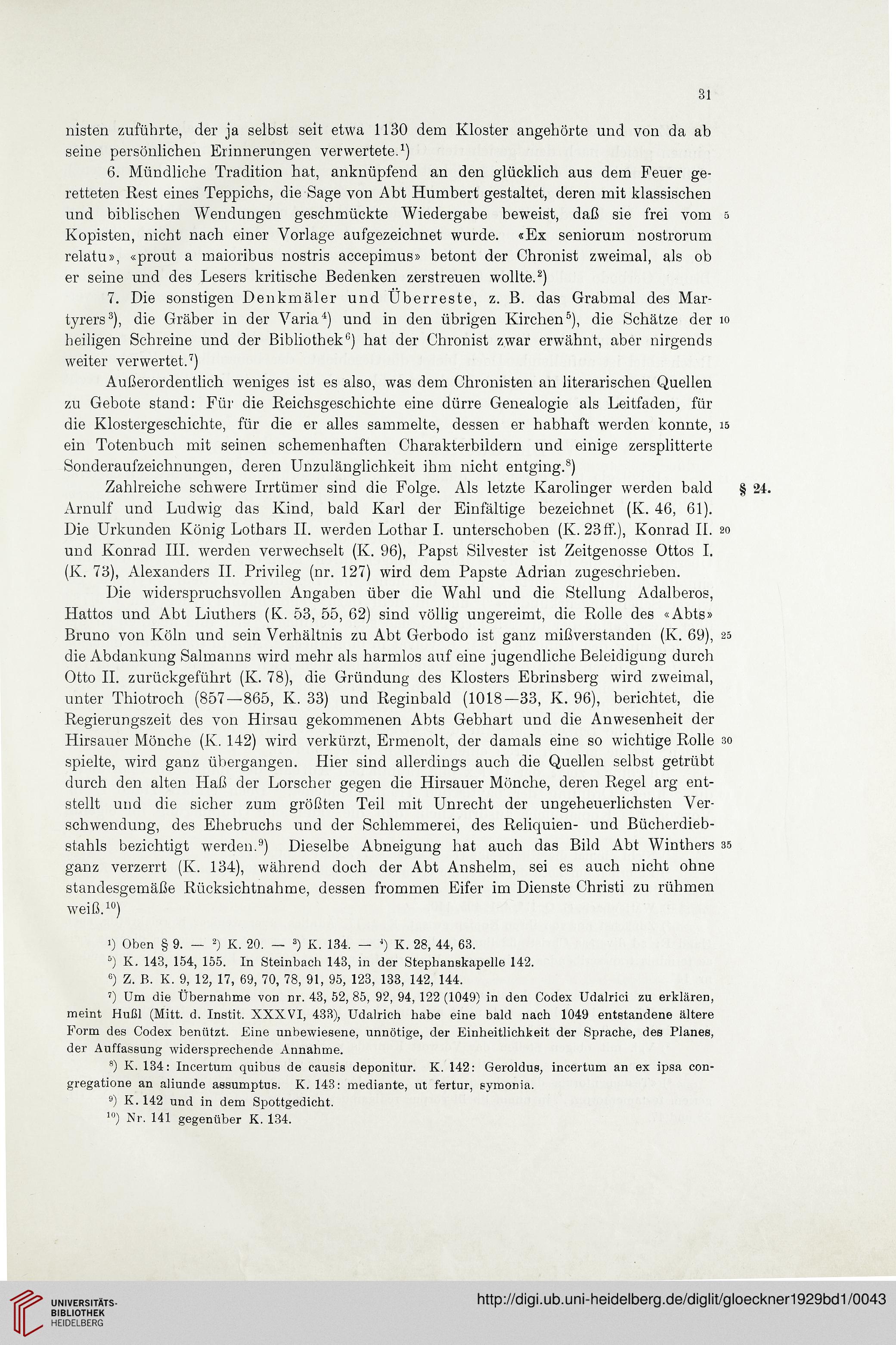31
nisten zuführte, der ja selbst seit etwa 1130 dem Kloster angehörte und von da ab
seine persönlichen Erinnerungen verwertete.1)
6. Mündliche Tradition hat, anknüpfend an den glücklich aus dem Feuer ge-
retteten Rest eines Teppichs, die Sage von Abt Humbert gestaltet, deren mit klassischen
und biblischen Wendungen geschmückte Wiedergabe beweist, daß sie frei vom 5
Kopisten, nicht nach einer Vorlage aufgezeichnet wurde. «Ex seniorum nostrorum
relatu», «prout a maioribus nostris accepimus» betont der Chronist zweimal, als ob
er seine und des Lesers kritische Bedenken zerstreuen wollte.2)
7. Die sonstigen Denkmäler und Uberreste, z. B. das Grabmal des Mär-
tyrers3), die Gräber in der Varia4) und in den übrigen Kirchen5), die Schätze der io
heiligen Schreine und der Bibliothek6) hat der Chronist zwar erwähnt, aber nirgends
weiter verwertet.7)
Außerordentlich weniges ist es also, was dem Chronisten an literarischen Quellen
zu Gebote stand: Für die Reichsgeschichte eine dürre Genealogie als Leitfaden, für
die Klostergeschichte, für die er alles sammelte, dessen er habhaft werden konnte, 15
ein Totenbuch mit seinen schemenhaften Charakterbildern und einige zersplitterte
Sonderaufzeichnungen, deren Unzulänglichkeit ihm nicht entging.8)
Zahlreiche schwere Irrtümer sind die Folge. Als letzte Karolinger werden bald § 24.
Arnulf und Ludwig das Kind, bald Karl der Einfältige bezeichnet (K. 46, 61).
Die Urkunden König Lothars II. werden Lothar I. unterschoben (K. 23 ff.), Konrad II. 20
und Konrad III. werden verwechselt (K. 96), Papst Silvester ist Zeitgenosse Ottos I.
(K. 73), Alexanders II. Privileg (nr. 127) wird dem Papste Adrian zugeschrieben.
Die widerspruchsvollen Angaben über die Wahl und die Stellung Adalberos,
Hattos und Abt Liuthers (K. 53, 55, 62) sind völlig ungereimt, die Rolle des «Abts»
Bruno von Köln und sein Verhältnis zu Abt Gerbodo ist ganz mißverstanden (K. 69), 25
die Abdankung Salmanns wird mehr als harmlos auf eine jugendliche Beleidigung durch
Otto II. zurückgeführt (K. 78), die Gründung des Klosters Ebrinsberg wird zweimal,
unter Thiotroch (857—865, K. 33) und Reginbald (1018—33, K. 96), berichtet, die
Regierungszeit des von Hirsau gekommenen Abts Gebhart und die Anwesenheit der
Hirsauer Mönche (K. 142) wird verkürzt, Ermenolt, der damals eine so wichtige Rolle so
spielte, wird ganz übergangen. Hier sind allerdings auch die Quellen selbst getrübt
durch den alten Haß der Lorscher gegen die Hirsauer Mönche, deren Regel arg ent-
stellt und die sicher zum größten Teil mit Unrecht der ungeheuerlichsten Ver-
schwendung, des Ehebruchs und der Schlemmerei, des Reliquien- und Bücherdieb-
stahls bezichtigt werden.9) Dieselbe Abneigung hat auch das Bild Abt Winthers 35
ganz verzerrt (K. 134), während doch der Abt Anshelm, sei es auch nicht ohne
standesgemäße Rücksichtnahme, dessen frommen Eifer im Dienste Christi zu rühmen
weiß.10)
1) Oben § 9. — 2) K. 20. — 3) K. 134. — 4) K. 28, 44, 63.
5) K. 143, 154, 155. In Steinbach 143, in der Stephanskapelle 142.
e) Z. B. K. 9, 12, 17, 69, 70, 78, 91, 95, 123, 133, 142, 144.
7) Um die Übernahme von nr. 43, 52, 85, 92, 94, 122 (1049) in den Codex Udalrici zu erklären,
meint Hußl (Mitt. d. Instit. XXXVI, 433), Udalrich habe eine bald nach 1049 entstandene ältere
Form des Codex benützt. Eine unbewiesene, unnötige, der Einheitlichkeit der Sprache, des Planes,
der Auffassung widersprechende Annahme.
8) K. 134: Incertum quibus de caueis deponitur. K. 142: Geroldus, incertum an ex ipsa con-
gregatione an aliunde aesumptus. K. 143: mediante, ut fertur, eymonia.
9) K. 142 und in dem Spottgedicht.
10) Nr. 141 gegenüber K. 134.
nisten zuführte, der ja selbst seit etwa 1130 dem Kloster angehörte und von da ab
seine persönlichen Erinnerungen verwertete.1)
6. Mündliche Tradition hat, anknüpfend an den glücklich aus dem Feuer ge-
retteten Rest eines Teppichs, die Sage von Abt Humbert gestaltet, deren mit klassischen
und biblischen Wendungen geschmückte Wiedergabe beweist, daß sie frei vom 5
Kopisten, nicht nach einer Vorlage aufgezeichnet wurde. «Ex seniorum nostrorum
relatu», «prout a maioribus nostris accepimus» betont der Chronist zweimal, als ob
er seine und des Lesers kritische Bedenken zerstreuen wollte.2)
7. Die sonstigen Denkmäler und Uberreste, z. B. das Grabmal des Mär-
tyrers3), die Gräber in der Varia4) und in den übrigen Kirchen5), die Schätze der io
heiligen Schreine und der Bibliothek6) hat der Chronist zwar erwähnt, aber nirgends
weiter verwertet.7)
Außerordentlich weniges ist es also, was dem Chronisten an literarischen Quellen
zu Gebote stand: Für die Reichsgeschichte eine dürre Genealogie als Leitfaden, für
die Klostergeschichte, für die er alles sammelte, dessen er habhaft werden konnte, 15
ein Totenbuch mit seinen schemenhaften Charakterbildern und einige zersplitterte
Sonderaufzeichnungen, deren Unzulänglichkeit ihm nicht entging.8)
Zahlreiche schwere Irrtümer sind die Folge. Als letzte Karolinger werden bald § 24.
Arnulf und Ludwig das Kind, bald Karl der Einfältige bezeichnet (K. 46, 61).
Die Urkunden König Lothars II. werden Lothar I. unterschoben (K. 23 ff.), Konrad II. 20
und Konrad III. werden verwechselt (K. 96), Papst Silvester ist Zeitgenosse Ottos I.
(K. 73), Alexanders II. Privileg (nr. 127) wird dem Papste Adrian zugeschrieben.
Die widerspruchsvollen Angaben über die Wahl und die Stellung Adalberos,
Hattos und Abt Liuthers (K. 53, 55, 62) sind völlig ungereimt, die Rolle des «Abts»
Bruno von Köln und sein Verhältnis zu Abt Gerbodo ist ganz mißverstanden (K. 69), 25
die Abdankung Salmanns wird mehr als harmlos auf eine jugendliche Beleidigung durch
Otto II. zurückgeführt (K. 78), die Gründung des Klosters Ebrinsberg wird zweimal,
unter Thiotroch (857—865, K. 33) und Reginbald (1018—33, K. 96), berichtet, die
Regierungszeit des von Hirsau gekommenen Abts Gebhart und die Anwesenheit der
Hirsauer Mönche (K. 142) wird verkürzt, Ermenolt, der damals eine so wichtige Rolle so
spielte, wird ganz übergangen. Hier sind allerdings auch die Quellen selbst getrübt
durch den alten Haß der Lorscher gegen die Hirsauer Mönche, deren Regel arg ent-
stellt und die sicher zum größten Teil mit Unrecht der ungeheuerlichsten Ver-
schwendung, des Ehebruchs und der Schlemmerei, des Reliquien- und Bücherdieb-
stahls bezichtigt werden.9) Dieselbe Abneigung hat auch das Bild Abt Winthers 35
ganz verzerrt (K. 134), während doch der Abt Anshelm, sei es auch nicht ohne
standesgemäße Rücksichtnahme, dessen frommen Eifer im Dienste Christi zu rühmen
weiß.10)
1) Oben § 9. — 2) K. 20. — 3) K. 134. — 4) K. 28, 44, 63.
5) K. 143, 154, 155. In Steinbach 143, in der Stephanskapelle 142.
e) Z. B. K. 9, 12, 17, 69, 70, 78, 91, 95, 123, 133, 142, 144.
7) Um die Übernahme von nr. 43, 52, 85, 92, 94, 122 (1049) in den Codex Udalrici zu erklären,
meint Hußl (Mitt. d. Instit. XXXVI, 433), Udalrich habe eine bald nach 1049 entstandene ältere
Form des Codex benützt. Eine unbewiesene, unnötige, der Einheitlichkeit der Sprache, des Planes,
der Auffassung widersprechende Annahme.
8) K. 134: Incertum quibus de caueis deponitur. K. 142: Geroldus, incertum an ex ipsa con-
gregatione an aliunde aesumptus. K. 143: mediante, ut fertur, eymonia.
9) K. 142 und in dem Spottgedicht.
10) Nr. 141 gegenüber K. 134.