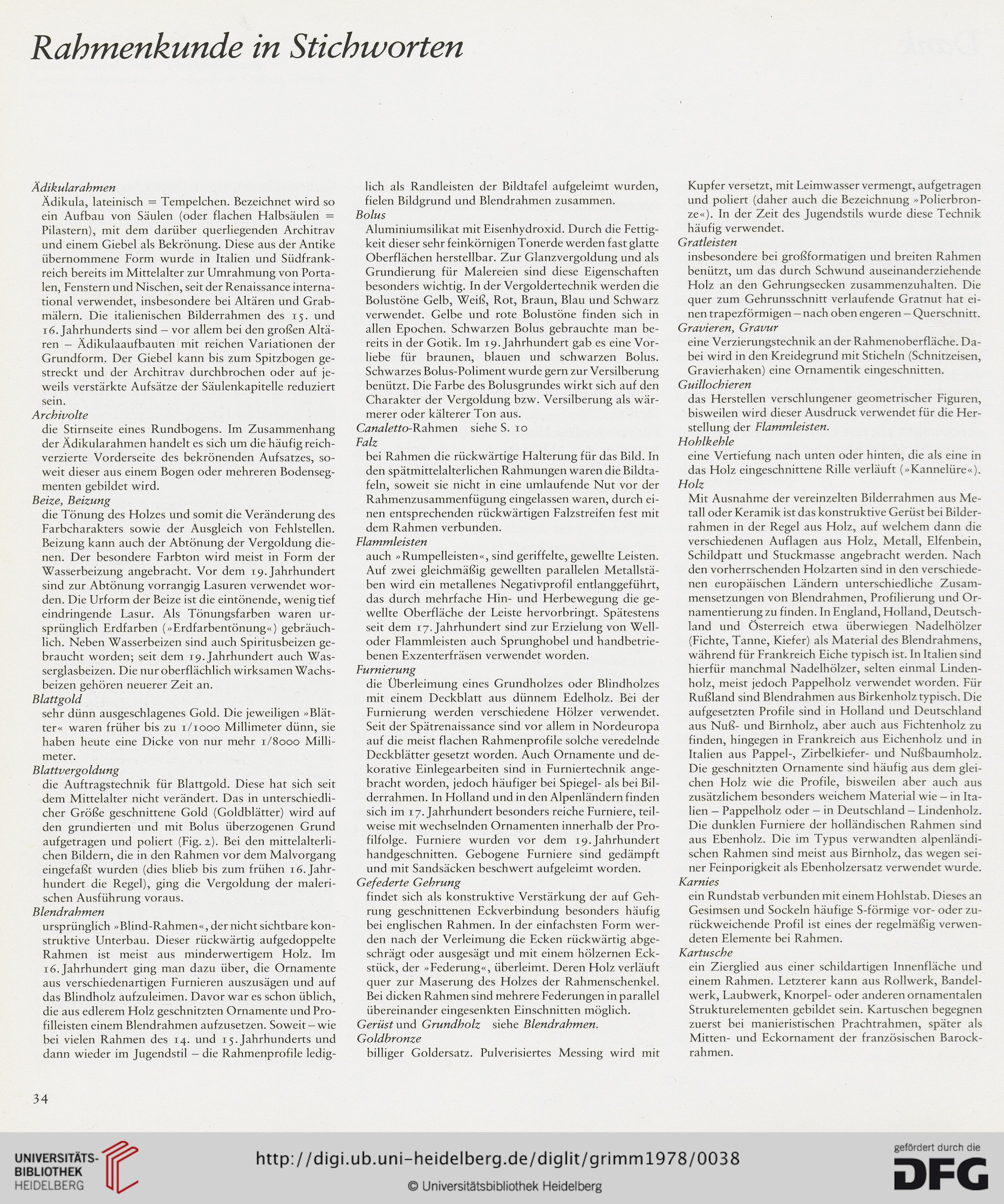Rabmenkunde in Sticbworten
Ädikularahmen
Ädikula, lateinisch = Tempelchen. Bezeichnet wird so
ein Aufbau von Säulen (oder flachen Halbsäulen -
Pilastern), mit dem darüber querliegenden Architrav
und einem Giebel als Bekrönung. Diese aus der Antike
übernommene Form wurde in Italien und Südfrank-
reich bereits im Mittelalter zur Umrahmung von Porta-
len, Fenstern und Nischen, seit der Renaissance interna-
tional verwendet, insbesondere bei Altären und Grab-
mälern. Die italienischen Bilderrahmen des 15. und
16. Jahrhunderts sind — vor allem bei den großen Altä-
ren - Ädikulaaufbauten mit reichen Variationen der
Grundform. Der Giebel kann bis zum Spitzbogen ge-
streckt und der Architrav durchbrochen oder auf je-
weils verstärkte Aufsätze der Säulenkapitelle reduziert
sein.
Archivolte
die Stirnseite eines Rundbogens. Im Zusammenhang
der Ädikularahmen handelt es sich um die häufig reich-
verzierte Vorderseite des bekrönenden Aufsatzes, so-
weit dieser aus einem Bogen oder mehreren Bodenseg-
menten gebildet wird.
Beize, Beizung
die Tönung des Holzes und somit die Veränderung des
Farbcharakters sowie der Ausgleich von Fehlstellen.
Beizung kann auch der Abtönung der Vergoldung die-
nen. Der besondere Farbton wird meist in Form der
Wasserbeizung angebracht. Vor dem 19. Jahrhundert
sind zur Abtönung vorrangig Lasuren verwendet wor-
den. Die Urform der Beize ist die eintönende, wenig tief
eindringende Lasur. Als Tönungsfarben waren ur-
sprünglich Erdfarben (»Erdfarbentönung«) gebräuch-
lich. Neben Wasserbeizen sind auch Spiritusbeizen ge-
braucht worden; seit dem 19. Jahrhundert auch Was-
serglasbeizen. Die nur oberflächlich wirksamen Wachs-
beizen gehören neuerer Zeit an.
Blattgold
sehr dünn ausgeschlagenes Gold. Die jeweiligen »Blät-
ter« waren früher bis zu 1/1000 Millimeter dünn, sie
haben heute eine Dicke von nur mehr 1/8000 Milli-
meter.
Blattvergoldung
die Auftragstechnik für Blattgold. Diese hat sich seit
dem Mittelalter nicht verändert. Das in unterschiedli-
cher Größe geschnittene Gold (Goldblätter) wird auf
den grundierten und mit Bolus überzogenen Grund
aufgetragen und poliert (Fig. z). Bei den mittelalterli-
chen Bildern, die in den Rahmen vor dem Malvorgang
eingefaßt wurden (dies blieb bis zum friihen 16. Jahr-
hundert die Regel), ging die Vergoldung der maleri-
schen Ausführung voraus.
Blendrahmen
ursprünglich »Blind-Rahmen«, der nicht sichtbare kon-
struktive Unterbau. Dieser rückwärtig aufgedoppelte
Rahmen ist meist aus minderwertigem Holz. Im
16. Jahrhundert ging man dazu über, die Ornamente
aus verschiedenartigen Furnieren auszusägen und auf
das Blindholz aufzuleimen. Davor war es schon üblich,
die aus edlerem Holz geschnitzten Ornamente und Pro-
filleisten einem Blendrahmen aufzusetzen. Soweit —wie
bei vielen Rahmen des 14. und 15. Jahrhunderts und
dann wieder im Jugendstil — die Rahmenprofile ledig-
lich als Randleisten der Bildtafel aufgeleimt wurden,
fielen Bildgrund und Blendrahmen zusammen.
Bolus
Aluminiumsilikat mit Eisenhydroxid. Durch die Fetdg-
keit dieser sehr feinkörnigen Tonerde werden fast glatte
Oberflächen herstellbar. Zur Glanzvergoldung und als
Grundierung für Malereien sind diese Eigenschaften
besonders wichtig. In der Vergoldertechnik werden die
Bolustöne Gelb, Weiß, Rot, Braun, Blau und Schwarz
verwendet. Gelbe und rote Bolustöne finden sich in
allen Epochen. Schwarzen Bolus gebrauchte man be-
reits in der Gotik. Im 19. Jahrhundert gab es eine Vor-
liebe für braunen, blauen und schwarzen Bolus.
Schwarzes Bolus-Poliment wurde gern zur Versilberung
benützt. Die Farbe des Bolusgrundes wirkt sich auf den
Charakter der Vergoldung bzw. Versilberung als wär-
merer oder kälterer Ton aus.
Canaletto-Rahmen siehe S. 10
Falz
bei Rahmen die rückwärtige Halterung für das Bild. In
den spätmittelalterlichen Rahmungen warendieBildta-
feln, soweit sie nicht in eine umlaufende Nut vor der
Rahmenzusammenfügung eingelassen waren, durch ei-
nen entsprechenden rückwärtigen Falzstreifen fest mit
dem Rahmen verbunden.
Flammleisten
auch »Rumpelleisten«, sind geriffelte, gewellte Leisten.
Auf zwei gleichmäßig gewellten parallelen Metallstä-
ben wird ein metallenes Negativprofil entlanggeführt,
das durch mehrfache Hin- und Herbewegung die ge-
wellte Oberfläche der Leiste hervorbringt. Spätestens
seit dem 17. Jahrhundert sind zur Erzielung von Well-
oder Flammleisten auch Sprunghobel und handbetrie-
benen Exzenterfräsen verwendet worden.
Furnierung
die Überleimung eines Grundholzes oder Blindholzes
mit einem Deckblatt aus dünnem Edelholz. Bei der
Furnierung werden verschiedene Hölzer verwendet.
Seit der Spätrenaissance sind vor allem in Nordeuropa
auf die meist flachen Rahmenprofile solche veredelnde
Deckblätter gesetzt worden. Auch Ornamente und de-
korative Einlegearbeiten sind in Furniertechnik ange-
bracht worden, jedoch häufiger bei Spiegel- als bei Bil-
derrahmen. In Holland und in den Alpenländern finden
sich im 17. Jahrhundert besonders reiche Furniere, teil-
weise mit wechselnden Ornamenten innerhalb der Pro-
filfolge. Furniere wurden vor dem 19.Jahrhundert
handgeschnitten. Gebogene Furniere sind gedämpft
und mit Sandsäcken beschwert aufgeleimt worden.
Gefederte Gehrung
findet sich als konstruktive Verstärkung der auf Geh-
rung geschnittenen Eckverbindung besonders häufig
bei englischen Rahmen. In der einfachsten Form wer-
den nach der Verleimung die Ecken rückwärtig abge-
schrägt oder ausgesägt und mit einem hölzernen Eck-
stück, der »Federung«, überleimt. Deren Holzverläuft
quer zur Maserung des Holzes der Rahmenschenkel.
Bei dicken Rahmen sind mehrere Federungen in parallel
übereinander eingesenkten Einschnitten möglich.
Gerüst und Grundholz siehe Blendrahmen.
Goldbronze
billiger Goldersatz. Pulverisiertes Messing wird mit
Kupfer versetzt, mit Leimwasser vermengt, aufgetragen
und poliert (daher auch die Bezeichnung »Polierbron-
ze«). In der Zeit des Jugendstils wurde diese Technik
häufig verwendet.
Gratleisten
insbesondere bei großformatigen und breiten Rahmen
benützt, um das durch Schwund auseinanderziehende
Holz an den Gehrungsecken zusammenzuhalten. Die
quer zum Gehrunsschnitt verlaufende Gratnut hat ei-
nen trapezförmigen — nach oben engeren — Querschnitt.
Gravieren, Gravur
eine Verzierungstechnik an der Rahmenoberfläche. Da-
bei wird in den Kreidegrund mit Sticheln (Schnitzeisen,
Gravierhaken) eine Ornamentik eingeschnitten.
Guillochieren
das Herstellen verschlungener geometrischer Figuren,
bisweilen wird dieser Ausdruck verwendet für die Her-
stellung der Flammleisten.
Flohlkehle
eine Vertiefung nach unten oder hinten, die als eine in
das Holz eingeschnittene Rille verläuft (»Kannelüre«).
Holz
Mit Ausnahme der vereinzelten Bilderrahmen aus Me-
tall oder Keramik ist das konstruktive Gerüst bei Bilder-
rahmen in der Regel aus Holz, auf welchem dann die
verschiedenen Auflagen aus Holz, Metall, Elfenbein,
Schildpatt und Stuckmasse angebracht werden. Nach
den vorherrschenden Holzarten sind in den verschiede-
nen europäischen Ländern unterschiedliche Zusam-
mensetzungen von Blendrahmen, Profilierung und Or-
namentierung zu finden. In England, Holland, Deutsch-
land und österreich etwa überwiegen Nadelhölzer
(Fichte, Tanne, Kiefer) als Material des Blendrahmens,
während für Frankreich Eiche typisch ist. In Italien sind
hierfür manchmal Nadelhölzer, selten einmal Linden-
holz, meist jedoch Pappelholz verwendet worden. Für
Rußland sind Blendrahmen aus Birkenholz typisch. Die
aufgesetzten Profile sind in Holland und Deutschland
aus Nuß- und Birnholz, aber auch aus Fichtenholz zu
finden, hingegen in Frankreich aus Eichenholz und in
Italien aus Pappel-, Zirbelkiefer- und Nußbaumholz.
Die geschnitzten Ornamente sind häufig aus dem glei-
chen Holz wie die Profile, bisweilen aber auch aus
zusätzlichem besonders weichem Material wie — in Ita-
lien — Pappelholz oder - in Deutschland — Lindenholz.
Die dunklen Furniere der holländischen Rahmen sind
aus Ebenholz. Die im Typus verwandten alpenländi-
schen Rahmen sind meist aus Birnholz, das wegen sei-
ner Feinporigkeit als Ebenholzersatz verwendet wurde.
Karnies
ein Rundstab verbunden mit einem Hohlstab. Dieses an
Gesimsen und Sockeln häufige S-förmige vor- oder zu-
rückweichende Profil ist eines der regelmäßig verwen-
deten Elemente bei Rahmen.
Kartusche
ein Zierglied aus einer schildartigen Innenfläche und
einem Rahmen. Letzterer kann aus Rollwerk, Bandel-
werk, Laubwerk, Knorpel- oder anderen ornamentalen
Strukturelementen gebildet sein. Kartuschen begegnen
zuerst bei manieristischen Prachtrahmen, später als
Mitten- und Eckornament der französischen Barock-
rahmen.
34
Ädikularahmen
Ädikula, lateinisch = Tempelchen. Bezeichnet wird so
ein Aufbau von Säulen (oder flachen Halbsäulen -
Pilastern), mit dem darüber querliegenden Architrav
und einem Giebel als Bekrönung. Diese aus der Antike
übernommene Form wurde in Italien und Südfrank-
reich bereits im Mittelalter zur Umrahmung von Porta-
len, Fenstern und Nischen, seit der Renaissance interna-
tional verwendet, insbesondere bei Altären und Grab-
mälern. Die italienischen Bilderrahmen des 15. und
16. Jahrhunderts sind — vor allem bei den großen Altä-
ren - Ädikulaaufbauten mit reichen Variationen der
Grundform. Der Giebel kann bis zum Spitzbogen ge-
streckt und der Architrav durchbrochen oder auf je-
weils verstärkte Aufsätze der Säulenkapitelle reduziert
sein.
Archivolte
die Stirnseite eines Rundbogens. Im Zusammenhang
der Ädikularahmen handelt es sich um die häufig reich-
verzierte Vorderseite des bekrönenden Aufsatzes, so-
weit dieser aus einem Bogen oder mehreren Bodenseg-
menten gebildet wird.
Beize, Beizung
die Tönung des Holzes und somit die Veränderung des
Farbcharakters sowie der Ausgleich von Fehlstellen.
Beizung kann auch der Abtönung der Vergoldung die-
nen. Der besondere Farbton wird meist in Form der
Wasserbeizung angebracht. Vor dem 19. Jahrhundert
sind zur Abtönung vorrangig Lasuren verwendet wor-
den. Die Urform der Beize ist die eintönende, wenig tief
eindringende Lasur. Als Tönungsfarben waren ur-
sprünglich Erdfarben (»Erdfarbentönung«) gebräuch-
lich. Neben Wasserbeizen sind auch Spiritusbeizen ge-
braucht worden; seit dem 19. Jahrhundert auch Was-
serglasbeizen. Die nur oberflächlich wirksamen Wachs-
beizen gehören neuerer Zeit an.
Blattgold
sehr dünn ausgeschlagenes Gold. Die jeweiligen »Blät-
ter« waren früher bis zu 1/1000 Millimeter dünn, sie
haben heute eine Dicke von nur mehr 1/8000 Milli-
meter.
Blattvergoldung
die Auftragstechnik für Blattgold. Diese hat sich seit
dem Mittelalter nicht verändert. Das in unterschiedli-
cher Größe geschnittene Gold (Goldblätter) wird auf
den grundierten und mit Bolus überzogenen Grund
aufgetragen und poliert (Fig. z). Bei den mittelalterli-
chen Bildern, die in den Rahmen vor dem Malvorgang
eingefaßt wurden (dies blieb bis zum friihen 16. Jahr-
hundert die Regel), ging die Vergoldung der maleri-
schen Ausführung voraus.
Blendrahmen
ursprünglich »Blind-Rahmen«, der nicht sichtbare kon-
struktive Unterbau. Dieser rückwärtig aufgedoppelte
Rahmen ist meist aus minderwertigem Holz. Im
16. Jahrhundert ging man dazu über, die Ornamente
aus verschiedenartigen Furnieren auszusägen und auf
das Blindholz aufzuleimen. Davor war es schon üblich,
die aus edlerem Holz geschnitzten Ornamente und Pro-
filleisten einem Blendrahmen aufzusetzen. Soweit —wie
bei vielen Rahmen des 14. und 15. Jahrhunderts und
dann wieder im Jugendstil — die Rahmenprofile ledig-
lich als Randleisten der Bildtafel aufgeleimt wurden,
fielen Bildgrund und Blendrahmen zusammen.
Bolus
Aluminiumsilikat mit Eisenhydroxid. Durch die Fetdg-
keit dieser sehr feinkörnigen Tonerde werden fast glatte
Oberflächen herstellbar. Zur Glanzvergoldung und als
Grundierung für Malereien sind diese Eigenschaften
besonders wichtig. In der Vergoldertechnik werden die
Bolustöne Gelb, Weiß, Rot, Braun, Blau und Schwarz
verwendet. Gelbe und rote Bolustöne finden sich in
allen Epochen. Schwarzen Bolus gebrauchte man be-
reits in der Gotik. Im 19. Jahrhundert gab es eine Vor-
liebe für braunen, blauen und schwarzen Bolus.
Schwarzes Bolus-Poliment wurde gern zur Versilberung
benützt. Die Farbe des Bolusgrundes wirkt sich auf den
Charakter der Vergoldung bzw. Versilberung als wär-
merer oder kälterer Ton aus.
Canaletto-Rahmen siehe S. 10
Falz
bei Rahmen die rückwärtige Halterung für das Bild. In
den spätmittelalterlichen Rahmungen warendieBildta-
feln, soweit sie nicht in eine umlaufende Nut vor der
Rahmenzusammenfügung eingelassen waren, durch ei-
nen entsprechenden rückwärtigen Falzstreifen fest mit
dem Rahmen verbunden.
Flammleisten
auch »Rumpelleisten«, sind geriffelte, gewellte Leisten.
Auf zwei gleichmäßig gewellten parallelen Metallstä-
ben wird ein metallenes Negativprofil entlanggeführt,
das durch mehrfache Hin- und Herbewegung die ge-
wellte Oberfläche der Leiste hervorbringt. Spätestens
seit dem 17. Jahrhundert sind zur Erzielung von Well-
oder Flammleisten auch Sprunghobel und handbetrie-
benen Exzenterfräsen verwendet worden.
Furnierung
die Überleimung eines Grundholzes oder Blindholzes
mit einem Deckblatt aus dünnem Edelholz. Bei der
Furnierung werden verschiedene Hölzer verwendet.
Seit der Spätrenaissance sind vor allem in Nordeuropa
auf die meist flachen Rahmenprofile solche veredelnde
Deckblätter gesetzt worden. Auch Ornamente und de-
korative Einlegearbeiten sind in Furniertechnik ange-
bracht worden, jedoch häufiger bei Spiegel- als bei Bil-
derrahmen. In Holland und in den Alpenländern finden
sich im 17. Jahrhundert besonders reiche Furniere, teil-
weise mit wechselnden Ornamenten innerhalb der Pro-
filfolge. Furniere wurden vor dem 19.Jahrhundert
handgeschnitten. Gebogene Furniere sind gedämpft
und mit Sandsäcken beschwert aufgeleimt worden.
Gefederte Gehrung
findet sich als konstruktive Verstärkung der auf Geh-
rung geschnittenen Eckverbindung besonders häufig
bei englischen Rahmen. In der einfachsten Form wer-
den nach der Verleimung die Ecken rückwärtig abge-
schrägt oder ausgesägt und mit einem hölzernen Eck-
stück, der »Federung«, überleimt. Deren Holzverläuft
quer zur Maserung des Holzes der Rahmenschenkel.
Bei dicken Rahmen sind mehrere Federungen in parallel
übereinander eingesenkten Einschnitten möglich.
Gerüst und Grundholz siehe Blendrahmen.
Goldbronze
billiger Goldersatz. Pulverisiertes Messing wird mit
Kupfer versetzt, mit Leimwasser vermengt, aufgetragen
und poliert (daher auch die Bezeichnung »Polierbron-
ze«). In der Zeit des Jugendstils wurde diese Technik
häufig verwendet.
Gratleisten
insbesondere bei großformatigen und breiten Rahmen
benützt, um das durch Schwund auseinanderziehende
Holz an den Gehrungsecken zusammenzuhalten. Die
quer zum Gehrunsschnitt verlaufende Gratnut hat ei-
nen trapezförmigen — nach oben engeren — Querschnitt.
Gravieren, Gravur
eine Verzierungstechnik an der Rahmenoberfläche. Da-
bei wird in den Kreidegrund mit Sticheln (Schnitzeisen,
Gravierhaken) eine Ornamentik eingeschnitten.
Guillochieren
das Herstellen verschlungener geometrischer Figuren,
bisweilen wird dieser Ausdruck verwendet für die Her-
stellung der Flammleisten.
Flohlkehle
eine Vertiefung nach unten oder hinten, die als eine in
das Holz eingeschnittene Rille verläuft (»Kannelüre«).
Holz
Mit Ausnahme der vereinzelten Bilderrahmen aus Me-
tall oder Keramik ist das konstruktive Gerüst bei Bilder-
rahmen in der Regel aus Holz, auf welchem dann die
verschiedenen Auflagen aus Holz, Metall, Elfenbein,
Schildpatt und Stuckmasse angebracht werden. Nach
den vorherrschenden Holzarten sind in den verschiede-
nen europäischen Ländern unterschiedliche Zusam-
mensetzungen von Blendrahmen, Profilierung und Or-
namentierung zu finden. In England, Holland, Deutsch-
land und österreich etwa überwiegen Nadelhölzer
(Fichte, Tanne, Kiefer) als Material des Blendrahmens,
während für Frankreich Eiche typisch ist. In Italien sind
hierfür manchmal Nadelhölzer, selten einmal Linden-
holz, meist jedoch Pappelholz verwendet worden. Für
Rußland sind Blendrahmen aus Birkenholz typisch. Die
aufgesetzten Profile sind in Holland und Deutschland
aus Nuß- und Birnholz, aber auch aus Fichtenholz zu
finden, hingegen in Frankreich aus Eichenholz und in
Italien aus Pappel-, Zirbelkiefer- und Nußbaumholz.
Die geschnitzten Ornamente sind häufig aus dem glei-
chen Holz wie die Profile, bisweilen aber auch aus
zusätzlichem besonders weichem Material wie — in Ita-
lien — Pappelholz oder - in Deutschland — Lindenholz.
Die dunklen Furniere der holländischen Rahmen sind
aus Ebenholz. Die im Typus verwandten alpenländi-
schen Rahmen sind meist aus Birnholz, das wegen sei-
ner Feinporigkeit als Ebenholzersatz verwendet wurde.
Karnies
ein Rundstab verbunden mit einem Hohlstab. Dieses an
Gesimsen und Sockeln häufige S-förmige vor- oder zu-
rückweichende Profil ist eines der regelmäßig verwen-
deten Elemente bei Rahmen.
Kartusche
ein Zierglied aus einer schildartigen Innenfläche und
einem Rahmen. Letzterer kann aus Rollwerk, Bandel-
werk, Laubwerk, Knorpel- oder anderen ornamentalen
Strukturelementen gebildet sein. Kartuschen begegnen
zuerst bei manieristischen Prachtrahmen, später als
Mitten- und Eckornament der französischen Barock-
rahmen.
34