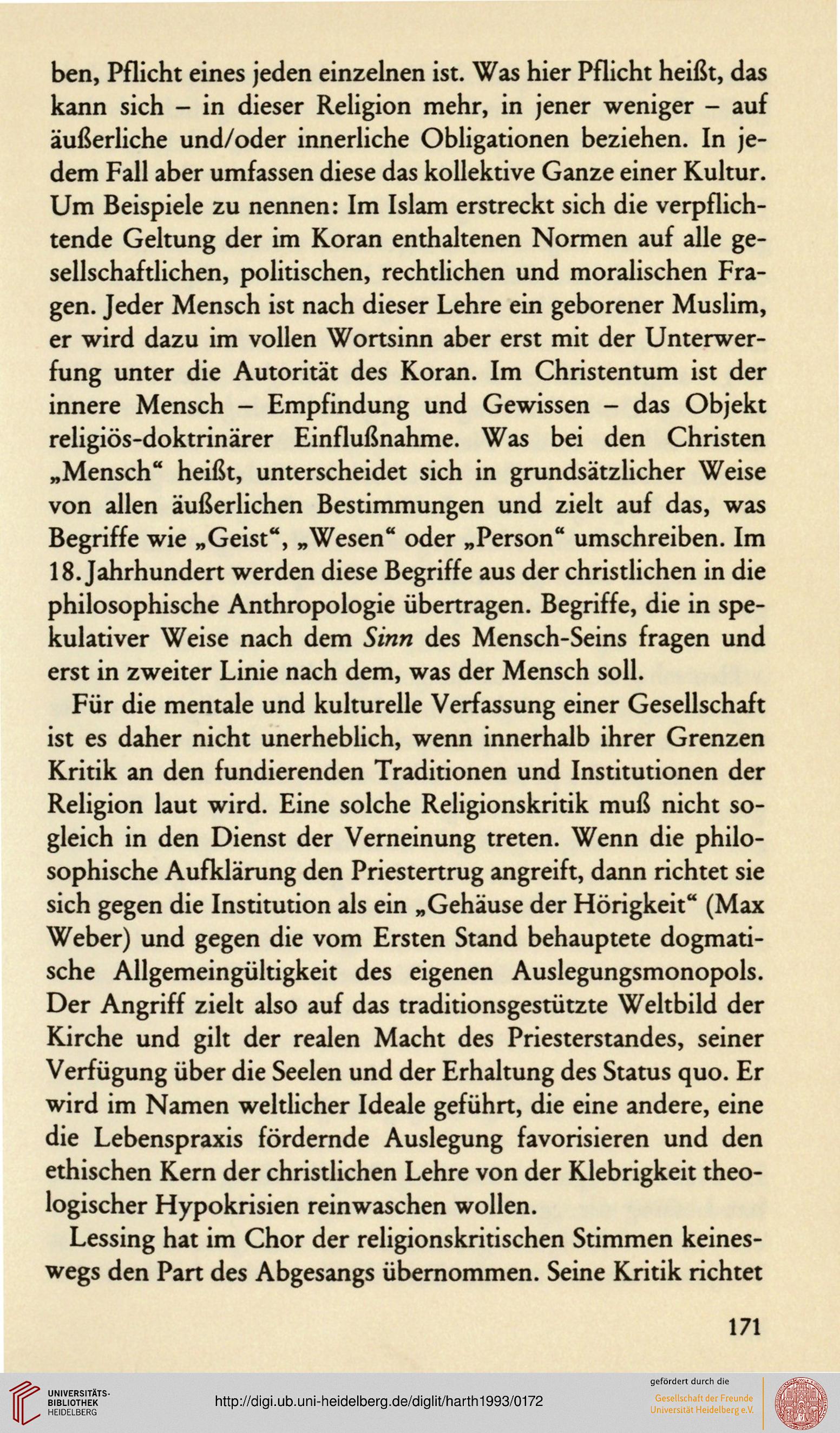ben, Pflicht eines jeden einzelnen ist. Was hier Pflicht heißt, das
kann sich - in dieser Religion mehr, in jener weniger - auf
äußerliche und/oder innerliche Obligationen beziehen. In je-
dem Fall aber umfassen diese das kollektive Ganze einer Kultur.
Um Beispiele zu nennen: Im Islam erstreckt sich die verpflich-
tende Geltung der im Koran enthaltenen Normen auf alle ge-
sellschaftlichen, politischen, rechtlichen und moralischen Fra-
gen. Jeder Mensch ist nach dieser Lehre ein geborener Muslim,
er wird dazu im vollen Wortsinn aber erst mit der Unterwer-
fung unter die Autorität des Koran. Im Christentum ist der
innere Mensch - Empfindung und Gewissen - das Objekt
religiös-doktrinärer Einflußnahme. Was bei den Christen
„Mensch" heißt, unterscheidet sich in grundsätzlicher Weise
von allen äußerlichen Bestimmungen und zielt auf das, was
Begriffe wie „Geist", „Wesen" oder „Person" umschreiben. Im
18. Jahrhundert werden diese Begriffe aus der christlichen in die
philosophische Anthropologie übertragen. Begriffe, die in spe-
kulativer Weise nach dem Sinn des Mensch-Seins fragen und
erst in zweiter Linie nach dem, was der Mensch soll.
Für die mentale und kulturelle Verfassung einer Gesellschaft
ist es daher nicht unerheblich, wenn innerhalb ihrer Grenzen
Kritik an den fundierenden Traditionen und Institutionen der
Religion laut wird. Eine solche Religionskritik muß nicht so-
gleich in den Dienst der Verneinung treten. Wenn die philo-
sophische Aufklärung den Priestertrug angreift, dann richtet sie
sich gegen die Institution als ein „Gehäuse der Hörigkeit" (Max
Weber) und gegen die vom Ersten Stand behauptete dogmati-
sche Allgemeingültigkeit des eigenen Auslegungsmonopols.
Der Angriff zielt also auf das traditionsgestützte Weltbild der
Kirche und gilt der realen Macht des Priesterstandes, seiner
Verfügung über die Seelen und der Erhaltung des Status quo. Er
wird im Namen weltlicher Ideale geführt, die eine andere, eine
die Lebenspraxis fördernde Auslegung favorisieren und den
ethischen Kern der christlichen Lehre von der Klebrigkeit theo-
logischer Hypokrisien reinwaschen wollen.
Lessing hat im Chor der religionskritischen Stimmen keines-
wegs den Part des Abgesangs übernommen. Seine Kritik richtet
171
kann sich - in dieser Religion mehr, in jener weniger - auf
äußerliche und/oder innerliche Obligationen beziehen. In je-
dem Fall aber umfassen diese das kollektive Ganze einer Kultur.
Um Beispiele zu nennen: Im Islam erstreckt sich die verpflich-
tende Geltung der im Koran enthaltenen Normen auf alle ge-
sellschaftlichen, politischen, rechtlichen und moralischen Fra-
gen. Jeder Mensch ist nach dieser Lehre ein geborener Muslim,
er wird dazu im vollen Wortsinn aber erst mit der Unterwer-
fung unter die Autorität des Koran. Im Christentum ist der
innere Mensch - Empfindung und Gewissen - das Objekt
religiös-doktrinärer Einflußnahme. Was bei den Christen
„Mensch" heißt, unterscheidet sich in grundsätzlicher Weise
von allen äußerlichen Bestimmungen und zielt auf das, was
Begriffe wie „Geist", „Wesen" oder „Person" umschreiben. Im
18. Jahrhundert werden diese Begriffe aus der christlichen in die
philosophische Anthropologie übertragen. Begriffe, die in spe-
kulativer Weise nach dem Sinn des Mensch-Seins fragen und
erst in zweiter Linie nach dem, was der Mensch soll.
Für die mentale und kulturelle Verfassung einer Gesellschaft
ist es daher nicht unerheblich, wenn innerhalb ihrer Grenzen
Kritik an den fundierenden Traditionen und Institutionen der
Religion laut wird. Eine solche Religionskritik muß nicht so-
gleich in den Dienst der Verneinung treten. Wenn die philo-
sophische Aufklärung den Priestertrug angreift, dann richtet sie
sich gegen die Institution als ein „Gehäuse der Hörigkeit" (Max
Weber) und gegen die vom Ersten Stand behauptete dogmati-
sche Allgemeingültigkeit des eigenen Auslegungsmonopols.
Der Angriff zielt also auf das traditionsgestützte Weltbild der
Kirche und gilt der realen Macht des Priesterstandes, seiner
Verfügung über die Seelen und der Erhaltung des Status quo. Er
wird im Namen weltlicher Ideale geführt, die eine andere, eine
die Lebenspraxis fördernde Auslegung favorisieren und den
ethischen Kern der christlichen Lehre von der Klebrigkeit theo-
logischer Hypokrisien reinwaschen wollen.
Lessing hat im Chor der religionskritischen Stimmen keines-
wegs den Part des Abgesangs übernommen. Seine Kritik richtet
171