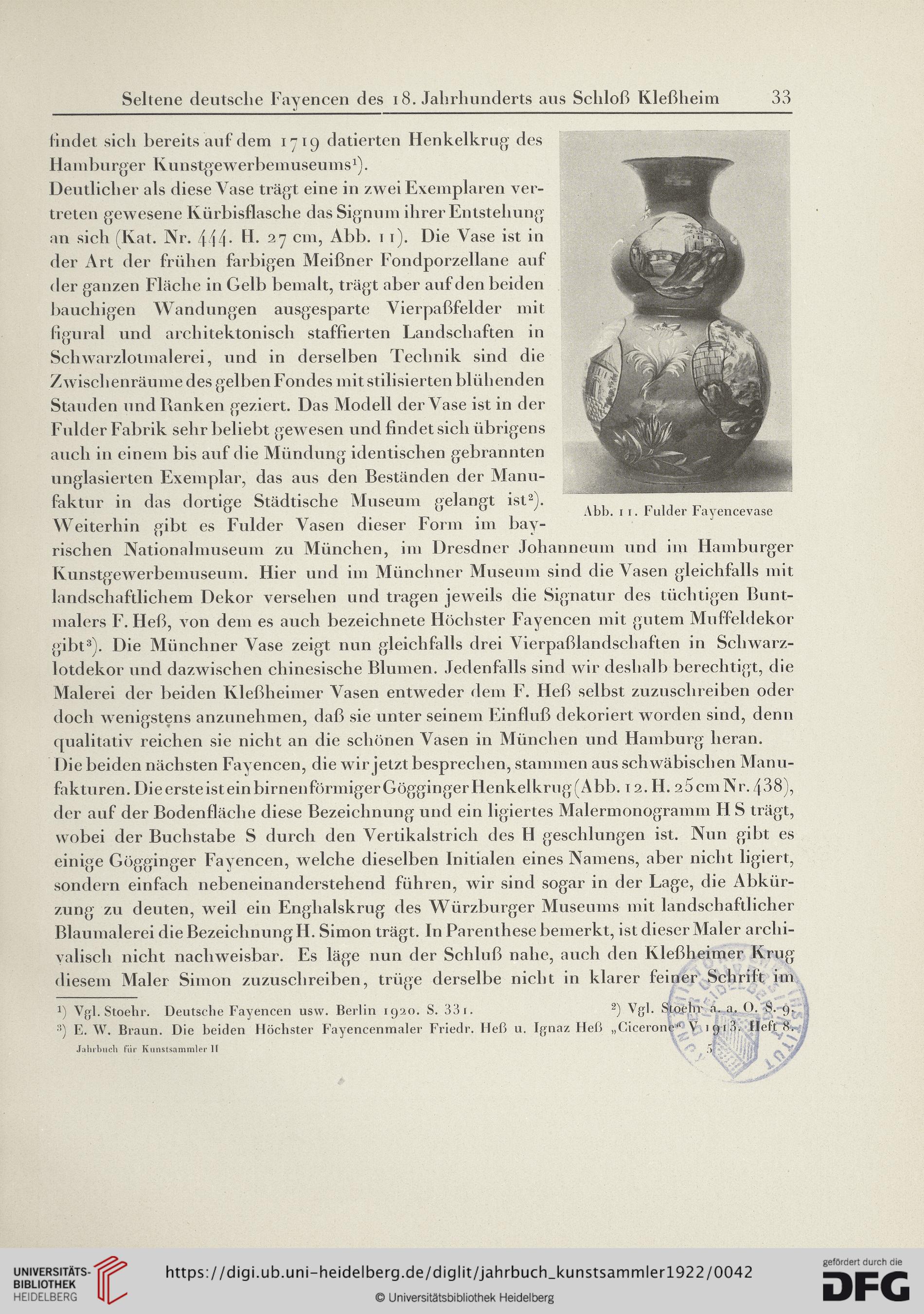Seltene deutsche Fayencen des 18. Jahrhunderts aus Schloß Kleßheim
33
f indet sich bereits auf dem 1719 datierten Henkelkrug des
Hamburger Kunstgewerbemuseums1).
Deutlicher als diese Vase trägt eine in zwei Exemplaren ver¬
treten gewesene Kürbisflasche das Signum ihrer Entstehung
an sich (Kat. Nr. 444- H. 27 cm, Abb. 1 1). Die Vase ist in
der Art der frühen farbigen Meißner Fondporzellane auf
der ganzen Fläche in Gelb bemalt, trägt aber auf den beiden
bauchigen Wandungen ausgesparte Vierpaßfelder mit
figural und architektonisch staffierten Landschaften in
Schwarzlotmalerei, und in derselben Technik sind die
Zwischenräume des gelben Fondes mit stilisierten blühenden
Stauden und Ranken geziert. Das Modell der Vase ist in der
Fulder Fabrik sehr beliebt gewesen und findet sich übrigens
auch in einem bis auf die Mündung identischen gebrannten
unglasierten Exemplar, das aus den Beständen der Manu¬
faktur in das dortige Städtische Museum gelangt ist2).
Weiterhin gibt es Fulder Vasen dieser Form im bay-
rischen Nationalmuseum zu München, im Dresdner Johanneum und im Hamburger
Kunstgewerbemuseum. Hier und im Münchner Museum sind die Vasen gleichfalls mit
landschaftlichem Dekor versehen und tragen jeweils die Signatur des tüchtigen Bunt-
malers F. Heß, von dem es auch bezeichnete Höchster Fayencen mit gutem Muffeldekor
gibt3). Die Münchner Vase zeigt nun gleichfalls drei Vierpaßlandscliaften in Scliwarz-
lotdekor und dazwischen chinesische Blumen. Jedenfalls sind wir deshalb berechtigt, die
Malerei der beiden Kleßheimer Vasen entweder dem F. Heß selbst zuzuschreiben oder
doch wenigstens anzunehmen, daß sie unter seinem Einfluß dekoriert worden sind, denn
qualitativ reichen sie nicht an die schönen Vasen in München und Hamburg heran.
Die beiden nächsten Fayencen, die wir jetzt besprechen, stammen aus schwäbischen Manu-
fakturen. DieersteisteinbirnenförmigerGöggingerHenkelkrug(Abb. 12. H. 25cmNr. 438),
der auf der Bodenfläche diese Bezeichnung und ein ligiertes Malermonogramm H S trägt,
wobei der Buchstabe S durch den Vertikalstrich des H geschlungen ist. Nun gibt es
einige Gögginger Fayencen, welche dieselben Initialen eines Namens, aber nicht ligiert,
sondern einfach nebeneinanderstehend führen, wir sind sogar in der Lage, die Abkür-
zung zu deuten, weil ein Englialskrug des Würzburger Museums mit landschaftlicher
Blaumalerei die Bezeichnung H. Simon trägt. In Parenthese bemerkt, ist dieser Maler archi-
valisch nicht nachweisbar. Es läge nun der Schluß nahe, auch den Kleßheimer Krug
diesem Maler Simon zuzusclireiben, trüge derselbe nicht in klarer feiner Schrift im
—
x) Vgl. Stoehr. Deutsche Fayencen usxv. Berlin 1920. S. 33 1. 2) Vgl. StQphr La. O. -S. 9.
3) E. W. Braun. Die beiden Höchster Fayencenmaler Friedr. Heß u. Ignaz Heß „Cicerone“ V 19
■7.
Jahrbuch für Kunstsammler H 5
Abb. 1 1. Fulder Fayencevase
33
f indet sich bereits auf dem 1719 datierten Henkelkrug des
Hamburger Kunstgewerbemuseums1).
Deutlicher als diese Vase trägt eine in zwei Exemplaren ver¬
treten gewesene Kürbisflasche das Signum ihrer Entstehung
an sich (Kat. Nr. 444- H. 27 cm, Abb. 1 1). Die Vase ist in
der Art der frühen farbigen Meißner Fondporzellane auf
der ganzen Fläche in Gelb bemalt, trägt aber auf den beiden
bauchigen Wandungen ausgesparte Vierpaßfelder mit
figural und architektonisch staffierten Landschaften in
Schwarzlotmalerei, und in derselben Technik sind die
Zwischenräume des gelben Fondes mit stilisierten blühenden
Stauden und Ranken geziert. Das Modell der Vase ist in der
Fulder Fabrik sehr beliebt gewesen und findet sich übrigens
auch in einem bis auf die Mündung identischen gebrannten
unglasierten Exemplar, das aus den Beständen der Manu¬
faktur in das dortige Städtische Museum gelangt ist2).
Weiterhin gibt es Fulder Vasen dieser Form im bay-
rischen Nationalmuseum zu München, im Dresdner Johanneum und im Hamburger
Kunstgewerbemuseum. Hier und im Münchner Museum sind die Vasen gleichfalls mit
landschaftlichem Dekor versehen und tragen jeweils die Signatur des tüchtigen Bunt-
malers F. Heß, von dem es auch bezeichnete Höchster Fayencen mit gutem Muffeldekor
gibt3). Die Münchner Vase zeigt nun gleichfalls drei Vierpaßlandscliaften in Scliwarz-
lotdekor und dazwischen chinesische Blumen. Jedenfalls sind wir deshalb berechtigt, die
Malerei der beiden Kleßheimer Vasen entweder dem F. Heß selbst zuzuschreiben oder
doch wenigstens anzunehmen, daß sie unter seinem Einfluß dekoriert worden sind, denn
qualitativ reichen sie nicht an die schönen Vasen in München und Hamburg heran.
Die beiden nächsten Fayencen, die wir jetzt besprechen, stammen aus schwäbischen Manu-
fakturen. DieersteisteinbirnenförmigerGöggingerHenkelkrug(Abb. 12. H. 25cmNr. 438),
der auf der Bodenfläche diese Bezeichnung und ein ligiertes Malermonogramm H S trägt,
wobei der Buchstabe S durch den Vertikalstrich des H geschlungen ist. Nun gibt es
einige Gögginger Fayencen, welche dieselben Initialen eines Namens, aber nicht ligiert,
sondern einfach nebeneinanderstehend führen, wir sind sogar in der Lage, die Abkür-
zung zu deuten, weil ein Englialskrug des Würzburger Museums mit landschaftlicher
Blaumalerei die Bezeichnung H. Simon trägt. In Parenthese bemerkt, ist dieser Maler archi-
valisch nicht nachweisbar. Es läge nun der Schluß nahe, auch den Kleßheimer Krug
diesem Maler Simon zuzusclireiben, trüge derselbe nicht in klarer feiner Schrift im
—
x) Vgl. Stoehr. Deutsche Fayencen usxv. Berlin 1920. S. 33 1. 2) Vgl. StQphr La. O. -S. 9.
3) E. W. Braun. Die beiden Höchster Fayencenmaler Friedr. Heß u. Ignaz Heß „Cicerone“ V 19
■7.
Jahrbuch für Kunstsammler H 5
Abb. 1 1. Fulder Fayencevase