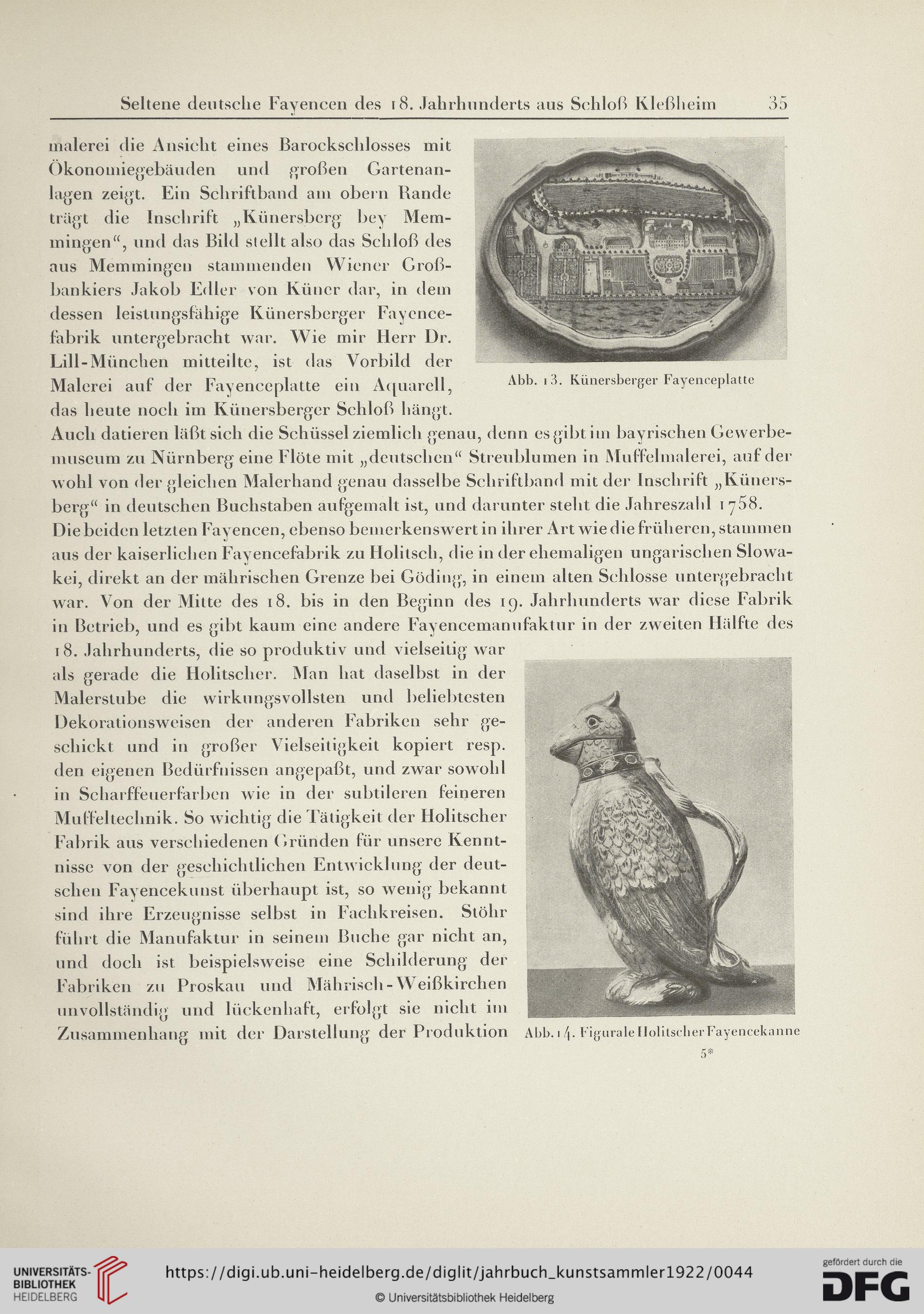Seltene deutsche Fayencen des 18. Jahrhunderts aus Schloß Kleßheim
inalerei die Ansicht eines Barockschlosses mit
Ökonomiegebäuden und großen Gartenan¬
lagen zeigt. Ein Schriftband am obern Rande
trägt die Inschrift „Künersberg bey Mem¬
mingen“, und das Bild stellt also das Schloß des
aus Memmingen stammenden Wiener Gro߬
bankiers Jakob Edler von Küucr dar, in dem
dessen leistungsfähige Künersberger Fayence¬
fabrik untergebracht war. Wie mir Herr Dr.
Lill-München mitteilte, ist das Vorbild der
Malerei auf der Fayenceplatte ein Aquarell,
das heute noch im Künersberger Schloß hängt.
Auch datieren läßt sich die Schüssel ziemlich genau, denn es gibt im bayrischen Gewerbe-
museum zu Nürnberg eine Flöte mit „deutschen“ Streublumen in Muffelmalerei, auf der
wohl von der gleichen Malerhand genau dasselbe Schriftband mit der Inschrift „Küners-
berg“ in deutschen Buchstaben aufgemalt ist, und darunter steht die Jahreszahl i 758.
Diebeiden letzten Fayencen, ebenso bemerkenswert in ihrer Art wie die früheren, stammen
aus der kaiserlichen Fayencefabrik zu Holitsch, die in der ehemaligen ungarischen Slowa-
kei, direkt an der mährischen Grenze bei Göding, in einem alten Schlosse untergebracht
war. Von der Mitte des 18. bis in den Beginn des ig. Jahrhunderts war diese Fabrik
in Betrieb, und es gibt kaum eine andere Fayencemanufaktur in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts, die so produktiv und vielseitig war
als gerade die Holitscher. Man hat daselbst in der
Malerstube die wirkungsvollsten und beliebtesten
Dekorationsweisen der anderen Fabriken sehr ge¬
schickt und in großer Vielseitigkeit kopiert resp.
den eigenen Bedürfnissen angepaßt, und zwar sowohl
in Scharffeuerfarben wie in der subtileren feineren
Muffeltechnik. So wichtig die Tätigkeit der Holitscher
Fabrik aus verschiedenen Gründen für unsere Kennt¬
nisse von der geschichtlichen Entwicklung der deut¬
schen Fayencekunst überhaupt ist, so wenig bekannt
sind ihre Erzeugnisse selbst in Fachkreisen. Stöhr
führt die Manufaktur in seinem Buche gar nicht an,
und doch ist beispielsweise eine Schilderung der
Fabriken zu Proskau und Mährisch-Weißkirchen
unvollständig und lückenhaft, erfolgt sie nicht im
Zusammenhang mit der Darstellung der Produktion Abb. 14. FiguraleIloliischerFayencekanne
inalerei die Ansicht eines Barockschlosses mit
Ökonomiegebäuden und großen Gartenan¬
lagen zeigt. Ein Schriftband am obern Rande
trägt die Inschrift „Künersberg bey Mem¬
mingen“, und das Bild stellt also das Schloß des
aus Memmingen stammenden Wiener Gro߬
bankiers Jakob Edler von Küucr dar, in dem
dessen leistungsfähige Künersberger Fayence¬
fabrik untergebracht war. Wie mir Herr Dr.
Lill-München mitteilte, ist das Vorbild der
Malerei auf der Fayenceplatte ein Aquarell,
das heute noch im Künersberger Schloß hängt.
Auch datieren läßt sich die Schüssel ziemlich genau, denn es gibt im bayrischen Gewerbe-
museum zu Nürnberg eine Flöte mit „deutschen“ Streublumen in Muffelmalerei, auf der
wohl von der gleichen Malerhand genau dasselbe Schriftband mit der Inschrift „Küners-
berg“ in deutschen Buchstaben aufgemalt ist, und darunter steht die Jahreszahl i 758.
Diebeiden letzten Fayencen, ebenso bemerkenswert in ihrer Art wie die früheren, stammen
aus der kaiserlichen Fayencefabrik zu Holitsch, die in der ehemaligen ungarischen Slowa-
kei, direkt an der mährischen Grenze bei Göding, in einem alten Schlosse untergebracht
war. Von der Mitte des 18. bis in den Beginn des ig. Jahrhunderts war diese Fabrik
in Betrieb, und es gibt kaum eine andere Fayencemanufaktur in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts, die so produktiv und vielseitig war
als gerade die Holitscher. Man hat daselbst in der
Malerstube die wirkungsvollsten und beliebtesten
Dekorationsweisen der anderen Fabriken sehr ge¬
schickt und in großer Vielseitigkeit kopiert resp.
den eigenen Bedürfnissen angepaßt, und zwar sowohl
in Scharffeuerfarben wie in der subtileren feineren
Muffeltechnik. So wichtig die Tätigkeit der Holitscher
Fabrik aus verschiedenen Gründen für unsere Kennt¬
nisse von der geschichtlichen Entwicklung der deut¬
schen Fayencekunst überhaupt ist, so wenig bekannt
sind ihre Erzeugnisse selbst in Fachkreisen. Stöhr
führt die Manufaktur in seinem Buche gar nicht an,
und doch ist beispielsweise eine Schilderung der
Fabriken zu Proskau und Mährisch-Weißkirchen
unvollständig und lückenhaft, erfolgt sie nicht im
Zusammenhang mit der Darstellung der Produktion Abb. 14. FiguraleIloliischerFayencekanne