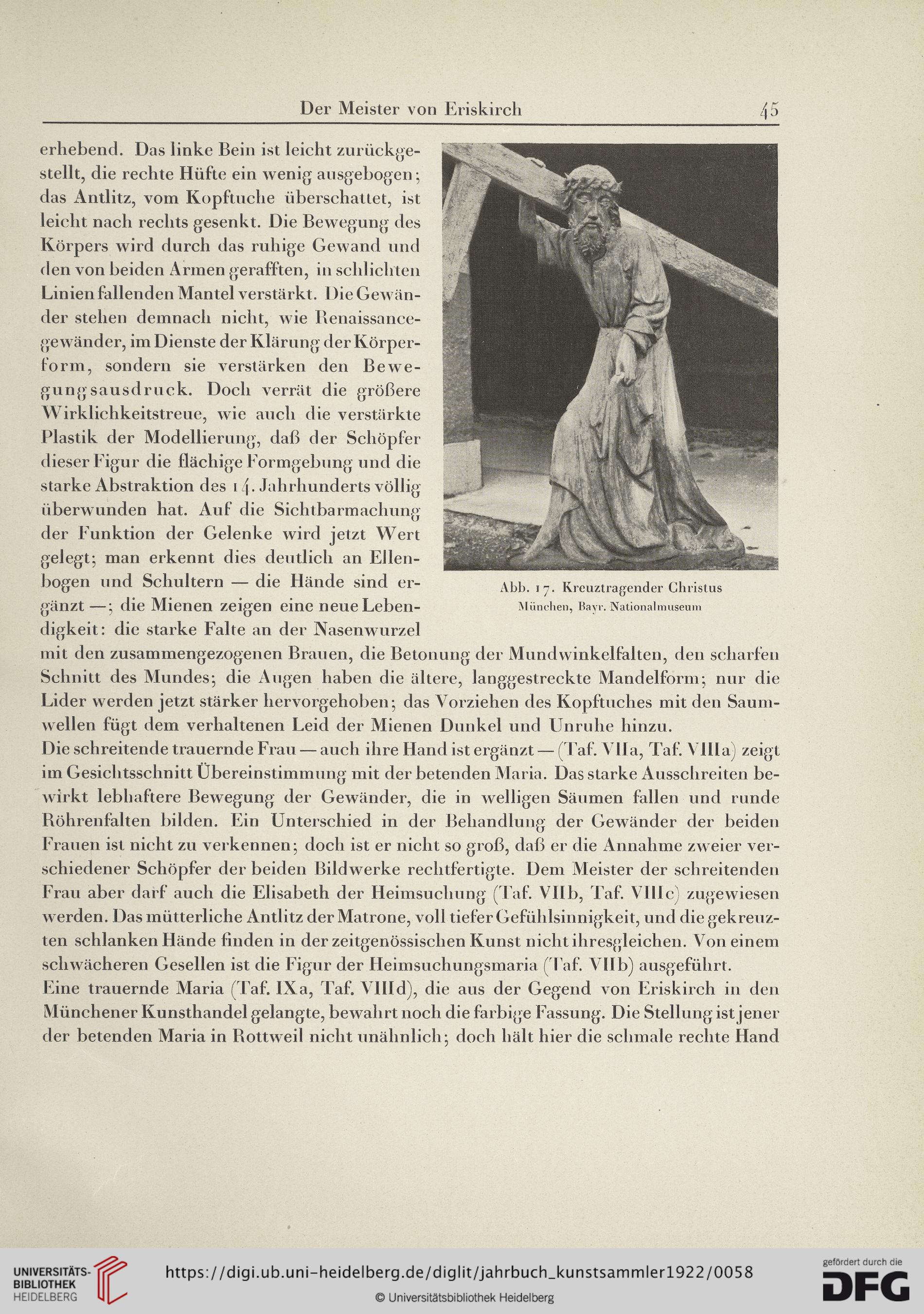Der Meister von Eriskirch
45
erhebend. Das linke Bein ist leicht zurückge¬
stellt, die rechte Hüfte ein wenig ausgebogen;
das Antlitz, vom Kopftuche überschattet, ist
leicht nach rechts gesenkt. Die Bewegung des
Körpers wird durch das ruhige Gewand und
den von beiden Armen gerafften, in schlichten
Linien fallenden Mantel verstärkt. Die Gewän¬
der stehen demnach nicht, wie Renaissance¬
gewänder, im Dienste der Klärung der Körper¬
form, sondern sie verstärken den Bewe¬
gung sausdruck. Doch verrät die größere
Wirklichkeitstreue, wie auch die verstärkte
Plastik der Modellierung, daß der Schöpfer
dieser Figur die flächige Formgebung und die
starke Abstraktion des 14-Jahrhunderts völlig
überwunden hat. Auf die Sichtbarmachung
der Funktion der Gelenke wird jetzt Wert
gelegt; man erkennt dies deutlich an Ellen¬
bogen und Schultern — die Hände sind er¬
gänzt —; die Mienen zeigen eine neue Leben¬
digkeit: die starke Falte an der Nasenwurzel
mit den zusammengezogenen Brauen, die Betonung der Mundwinkelfalten, den scharfen
Schnitt des Mundes; die Augen haben die ältere, langgestreckte Mandelform; nur die
Lider werden jetzt stärker hervorgehoben; das Vorziehen des Kopftuches mit den Saum-
wellen fügt dem verhaltenen Leid der Mienen Dunkel und Unruhe hinzu.
Die schreitende trauernde Frau — auch ihre Hand ist ergänzt — (Taf. Vila, Taf. Villa) zeigt
im Gesichtsschnitt Übereinstimmung mit der betenden Maria. Das starke Ausschreiten be-
wirkt lebhaftere Bewegung der Gewänder, die in welligen Säumen fallen und runde
Röhrenfalten bilden. Ein Unterschied in der Behandlung der Gewänder der beiden
Frauen ist nicht zu verkennen; doch ist er nicht so groß, daß er die Annahme zweier ver-
schiedener Schöpfer der beiden Bildwerke rechtfertigte. Dem Meister der schreitenden
Frau aber darf auch die Elisabeth der Heimsuchung (Taf. VTIb, Taf. Ville) zugewiesen
werden. Das mütterliche Antlitz der Matrone, voll tiefer Gefühlsinnigkeit, und die gekreuz-
ten schlanken Hände finden in der zeitgenössischen Kunst nicht ihresgleichen. Von einem
schwächeren Gesellen ist die Figur der Heimsuchungsmaria (Taf. Vllb) ausgeführt.
Eine trauernde Maria (Taf. IXa, Taf. VIIId), die aus der Gegend von Eriskirch in den
Münchener Kunsthandel gelangte, bewahrt noch die farbige Fassung. Die Stellung ist jener
der betenden Maria in Rottweil nicht unähnlich; doch hält hier die schmale rechte Hand
45
erhebend. Das linke Bein ist leicht zurückge¬
stellt, die rechte Hüfte ein wenig ausgebogen;
das Antlitz, vom Kopftuche überschattet, ist
leicht nach rechts gesenkt. Die Bewegung des
Körpers wird durch das ruhige Gewand und
den von beiden Armen gerafften, in schlichten
Linien fallenden Mantel verstärkt. Die Gewän¬
der stehen demnach nicht, wie Renaissance¬
gewänder, im Dienste der Klärung der Körper¬
form, sondern sie verstärken den Bewe¬
gung sausdruck. Doch verrät die größere
Wirklichkeitstreue, wie auch die verstärkte
Plastik der Modellierung, daß der Schöpfer
dieser Figur die flächige Formgebung und die
starke Abstraktion des 14-Jahrhunderts völlig
überwunden hat. Auf die Sichtbarmachung
der Funktion der Gelenke wird jetzt Wert
gelegt; man erkennt dies deutlich an Ellen¬
bogen und Schultern — die Hände sind er¬
gänzt —; die Mienen zeigen eine neue Leben¬
digkeit: die starke Falte an der Nasenwurzel
mit den zusammengezogenen Brauen, die Betonung der Mundwinkelfalten, den scharfen
Schnitt des Mundes; die Augen haben die ältere, langgestreckte Mandelform; nur die
Lider werden jetzt stärker hervorgehoben; das Vorziehen des Kopftuches mit den Saum-
wellen fügt dem verhaltenen Leid der Mienen Dunkel und Unruhe hinzu.
Die schreitende trauernde Frau — auch ihre Hand ist ergänzt — (Taf. Vila, Taf. Villa) zeigt
im Gesichtsschnitt Übereinstimmung mit der betenden Maria. Das starke Ausschreiten be-
wirkt lebhaftere Bewegung der Gewänder, die in welligen Säumen fallen und runde
Röhrenfalten bilden. Ein Unterschied in der Behandlung der Gewänder der beiden
Frauen ist nicht zu verkennen; doch ist er nicht so groß, daß er die Annahme zweier ver-
schiedener Schöpfer der beiden Bildwerke rechtfertigte. Dem Meister der schreitenden
Frau aber darf auch die Elisabeth der Heimsuchung (Taf. VTIb, Taf. Ville) zugewiesen
werden. Das mütterliche Antlitz der Matrone, voll tiefer Gefühlsinnigkeit, und die gekreuz-
ten schlanken Hände finden in der zeitgenössischen Kunst nicht ihresgleichen. Von einem
schwächeren Gesellen ist die Figur der Heimsuchungsmaria (Taf. Vllb) ausgeführt.
Eine trauernde Maria (Taf. IXa, Taf. VIIId), die aus der Gegend von Eriskirch in den
Münchener Kunsthandel gelangte, bewahrt noch die farbige Fassung. Die Stellung ist jener
der betenden Maria in Rottweil nicht unähnlich; doch hält hier die schmale rechte Hand