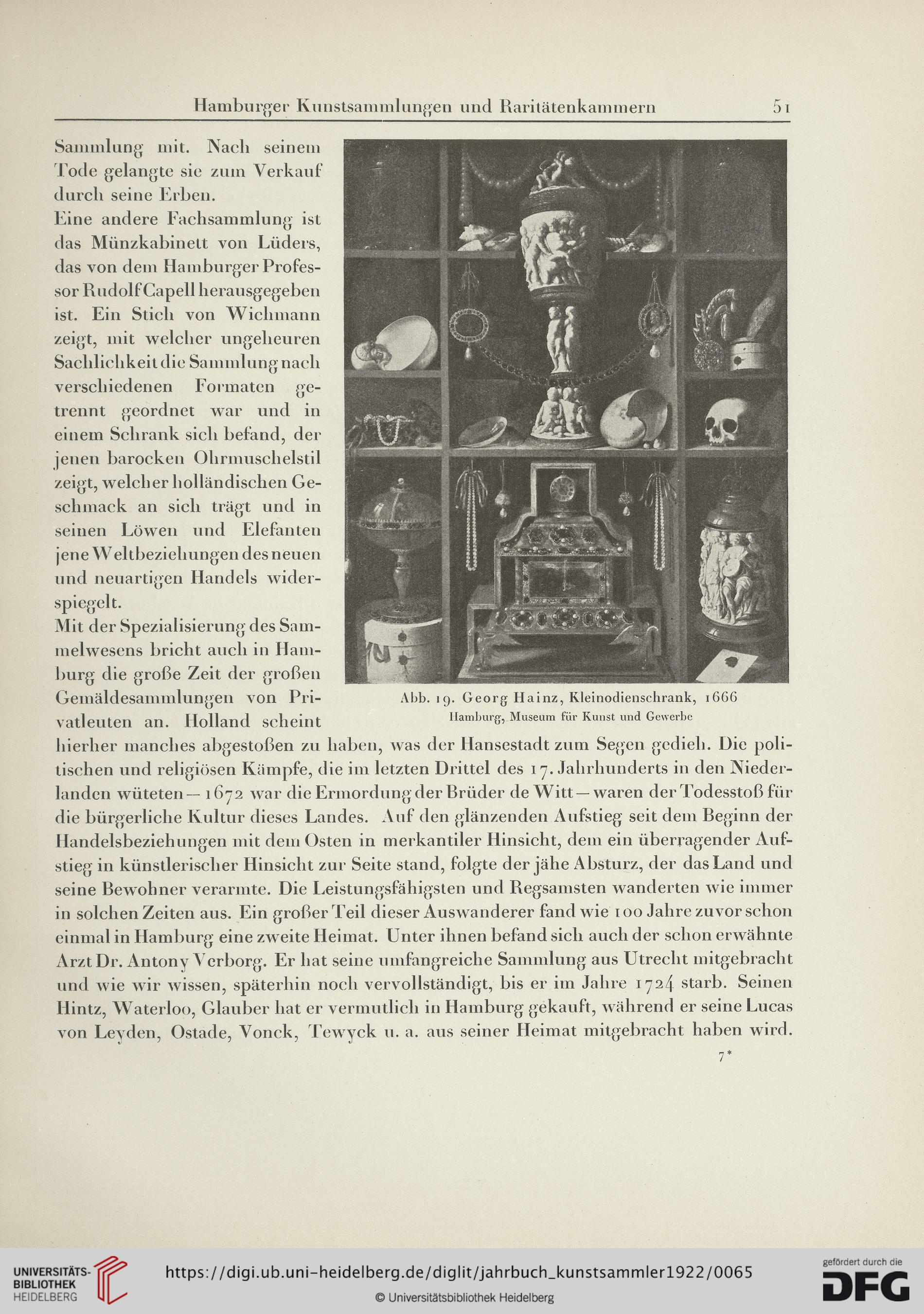Hamburger Kunstsammlungen und Raritätenkammern
51
Abb. 19. Georg Hainz, Kleinodienschrank, 1666
Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe
Sammlung mit. Nach seinem
Tode gelangte sie zum Verkauf
durch seine Erben.
Eine andere Fachsammlung ist
das Münzkabinett von Lüders,
das von dem Hamburger Profes¬
sor Rudolf Capell herausgegeben
ist. Ein Stich von Wichmann
zeigt, mit welcher ungeheuren
Sachlichkeit die Sammlung nach
verschiedenen Formaten ge¬
trennt geordnet war und in
einem Schrank sich befand, der
jenen barocken Ohrmuschelstil
zeigt, welcher holländischen Ge¬
schmack an sich trägt und in
seinen Löwen und Elefanten
jene Weltbezieliungen des neuen
und neuartigen Handels wider¬
spiegelt.
Mit der Spezialisierung des Sam¬
melwesens bricht auch in Ham¬
burg die große Zeit der großen
Gemäldesammlungen von Pri¬
vatleuten an. Holland scheint
hierher manches abgestoßen zu haben, was der Hansestadt zum Segen gedieh. Die poli-
tischen und religiösen Kämpfe, die im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in den Nieder-
landen wüteten— 1672 war die Ermordung der Erüder de Witt—waren der Todesstoß für
die bürgerliche Kultur dieses Landes. Auf den glänzenden Aufstieg seit dem Beginn der
Handelsbeziehungen mit dem Osten in merkantiler Hinsicht, dem ein überragender Auf-
stieg in künstlerischer Hinsicht zur Seite stand, folgte der jähe Absturz, der das Land und
seine Bewohner verarmte. Die Leistungsfähigsten und Regsamsten wanderten wie immer
in solchen Zeiten aus. Ein großer Teil dieser Auswanderer fand wie 100 Jahre zuvor schon
einmal in Hamburg eine zweite Heimat. Unter ihnen befand sich auch der schon erwähnte
ArztDr. Antony Verborg. Er hat seine umfangreiche Sammlung aus Utrecht mitgebracht
und wie wir wissen, späterhin noch vervollständigt, bis er im Jahre 1724 starb. Seinen
Hintz, Waterloo, Glauber hat er vermutlich in Hamburg gekauft, während er seine Lucas
von Leyden, Ostade, Vonck, Tewyck u. a. aus seiner Heimat mitgebracht haben wird.
7*
51
Abb. 19. Georg Hainz, Kleinodienschrank, 1666
Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe
Sammlung mit. Nach seinem
Tode gelangte sie zum Verkauf
durch seine Erben.
Eine andere Fachsammlung ist
das Münzkabinett von Lüders,
das von dem Hamburger Profes¬
sor Rudolf Capell herausgegeben
ist. Ein Stich von Wichmann
zeigt, mit welcher ungeheuren
Sachlichkeit die Sammlung nach
verschiedenen Formaten ge¬
trennt geordnet war und in
einem Schrank sich befand, der
jenen barocken Ohrmuschelstil
zeigt, welcher holländischen Ge¬
schmack an sich trägt und in
seinen Löwen und Elefanten
jene Weltbezieliungen des neuen
und neuartigen Handels wider¬
spiegelt.
Mit der Spezialisierung des Sam¬
melwesens bricht auch in Ham¬
burg die große Zeit der großen
Gemäldesammlungen von Pri¬
vatleuten an. Holland scheint
hierher manches abgestoßen zu haben, was der Hansestadt zum Segen gedieh. Die poli-
tischen und religiösen Kämpfe, die im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in den Nieder-
landen wüteten— 1672 war die Ermordung der Erüder de Witt—waren der Todesstoß für
die bürgerliche Kultur dieses Landes. Auf den glänzenden Aufstieg seit dem Beginn der
Handelsbeziehungen mit dem Osten in merkantiler Hinsicht, dem ein überragender Auf-
stieg in künstlerischer Hinsicht zur Seite stand, folgte der jähe Absturz, der das Land und
seine Bewohner verarmte. Die Leistungsfähigsten und Regsamsten wanderten wie immer
in solchen Zeiten aus. Ein großer Teil dieser Auswanderer fand wie 100 Jahre zuvor schon
einmal in Hamburg eine zweite Heimat. Unter ihnen befand sich auch der schon erwähnte
ArztDr. Antony Verborg. Er hat seine umfangreiche Sammlung aus Utrecht mitgebracht
und wie wir wissen, späterhin noch vervollständigt, bis er im Jahre 1724 starb. Seinen
Hintz, Waterloo, Glauber hat er vermutlich in Hamburg gekauft, während er seine Lucas
von Leyden, Ostade, Vonck, Tewyck u. a. aus seiner Heimat mitgebracht haben wird.
7*