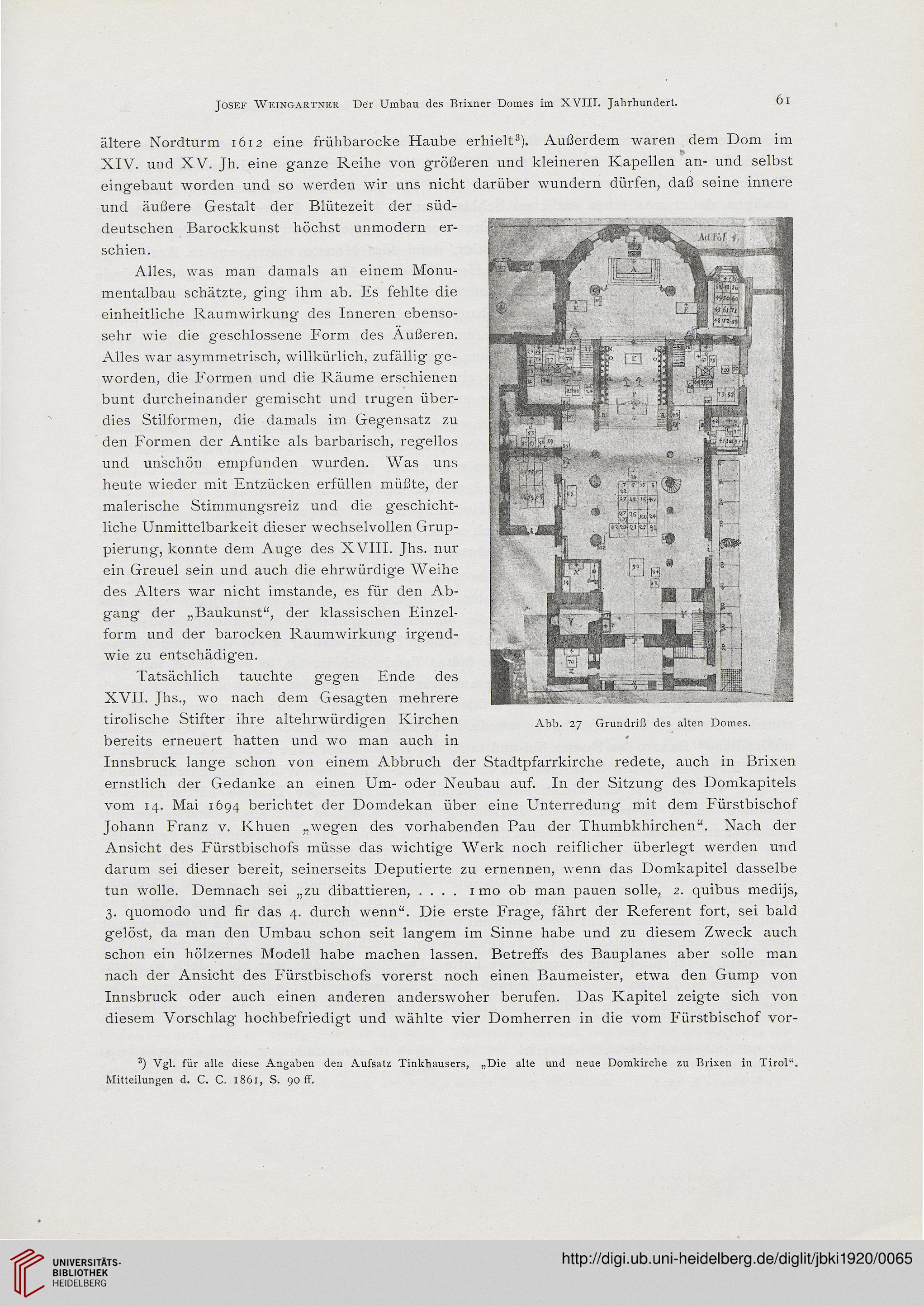Josef Weingartner Der Umbau des Biixner Domes im XVIII. Jahrhundert.
6l
ältere Nordturm 1612 eine frühbarocke Haube erhielt8). Außerdem waren dem Dom im
XIV. und XV. Jh. eine ganze Reihe von größeren und kleineren Kapellen an- und selbst
eingebaut worden und so werden wir uns nicht darüber wundern dürfen, daß seine innere
und äußere Gestalt der Blütezeit der süd-
deutschen Barockkunst höchst unmodern er-
schien.
Alles, was man damals an einem Monu-
mentalbau schätzte, ging ihm ab. Es fehlte die
einheitliche Raumwirkung des Inneren ebenso-
sehr wie die geschlossene Form des Äußeren.
Alles war asymmetrisch, willkürlich, zufällig ge-
worden, die Formen und die Räume erschienen
bunt durcheinander gemischt und trugen über-
dies Stilformen, die damals im Gegensatz zu
den Formen der Antike als barbarisch, regellos
und unschön empfunden wurden. Was uns
heute wieder mit Entzücken erfüllen müßte, der
malerische Stimmungsreiz und die geschicht-
liche Unmittelbarkeit dieser wechselvollen Grup-
pierung, konnte dem Auge des XVIII. Jhs. nur
ein Greuel sein und auch die ehrwürdige Weihe
des Alters war nicht imstande, es für den Ab-
gang der „Baukunst“, der klassischen Einzel-
form und der barocken Raumwirkung irgend-
wie zu entschädigen.
Tatsächlich tauchte gegen Ende des
XVII. Jhs., wo nach dem Gesagten mehrere
tirolische Stifter ihre altehrwürdigen Kirchen
bereits erneuert hatten und wo man auch in
Innsbruck lange schon von einem Abbruch der Stadtpfarrkirche redete, auch in Brixen
ernstlich der Gedanke an einen Um- oder Neubau auf. In der Sitzung des Domkapitels
vom 14. Mai 1694 berichtet der Domdekan über eine Unterredung mit dem Fürstbischof
Johann Franz v. Khuen „wegen des vorhabenden Pau der Thumbkhirchen“. Nach der
Ansicht des Fürstbischofs müsse das wichtige Werk noch reiflicher überlegt werden und
darum sei dieser bereit, seinerseits Deputierte zu ernennen, wenn das Domkapitel dasselbe
tun wolle. Demnach sei „zu dibattieren, .... 1 mo ob man pauen solle, 2. quibus medijs,
3. quomodo und fir das 4. durch wenn“. Die erste Frage, fährt der Referent fort, sei bald
gelöst, da man den Umbau schon seit langem im Sinne habe und zu diesem Zweck auch
schon ein hölzernes Modell habe machen lassen. Betreffs des Bauplanes aber solle man
nach der Ansicht des Fürstbischofs vorerst noch einen Baumeister, etwa den Gump von
Innsbruck oder auch einen anderen anderswoher berufen. Das Kapitel zeigte sich von
diesem Vorschlag hochbefriedigt und wählte vier Domherren in die vom Fürstbischof vor- 3 *
3) Vgl* für alle diese Angaben den Aufsatz Tinkhausers, „Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol“.
Mitteilungen d. C. C. 1861, S. 90 ff.
Abb. 27 Grundriß des alten Domes.
6l
ältere Nordturm 1612 eine frühbarocke Haube erhielt8). Außerdem waren dem Dom im
XIV. und XV. Jh. eine ganze Reihe von größeren und kleineren Kapellen an- und selbst
eingebaut worden und so werden wir uns nicht darüber wundern dürfen, daß seine innere
und äußere Gestalt der Blütezeit der süd-
deutschen Barockkunst höchst unmodern er-
schien.
Alles, was man damals an einem Monu-
mentalbau schätzte, ging ihm ab. Es fehlte die
einheitliche Raumwirkung des Inneren ebenso-
sehr wie die geschlossene Form des Äußeren.
Alles war asymmetrisch, willkürlich, zufällig ge-
worden, die Formen und die Räume erschienen
bunt durcheinander gemischt und trugen über-
dies Stilformen, die damals im Gegensatz zu
den Formen der Antike als barbarisch, regellos
und unschön empfunden wurden. Was uns
heute wieder mit Entzücken erfüllen müßte, der
malerische Stimmungsreiz und die geschicht-
liche Unmittelbarkeit dieser wechselvollen Grup-
pierung, konnte dem Auge des XVIII. Jhs. nur
ein Greuel sein und auch die ehrwürdige Weihe
des Alters war nicht imstande, es für den Ab-
gang der „Baukunst“, der klassischen Einzel-
form und der barocken Raumwirkung irgend-
wie zu entschädigen.
Tatsächlich tauchte gegen Ende des
XVII. Jhs., wo nach dem Gesagten mehrere
tirolische Stifter ihre altehrwürdigen Kirchen
bereits erneuert hatten und wo man auch in
Innsbruck lange schon von einem Abbruch der Stadtpfarrkirche redete, auch in Brixen
ernstlich der Gedanke an einen Um- oder Neubau auf. In der Sitzung des Domkapitels
vom 14. Mai 1694 berichtet der Domdekan über eine Unterredung mit dem Fürstbischof
Johann Franz v. Khuen „wegen des vorhabenden Pau der Thumbkhirchen“. Nach der
Ansicht des Fürstbischofs müsse das wichtige Werk noch reiflicher überlegt werden und
darum sei dieser bereit, seinerseits Deputierte zu ernennen, wenn das Domkapitel dasselbe
tun wolle. Demnach sei „zu dibattieren, .... 1 mo ob man pauen solle, 2. quibus medijs,
3. quomodo und fir das 4. durch wenn“. Die erste Frage, fährt der Referent fort, sei bald
gelöst, da man den Umbau schon seit langem im Sinne habe und zu diesem Zweck auch
schon ein hölzernes Modell habe machen lassen. Betreffs des Bauplanes aber solle man
nach der Ansicht des Fürstbischofs vorerst noch einen Baumeister, etwa den Gump von
Innsbruck oder auch einen anderen anderswoher berufen. Das Kapitel zeigte sich von
diesem Vorschlag hochbefriedigt und wählte vier Domherren in die vom Fürstbischof vor- 3 *
3) Vgl* für alle diese Angaben den Aufsatz Tinkhausers, „Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol“.
Mitteilungen d. C. C. 1861, S. 90 ff.
Abb. 27 Grundriß des alten Domes.