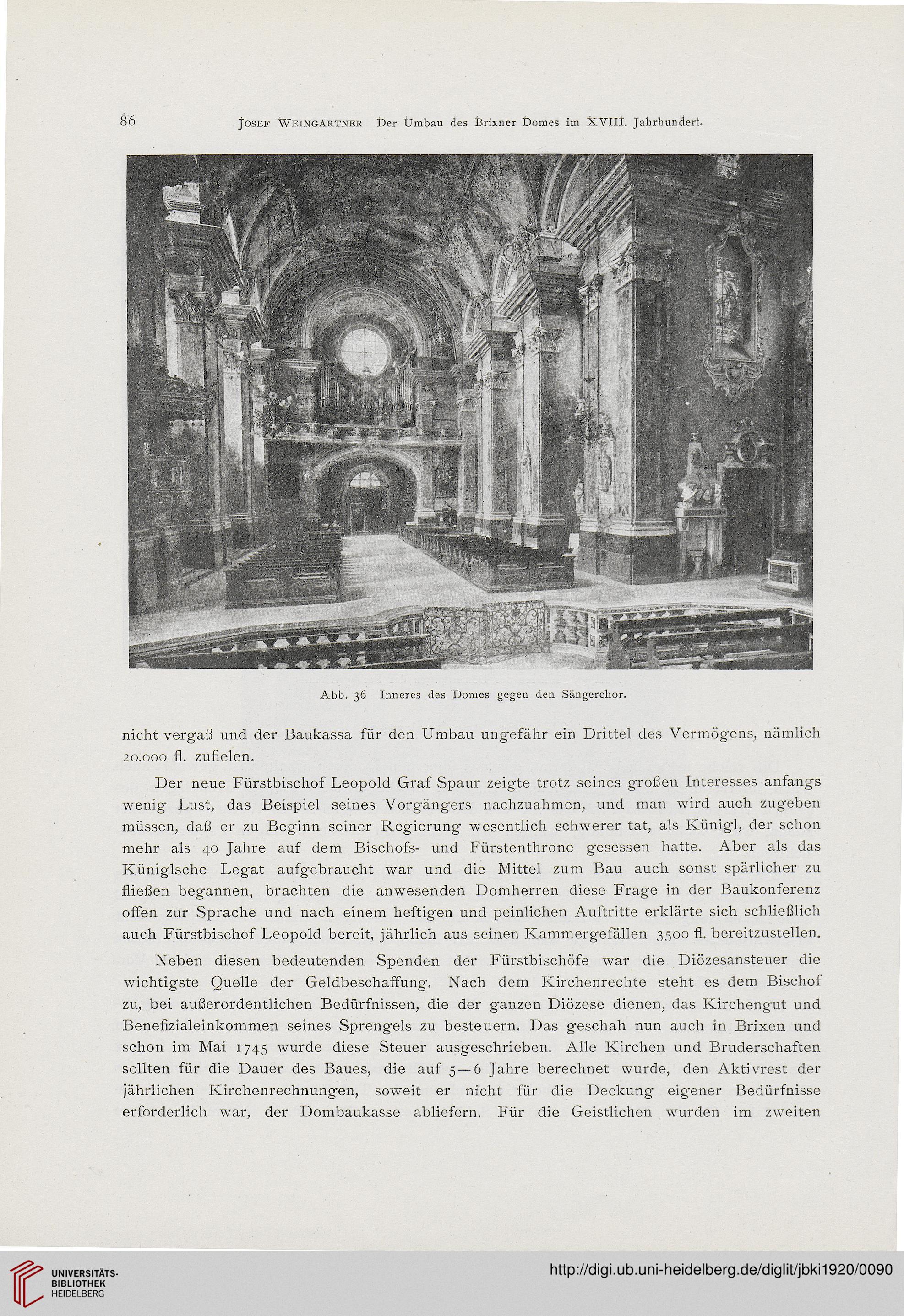86
Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundert.
"’-tj
Abb. 36 Inneres des Domes gegen den Sängerchor.
nicht vergaß und der Baukassa für den Umbau ungefähr ein Drittel des Vermögens, nämlich
20.000 fl. zufielen.
Der neue Fürstbischof Leopold Graf Spaur zeigte trotz seines großen Interesses anfangs
wenig Lust, das Beispiel seines Vorgängers nachzuahmen, und man wird auch zugeben
müssen, daß er zu Beginn seiner Regierung wesentlich schwerer tat, als Künigl, der schon
mehr als 40 Jahre auf dem Bischofs- und Fürstenthrone gesessen hatte. Aber als das
Küniglsche Legat aufgebraucht war und die Mittel zum Bau auch sonst spärlicher zu
fließen begannen, brachten die anwesenden Domherren diese Frage in der Baukonferenz
offen zur Sprache und nach einem heftigen und peinlichen Auftritte erklärte sich schließlich
auch Fürstbischof Leopold bereit, jährlich aus seinen Kammergefällen 3500 fl. bereitzustellen.
Neben diesen bedeutenden Spenden der Fürstbischöfe war die Diözesansteuer die
wichtigste Quelle der Geldbeschaffung. Nach dem Kirchenrechte steht es dem Bischof
zu, bei außerordentlichen Bedürfnissen, die der ganzen Diözese dienen, das Kirchengut und
Benefizialeinkommen seines Sprengels zu besteuern. Das geschah nun auch in Brixen und
schon im Mai 1745 wurde diese Steuer ausgeschrieben. Alle Kirchen und Bruderschaften
sollten für die Dauer des Baues, die auf 5 — 6 Jahre berechnet wurde, den Aktivrest der
jährlichen Kirchenrechnungen, soweit er nicht für die Deckung eigener Bedürfnisse
erforderlich war, der Dombaukasse abliefern. Für die Geistlichen wurden im zweiten
Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundert.
"’-tj
Abb. 36 Inneres des Domes gegen den Sängerchor.
nicht vergaß und der Baukassa für den Umbau ungefähr ein Drittel des Vermögens, nämlich
20.000 fl. zufielen.
Der neue Fürstbischof Leopold Graf Spaur zeigte trotz seines großen Interesses anfangs
wenig Lust, das Beispiel seines Vorgängers nachzuahmen, und man wird auch zugeben
müssen, daß er zu Beginn seiner Regierung wesentlich schwerer tat, als Künigl, der schon
mehr als 40 Jahre auf dem Bischofs- und Fürstenthrone gesessen hatte. Aber als das
Küniglsche Legat aufgebraucht war und die Mittel zum Bau auch sonst spärlicher zu
fließen begannen, brachten die anwesenden Domherren diese Frage in der Baukonferenz
offen zur Sprache und nach einem heftigen und peinlichen Auftritte erklärte sich schließlich
auch Fürstbischof Leopold bereit, jährlich aus seinen Kammergefällen 3500 fl. bereitzustellen.
Neben diesen bedeutenden Spenden der Fürstbischöfe war die Diözesansteuer die
wichtigste Quelle der Geldbeschaffung. Nach dem Kirchenrechte steht es dem Bischof
zu, bei außerordentlichen Bedürfnissen, die der ganzen Diözese dienen, das Kirchengut und
Benefizialeinkommen seines Sprengels zu besteuern. Das geschah nun auch in Brixen und
schon im Mai 1745 wurde diese Steuer ausgeschrieben. Alle Kirchen und Bruderschaften
sollten für die Dauer des Baues, die auf 5 — 6 Jahre berechnet wurde, den Aktivrest der
jährlichen Kirchenrechnungen, soweit er nicht für die Deckung eigener Bedürfnisse
erforderlich war, der Dombaukasse abliefern. Für die Geistlichen wurden im zweiten