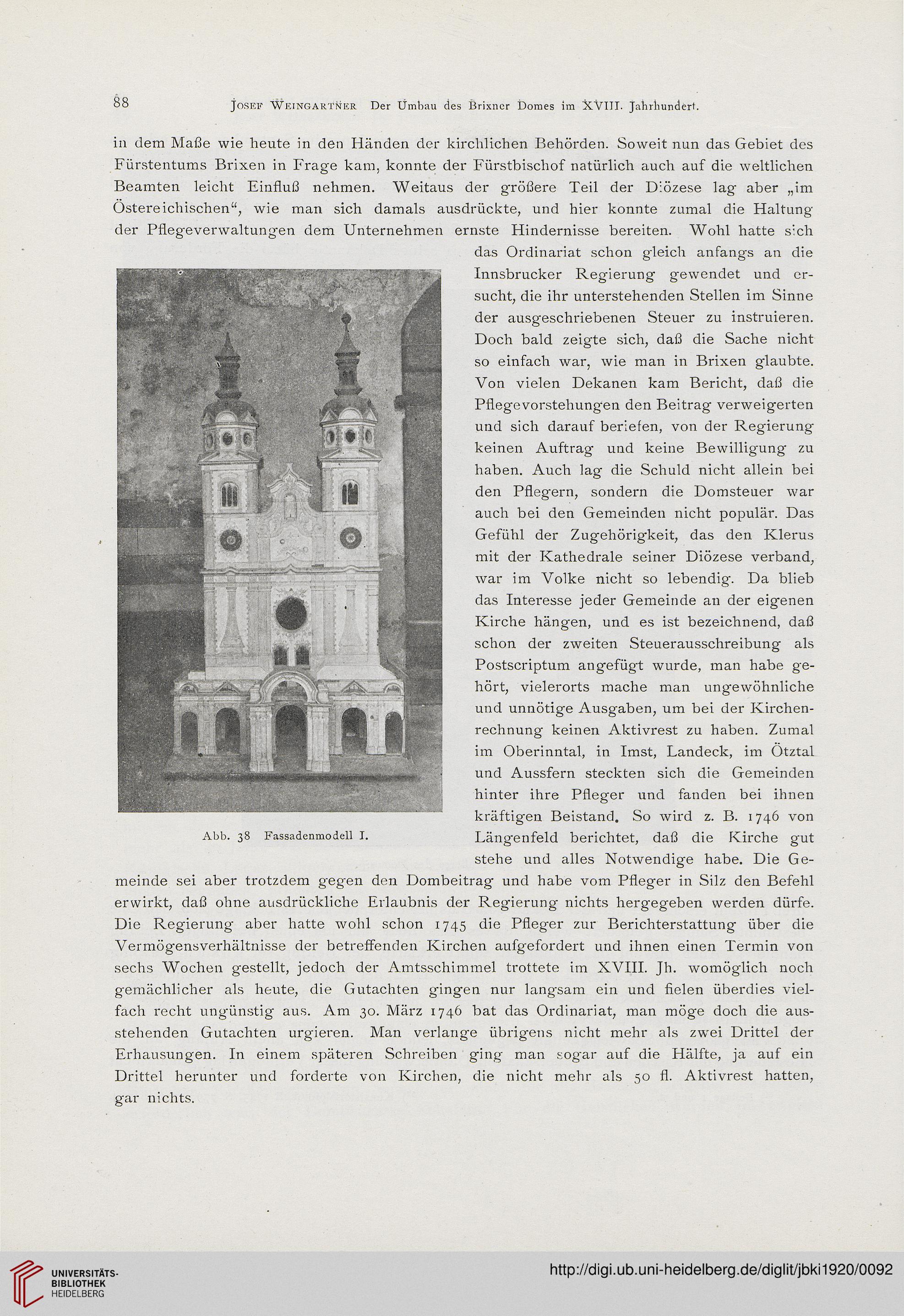88
Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVlIT. Jahrhundert.
in dem Maße wie heute in den Händen der kirchlichen Behörden. Soweit nun das Gebiet des
Fürstentums Brixen in Frage kam, konnte der Fürstbischof natürlich auch auf die weltlichen
Beamten leicht Einfluß nehmen. Weitaus der größere Teil der Diözese lag aber „im
Östereichischen“, wie man sich damals ausdrückte, und hier konnte zumal die Haltung
der Pflegeverwaltungen dem Unternehmen ernste Hindernisse bereiten. Wohl hatte sich
das Ordinariat schon gleich anfangs an die
Innsbrucker Regierung gewendet und er-
sucht, die ihr unterstehenden Stellen im Sinne
der ausgeschriebenen Steuer zu instruieren.
Doch bald zeigte sich, daß die Sache nicht
so einfach war, wie man in Brixen glaubte.
Von vielen Dekanen kam Bericht, daß die
Pflegevorstehungen den Beitrag verweigerten
und sich darauf beriefen, von der Regierung
keinen Auftrag und keine Bewilligung zu
haben. Auch lag die Schuld nicht allein bei
den Pflegern, sondern die Domsteuer war
auch bei den Gemeinden nicht populär. Das
Gefühl der Zugehörigkeit, das den Klerus
mit der Kathedrale seiner Diözese verband,
war im Volke nicht so lebendig. Da blieb
das Interesse jeder Gemeinde an der eigenen
Kirche hängen, und es ist bezeichnend, daß
schon der zweiten Steuerausschreibung als
Postscriptum angefügt wurde, man habe ge-
hört, vielerorts mache man ungewöhnliche
und unnötige Ausgaben, um bei der Kirchen-
rechnung keinen Aktivrest zu haben. Zumal
im Oberinntal, in Imst, Landeck, im Otztal
und Aussfern steckten sich die Gemeinden
hinter ihre Pfleger und fanden bei ihnen
kräftigen Beistand. So wird z. B. 1746 von
Längenfeld berichtet, daß die Kirche gut
stehe und alles Notwendige habe. Die Ge-
meinde sei aber trotzdem gegen den Dombeitrag und habe vom Pfleger in Silz den Befehl
erwirkt, daß ohne ausdrückliche Erlaubnis der Regierung nichts hergegeben werden dürfe.
Die Regierung aber hatte wohl schon 1745 die Pfleger zur Berichterstattung über die
Vermögensverhältnisse der betreffenden Kirchen aufgefordert und ihnen einen Termin von
sechs Wochen gestellt, jedoch der Amtsschimmel trottete im XVIII. Jh. womöglich noch
gemächlicher als heute, die Gutachten gingen nur langsam ein und fielen überdies viel-
fach recht ungünstig aus. Am 30. März 1746 bat das Ordinariat, man möge doch die aus-
stehenden Gutachten urgieren. Man verlange übrigens nicht mehr als zwei Drittel der
Erhausungen. In einem späteren Schreiben ging man sogar auf die Hälfte, ja auf ein
Drittel herunter und forderte von Kirchen, die nicht mehr als 50 fl. Aktivrest hatten,
gar nichts.
Abb. 38 Fassadenmodell I.
Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVlIT. Jahrhundert.
in dem Maße wie heute in den Händen der kirchlichen Behörden. Soweit nun das Gebiet des
Fürstentums Brixen in Frage kam, konnte der Fürstbischof natürlich auch auf die weltlichen
Beamten leicht Einfluß nehmen. Weitaus der größere Teil der Diözese lag aber „im
Östereichischen“, wie man sich damals ausdrückte, und hier konnte zumal die Haltung
der Pflegeverwaltungen dem Unternehmen ernste Hindernisse bereiten. Wohl hatte sich
das Ordinariat schon gleich anfangs an die
Innsbrucker Regierung gewendet und er-
sucht, die ihr unterstehenden Stellen im Sinne
der ausgeschriebenen Steuer zu instruieren.
Doch bald zeigte sich, daß die Sache nicht
so einfach war, wie man in Brixen glaubte.
Von vielen Dekanen kam Bericht, daß die
Pflegevorstehungen den Beitrag verweigerten
und sich darauf beriefen, von der Regierung
keinen Auftrag und keine Bewilligung zu
haben. Auch lag die Schuld nicht allein bei
den Pflegern, sondern die Domsteuer war
auch bei den Gemeinden nicht populär. Das
Gefühl der Zugehörigkeit, das den Klerus
mit der Kathedrale seiner Diözese verband,
war im Volke nicht so lebendig. Da blieb
das Interesse jeder Gemeinde an der eigenen
Kirche hängen, und es ist bezeichnend, daß
schon der zweiten Steuerausschreibung als
Postscriptum angefügt wurde, man habe ge-
hört, vielerorts mache man ungewöhnliche
und unnötige Ausgaben, um bei der Kirchen-
rechnung keinen Aktivrest zu haben. Zumal
im Oberinntal, in Imst, Landeck, im Otztal
und Aussfern steckten sich die Gemeinden
hinter ihre Pfleger und fanden bei ihnen
kräftigen Beistand. So wird z. B. 1746 von
Längenfeld berichtet, daß die Kirche gut
stehe und alles Notwendige habe. Die Ge-
meinde sei aber trotzdem gegen den Dombeitrag und habe vom Pfleger in Silz den Befehl
erwirkt, daß ohne ausdrückliche Erlaubnis der Regierung nichts hergegeben werden dürfe.
Die Regierung aber hatte wohl schon 1745 die Pfleger zur Berichterstattung über die
Vermögensverhältnisse der betreffenden Kirchen aufgefordert und ihnen einen Termin von
sechs Wochen gestellt, jedoch der Amtsschimmel trottete im XVIII. Jh. womöglich noch
gemächlicher als heute, die Gutachten gingen nur langsam ein und fielen überdies viel-
fach recht ungünstig aus. Am 30. März 1746 bat das Ordinariat, man möge doch die aus-
stehenden Gutachten urgieren. Man verlange übrigens nicht mehr als zwei Drittel der
Erhausungen. In einem späteren Schreiben ging man sogar auf die Hälfte, ja auf ein
Drittel herunter und forderte von Kirchen, die nicht mehr als 50 fl. Aktivrest hatten,
gar nichts.
Abb. 38 Fassadenmodell I.