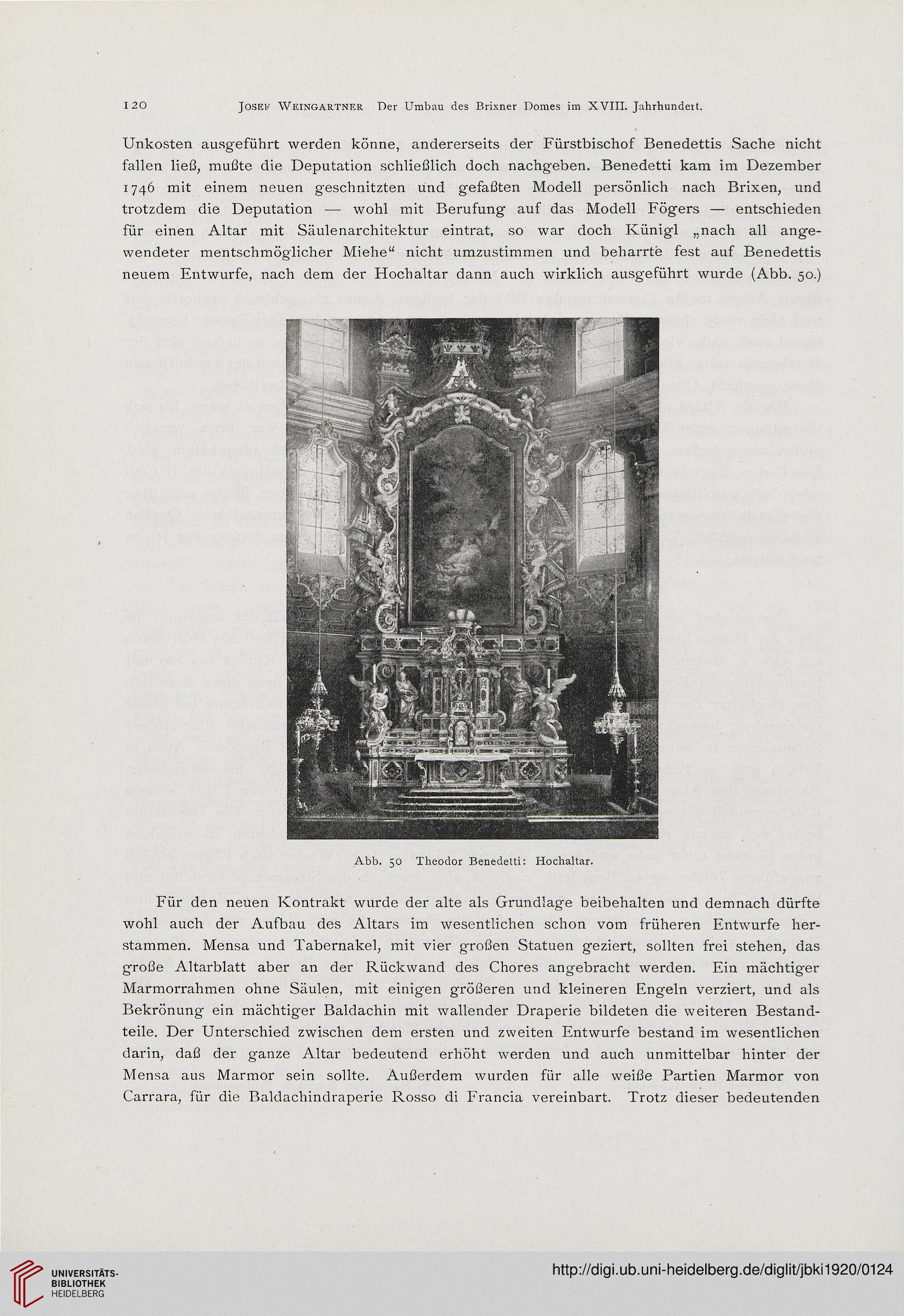I 20
Josef Weingartner Der Umbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundeit.
Unkosten ausgeführt werden könne, andererseits der Fürstbischof Benedettis Sache nicht
fallen ließ, mußte die Deputation schließlich doch nachgeben. Benedetti kam im Dezember
1746 mit einem neuen geschnitzten und gefaßten Modell persönlich nach Brixen, und
trotzdem die Deputation — wohl mit Berufung auf das Modell Fögers — entschieden
für einen Altar mit Säulenarchitektur eintrat, so war doch Künigl „nach all ange-
wendeter mentschmöglicher Miehe“ nicht umzustimmen und beharrte fest auf Benedettis
neuem Entwürfe, nach dem der Hochaltar dann auch wirklich ausgeführt wurde (Abb. 50.)
Abb. 50 Theodor Benedetti: Hochaltar.
Für den neuen Kontrakt wurde der alte als Grundlage beibehalten und demnach dürfte
wohl auch der Aufbau des Altars im wesentlichen schon vom früheren Entwürfe her-
stammen. Mensa und Tabernakel, mit vier großen Statuen geziert, sollten frei stehen, das
große Altarblatt aber an der Rückwand des Chores angebracht werden. Ein mächtiger
Marmorrahmen ohne Säulen, mit einigen größeren und kleineren Engeln verziert, und als
Bekrönung ein mächtiger Baldachin mit wallender Draperie bildeten die weiteren Bestand-
teile. Der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Entwürfe bestand im wesentlichen
darin, daß der ganze Altar bedeutend erhöht werden und auch unmittelbar hinter der
Mensa aus Marmor sein sollte. Außerdem wurden für alle weiße Partien Marmor von
Carrara, für die Baldachindraperie Rosso di Francia vereinbart. Trotz dieser bedeutenden
Josef Weingartner Der Umbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundeit.
Unkosten ausgeführt werden könne, andererseits der Fürstbischof Benedettis Sache nicht
fallen ließ, mußte die Deputation schließlich doch nachgeben. Benedetti kam im Dezember
1746 mit einem neuen geschnitzten und gefaßten Modell persönlich nach Brixen, und
trotzdem die Deputation — wohl mit Berufung auf das Modell Fögers — entschieden
für einen Altar mit Säulenarchitektur eintrat, so war doch Künigl „nach all ange-
wendeter mentschmöglicher Miehe“ nicht umzustimmen und beharrte fest auf Benedettis
neuem Entwürfe, nach dem der Hochaltar dann auch wirklich ausgeführt wurde (Abb. 50.)
Abb. 50 Theodor Benedetti: Hochaltar.
Für den neuen Kontrakt wurde der alte als Grundlage beibehalten und demnach dürfte
wohl auch der Aufbau des Altars im wesentlichen schon vom früheren Entwürfe her-
stammen. Mensa und Tabernakel, mit vier großen Statuen geziert, sollten frei stehen, das
große Altarblatt aber an der Rückwand des Chores angebracht werden. Ein mächtiger
Marmorrahmen ohne Säulen, mit einigen größeren und kleineren Engeln verziert, und als
Bekrönung ein mächtiger Baldachin mit wallender Draperie bildeten die weiteren Bestand-
teile. Der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Entwürfe bestand im wesentlichen
darin, daß der ganze Altar bedeutend erhöht werden und auch unmittelbar hinter der
Mensa aus Marmor sein sollte. Außerdem wurden für alle weiße Partien Marmor von
Carrara, für die Baldachindraperie Rosso di Francia vereinbart. Trotz dieser bedeutenden