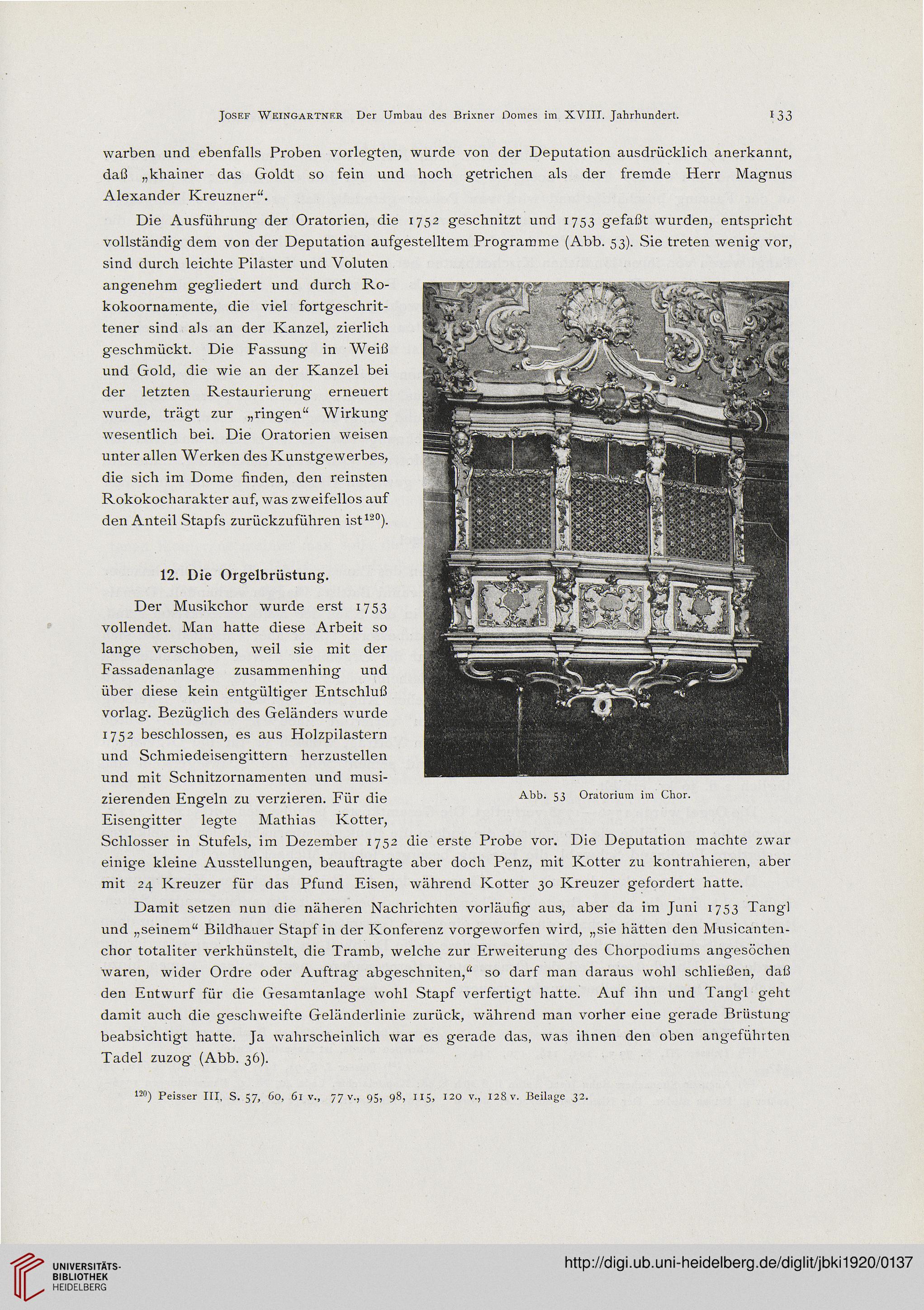Josef Weingartner Der Umbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundert.
1 33
warben und ebenfalls Proben vorlegten, wurde von der Deputation ausdrücklich anerkannt,
daß „khainer das Goldt so fein und hoch getrieben als der fremde Herr Magnus
Alexander Kreuzner“.
Die Ausführung der Oratorien, die 1752 geschnitzt und 1753 gefaßt wurden, entspricht
vollständig dem von der Deputation aufgestelltem Programme (Abb. 53). Sie treten wenig vor,
sind durch leichte Pilaster und Voluten
angenehm gegliedert und durch Ro-
kokoornamente, die viel fortgeschrit-
tener sind als an der Kanzel, zierlich
geschmückt. Die Fassung in Weiß
und Gold, die wie an der Kanzel bei
der letzten Restaurierung erneuert
wurde, trägt zur „ringen“ Wirkung
wesentlich bei. Die Oratorien weisen
unter allen Werken des Kunstgewerbes,
die sich im Dome finden, den reinsten
Rokokocharakter auf, was zweifellos auf
den Anteil Stapfs zurückzuführen ist120).
12. Die Orgelbrüstung.
Der Musikchor wurde erst 1753
vollendet. Man hatte diese Arbeit so
lange verschoben, weil sie mit der
Fassadenanlage zusammenhing und
über diese kein entgültiger Entschluß
vorlag. Bezüglich des Geländers wurde
1752 beschlossen, es aus Holzpilastern
und Schmiedeisengittern herzustellen
und mit Schnitzornamenten und musi-
zierenden Engeln zu verzieren. Für die
Eisengitter legte Mathias Kotter,
Schlosser in Stufeis, im Dezember 1752 die erste Probe vor. Die Deputation machte zwar
einige kleine Ausstellungen, beauftragte aber doch Penz, mit Kotter zu kontrahieren, aber
mit 24 Kreuzer für das Pfund Eisen, während Kotter 30 Kreuzer gefordert hatte.
Damit setzen nun die näheren Nachrichten vorläufig aus, aber da im Juni 1753 Tangl
und „seinem“ Bildhauer Stapf in der Konferenz vorgeworfen wird, „sie hätten den Musicanten-
chor totaliter verkhünstelt, die Tramb, welche zur Erweiterung des Chorpodiums angesöchen
waren, wider Ordre oder Auftrag abgeschniten,“ so darf man daraus wohl schließen, daß
den Entwurf für die Gesamtanlage wohl Stapf verfertigt hatte. Auf ihn und Tangl geht
damit auch die geschweifte Geländerlinie zurück, während man vorher eine gerade Brüstung
beabsichtigt hatte. Ja wahrscheinlich war es gerade das, was ihnen den oben angeführten
Tadel zuzog (Abb. 36).
12°) Peisser III, S. 57, 60, 61 v., 77 v., 95, 98, 115, 120 v., 128 v. Beilage 32.
Abb. 53 Oratorium im Chor.
1 33
warben und ebenfalls Proben vorlegten, wurde von der Deputation ausdrücklich anerkannt,
daß „khainer das Goldt so fein und hoch getrieben als der fremde Herr Magnus
Alexander Kreuzner“.
Die Ausführung der Oratorien, die 1752 geschnitzt und 1753 gefaßt wurden, entspricht
vollständig dem von der Deputation aufgestelltem Programme (Abb. 53). Sie treten wenig vor,
sind durch leichte Pilaster und Voluten
angenehm gegliedert und durch Ro-
kokoornamente, die viel fortgeschrit-
tener sind als an der Kanzel, zierlich
geschmückt. Die Fassung in Weiß
und Gold, die wie an der Kanzel bei
der letzten Restaurierung erneuert
wurde, trägt zur „ringen“ Wirkung
wesentlich bei. Die Oratorien weisen
unter allen Werken des Kunstgewerbes,
die sich im Dome finden, den reinsten
Rokokocharakter auf, was zweifellos auf
den Anteil Stapfs zurückzuführen ist120).
12. Die Orgelbrüstung.
Der Musikchor wurde erst 1753
vollendet. Man hatte diese Arbeit so
lange verschoben, weil sie mit der
Fassadenanlage zusammenhing und
über diese kein entgültiger Entschluß
vorlag. Bezüglich des Geländers wurde
1752 beschlossen, es aus Holzpilastern
und Schmiedeisengittern herzustellen
und mit Schnitzornamenten und musi-
zierenden Engeln zu verzieren. Für die
Eisengitter legte Mathias Kotter,
Schlosser in Stufeis, im Dezember 1752 die erste Probe vor. Die Deputation machte zwar
einige kleine Ausstellungen, beauftragte aber doch Penz, mit Kotter zu kontrahieren, aber
mit 24 Kreuzer für das Pfund Eisen, während Kotter 30 Kreuzer gefordert hatte.
Damit setzen nun die näheren Nachrichten vorläufig aus, aber da im Juni 1753 Tangl
und „seinem“ Bildhauer Stapf in der Konferenz vorgeworfen wird, „sie hätten den Musicanten-
chor totaliter verkhünstelt, die Tramb, welche zur Erweiterung des Chorpodiums angesöchen
waren, wider Ordre oder Auftrag abgeschniten,“ so darf man daraus wohl schließen, daß
den Entwurf für die Gesamtanlage wohl Stapf verfertigt hatte. Auf ihn und Tangl geht
damit auch die geschweifte Geländerlinie zurück, während man vorher eine gerade Brüstung
beabsichtigt hatte. Ja wahrscheinlich war es gerade das, was ihnen den oben angeführten
Tadel zuzog (Abb. 36).
12°) Peisser III, S. 57, 60, 61 v., 77 v., 95, 98, 115, 120 v., 128 v. Beilage 32.
Abb. 53 Oratorium im Chor.