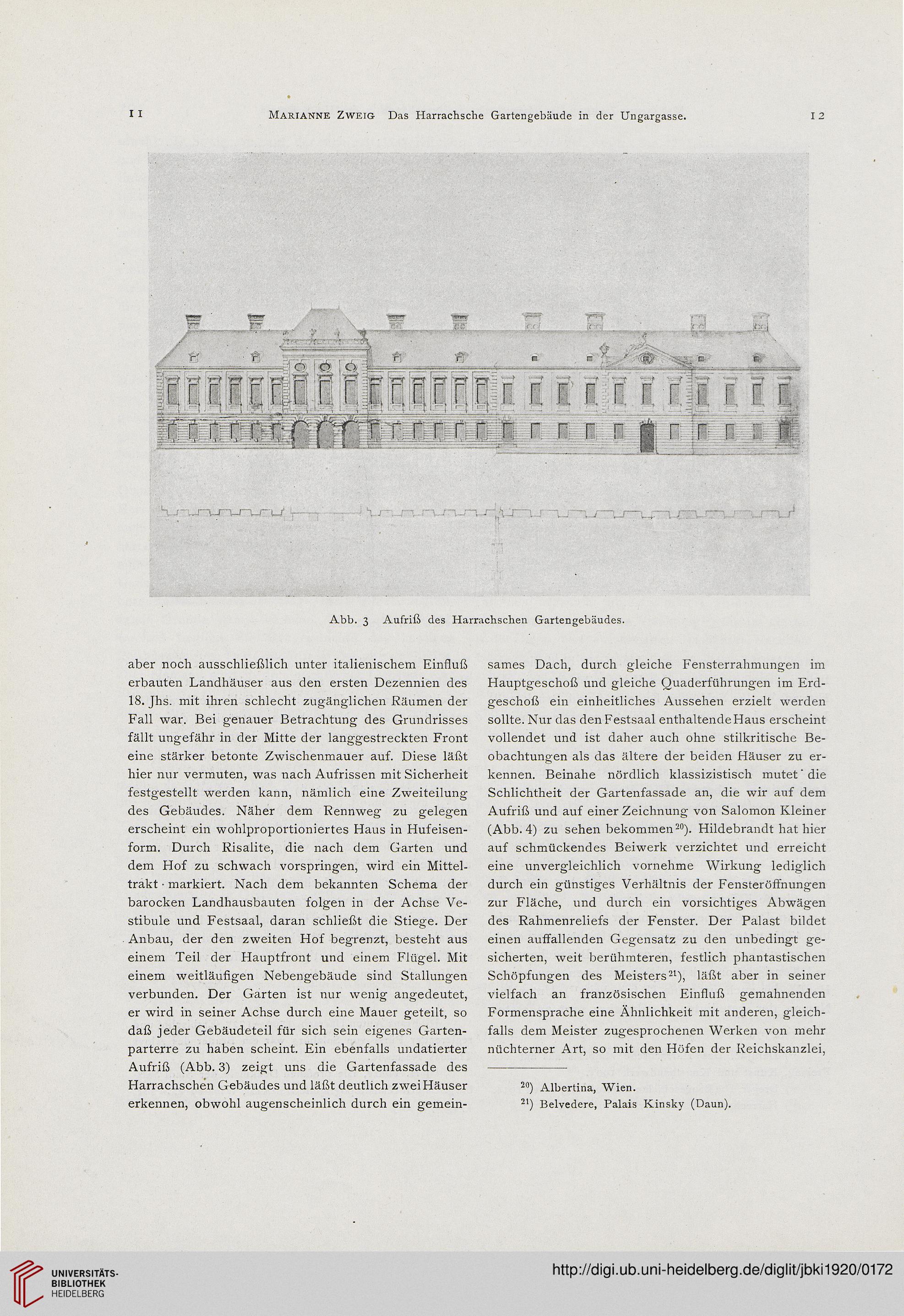Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.
I I
■vj— r ’ . rn~rn~-"T. —LJ
Abb. 3 Aufriß des Harrachschen Gartengebäudes.
aber noch ausschließlich unter italienischem Einfluß
erbauten Landhäuser aus den ersten Dezennien des
18. Jhs. mit ihren schlecht zugänglichen Räumen der
Fall war. Bei genauer Betrachtung des Grundrisses
fällt ungefähr in der Mitte der langgestreckten Front
eine stärker betonte Zwischenmauer auf. Diese läßt
hier nur vermuten, was nach Aufrissen mit Sicherheit
festgestellt werden kann, nämlich eine Zweiteilung
des Gebäudes. Näher dem Rennweg zu gelegen
erscheint ein wohlproportioniertes Haus in Hufeisen-
form. Durch Risalite, die nach dem Garten und
dem Hof zu schwach vorspringen, wird ein Mittel-
trakt • markiert. Nach dem bekannten Schema der
barocken Landhausbauten folgen in der Achse Ve-
stibüle und Festsaal, daran schließt die Stiege. Der
Anbau, der den zweiten Hof begrenzt, besteht aus
einem Teil der Hauptfront und einem Flügel. Mit
einem weitläufigen Nebengebäude sind Stallungen
verbunden. Der Garten ist nur wenig angedeutet,
er wird in seiner Achse durch eine Mauer geteilt, so
daß jeder Gebäudeteil für sich sein eigenes Garten-
parterre zu haben scheint. Ein ebenfalls undatierter
Aufriß (Abb. 3) zeigt uns die Gartenfassade des
Harrachschen Gebäudes und läßt deutlich zwei Häuser
erkennen, obwohl augenscheinlich durch ein gemein-
sames Dach, durch gleiche Fensterrahmungen im
Hauptgeschoß und gleiche Quaderführungen im Erd-
geschoß ein einheitliches Aussehen erzielt werden
sollte. Nur das den Festsaal enthaltende Haus erscheint
vollendet und ist daher auch ohne stilkritische Be-
obachtungen als das ältere der beiden Häuser zu er-
kennen. Beinahe nördlich klassizistisch mutet ‘ die
Schlichtheit der Gartenfassade an, die wir auf dem
Aufriß und auf einer Zeichnung von Salomon Kleiner
(Abb. 4) zu sehen bekommen20). Hildebrandt hat hier
auf schmückendes Beiwerk verzichtet und erreicht
eine unvergleichlich vornehme Wirkung lediglich
durch ein günstiges Verhältnis der Fensteröffnungen
zur Fläche, und durch ein vorsichtiges Abwägen
des Rahmenreliefs der Fenster. Der Palast bildet
einen auffallenden Gegensatz zu den unbedingt ge-
sicherten, weit berühmteren, festlich phantastischen
Schöpfungen des Meisters21), läßt aber in seiner
vielfach an französischen Einfluß gemahnenden
Formensprache eine Ähnlichkeit mit anderen, gleich-
falls dem Meister zugesprochenen Werken von mehr
nüchterner Art, so mit den Höfen der Reichskanzlei,
20) Albertina, Wien.
21) Belvedere, Palais Kinsky (Daun).
I I
■vj— r ’ . rn~rn~-"T. —LJ
Abb. 3 Aufriß des Harrachschen Gartengebäudes.
aber noch ausschließlich unter italienischem Einfluß
erbauten Landhäuser aus den ersten Dezennien des
18. Jhs. mit ihren schlecht zugänglichen Räumen der
Fall war. Bei genauer Betrachtung des Grundrisses
fällt ungefähr in der Mitte der langgestreckten Front
eine stärker betonte Zwischenmauer auf. Diese läßt
hier nur vermuten, was nach Aufrissen mit Sicherheit
festgestellt werden kann, nämlich eine Zweiteilung
des Gebäudes. Näher dem Rennweg zu gelegen
erscheint ein wohlproportioniertes Haus in Hufeisen-
form. Durch Risalite, die nach dem Garten und
dem Hof zu schwach vorspringen, wird ein Mittel-
trakt • markiert. Nach dem bekannten Schema der
barocken Landhausbauten folgen in der Achse Ve-
stibüle und Festsaal, daran schließt die Stiege. Der
Anbau, der den zweiten Hof begrenzt, besteht aus
einem Teil der Hauptfront und einem Flügel. Mit
einem weitläufigen Nebengebäude sind Stallungen
verbunden. Der Garten ist nur wenig angedeutet,
er wird in seiner Achse durch eine Mauer geteilt, so
daß jeder Gebäudeteil für sich sein eigenes Garten-
parterre zu haben scheint. Ein ebenfalls undatierter
Aufriß (Abb. 3) zeigt uns die Gartenfassade des
Harrachschen Gebäudes und läßt deutlich zwei Häuser
erkennen, obwohl augenscheinlich durch ein gemein-
sames Dach, durch gleiche Fensterrahmungen im
Hauptgeschoß und gleiche Quaderführungen im Erd-
geschoß ein einheitliches Aussehen erzielt werden
sollte. Nur das den Festsaal enthaltende Haus erscheint
vollendet und ist daher auch ohne stilkritische Be-
obachtungen als das ältere der beiden Häuser zu er-
kennen. Beinahe nördlich klassizistisch mutet ‘ die
Schlichtheit der Gartenfassade an, die wir auf dem
Aufriß und auf einer Zeichnung von Salomon Kleiner
(Abb. 4) zu sehen bekommen20). Hildebrandt hat hier
auf schmückendes Beiwerk verzichtet und erreicht
eine unvergleichlich vornehme Wirkung lediglich
durch ein günstiges Verhältnis der Fensteröffnungen
zur Fläche, und durch ein vorsichtiges Abwägen
des Rahmenreliefs der Fenster. Der Palast bildet
einen auffallenden Gegensatz zu den unbedingt ge-
sicherten, weit berühmteren, festlich phantastischen
Schöpfungen des Meisters21), läßt aber in seiner
vielfach an französischen Einfluß gemahnenden
Formensprache eine Ähnlichkeit mit anderen, gleich-
falls dem Meister zugesprochenen Werken von mehr
nüchterner Art, so mit den Höfen der Reichskanzlei,
20) Albertina, Wien.
21) Belvedere, Palais Kinsky (Daun).