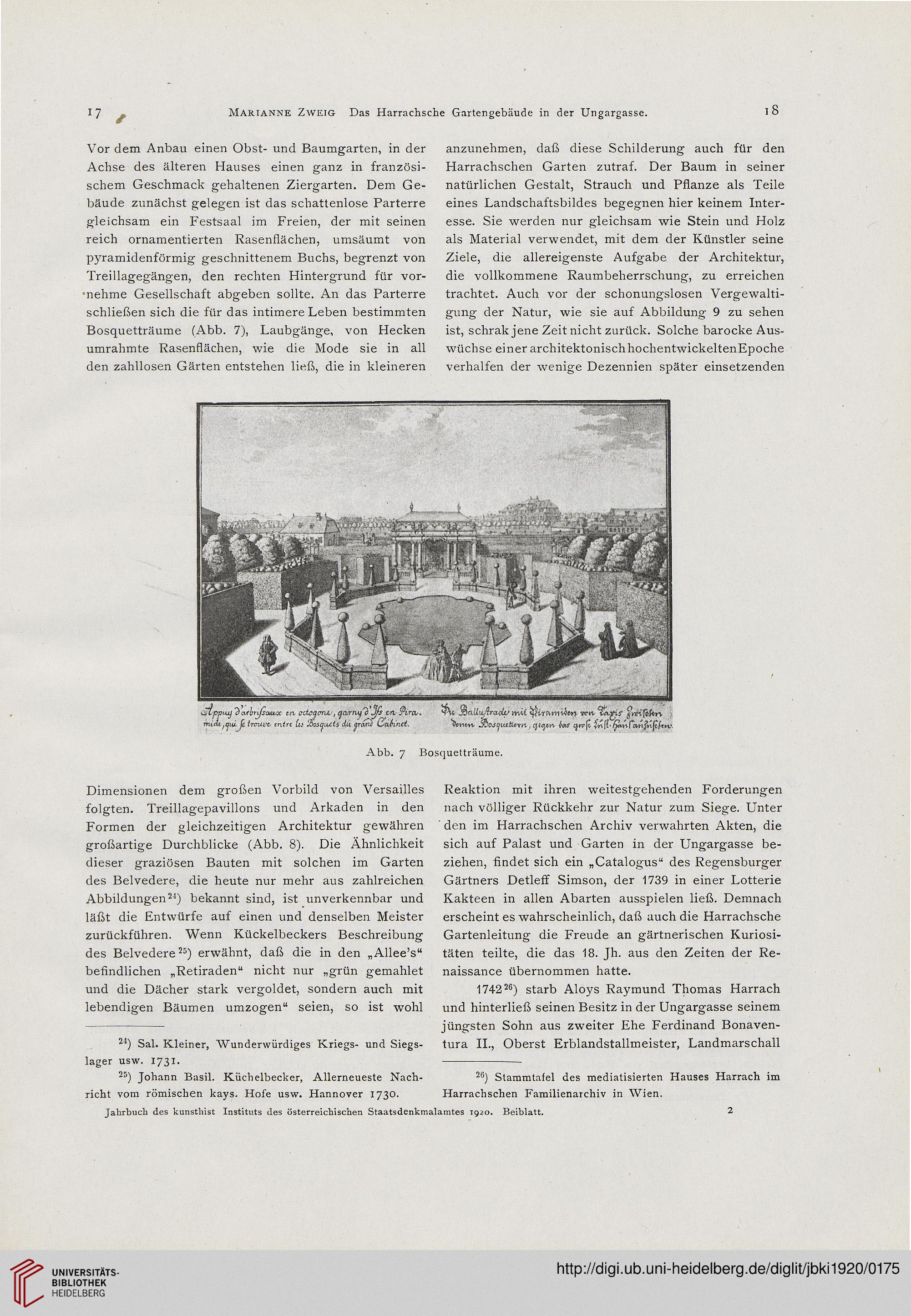i7
Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.
I 8
✓
Vor dem Anbau einen Obst- und Baumgarten, in der
Achse des älteren Hauses einen ganz in französi-
schem Geschmack gehaltenen Ziergarten. Dem Ge-
bäude zunächst gelegen ist das schattenlose Parterre
gleichsam ein Festsaal im Freien, der mit seinen
reich ornamentierten Rasenflächen, umsäumt von
pyramidenförmig geschnittenem Buchs, begrenzt von
Treillagegängen, den rechten Hintergrund für vor-
•nehme Gesellschaft abgeben sollte. An das Parterre
schließen sich die für das intimere Leben bestimmten
Bosquetträume (Abb. 7), Laubgänge, von Hecken
umrahmte Rasenflächen, wie die Mode sie in all
den zahllosen Gärten entstehen ließ, die in kleineren
anzunehmen, daß diese Schilderung auch für den
Harrachschen Garten zutraf. Der Baum in seiner
natürlichen Gestalt, Strauch und Pflanze als Teile
eines Landschaftsbildes begegnen hier keinem Inter-
esse. Sie werden nur gleichsam wie Stein und Holz
als Material verwendet, mit dem der Künstler seine
Ziele, die allereigenste Aufgabe der Architektur,
die vollkommene Raumbeherrschung, zu erreichen
trachtet. Auch vor der schonungslosen Vergewalti-
gung der Natur, wie sie auf Abbildung 9 zu sehen
ist, schrak jene Zeit nicht zurück. Solche barocke Aus-
wüchse einer architektonischhochentwickeltenEpoche
verhalten der wenige Dezennien später einsetzenden
Abb. 7 Bosquetträume.
Dimensionen dem großen Vorbild von Versailles
folgten. Treillagepavillons und Arkaden in den
Formen der gleichzeitigen Architektur gewähren
großartige Durchblicke (Abb. 8). Die Ähnlichkeit
dieser graziösen Bauten mit solchen im Garten
des Belvedere, die heute nur mehr aus zahlreichen
Abbildungen24) bekannt sind, ist unverkennbar und
läßt die Entwürfe auf einen und denselben Meister
zurückführen. Wenn Kückelbeckers Beschreibung
des Belvedere25) erwähnt, daß die in den „Allee’s“
befindlichen „Retiraden“ nicht nur „grün gemahlet
und die Dächer stark vergoldet, sondern auch mit
lebendigen Bäumen umzogen“ seien, so ist wohl
2)) Sal. Kleiner, Wunderwürdiges Kriegs- und Siegs-
lager usw. 1731.
25) Johann Basil. Küchelbecker, Allerneueste Nach-
richt vom römischen kays. Hofe usw. Hannover 1730.
Reaktion mit ihren weitestgehenden Forderungen
nach völliger Rückkehr zur Natur zum Siege. Unter
den im Harrachschen Archiv verwahrten Akten, die
sich auf Palast und Garten in der Ungargasse be-
ziehen, findet sich ein „Catalogus“ des Regensburger
Gärtners Detleff Simson, der 1739 in einer Lotterie
Kakteen in allen Abarten ausspielen ließ. Demnach
erscheint es wahrscheinlich, daß auch die Harrachsche
Gartenleitung die Freude an gärtnerischen Kuriosi-
täten teilte, die das 18. Jh. aus den Zeiten der Re-
naissance übernommen hatte.
174326) starb Aloys Raymund Thomas Harrach
und hinterließ seinen Besitz in der Ungargasse seinem
jüngsten Sohn aus zweiter Ehe Ferdinand Bonaven-
tura II., Oberst Erblandstallmeister, Landmarschall
26) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach im
Harrachschen Familienarchiv in Wien.
Jahrbuch des kunsthist Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920. Beiblatt.
2
Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.
I 8
✓
Vor dem Anbau einen Obst- und Baumgarten, in der
Achse des älteren Hauses einen ganz in französi-
schem Geschmack gehaltenen Ziergarten. Dem Ge-
bäude zunächst gelegen ist das schattenlose Parterre
gleichsam ein Festsaal im Freien, der mit seinen
reich ornamentierten Rasenflächen, umsäumt von
pyramidenförmig geschnittenem Buchs, begrenzt von
Treillagegängen, den rechten Hintergrund für vor-
•nehme Gesellschaft abgeben sollte. An das Parterre
schließen sich die für das intimere Leben bestimmten
Bosquetträume (Abb. 7), Laubgänge, von Hecken
umrahmte Rasenflächen, wie die Mode sie in all
den zahllosen Gärten entstehen ließ, die in kleineren
anzunehmen, daß diese Schilderung auch für den
Harrachschen Garten zutraf. Der Baum in seiner
natürlichen Gestalt, Strauch und Pflanze als Teile
eines Landschaftsbildes begegnen hier keinem Inter-
esse. Sie werden nur gleichsam wie Stein und Holz
als Material verwendet, mit dem der Künstler seine
Ziele, die allereigenste Aufgabe der Architektur,
die vollkommene Raumbeherrschung, zu erreichen
trachtet. Auch vor der schonungslosen Vergewalti-
gung der Natur, wie sie auf Abbildung 9 zu sehen
ist, schrak jene Zeit nicht zurück. Solche barocke Aus-
wüchse einer architektonischhochentwickeltenEpoche
verhalten der wenige Dezennien später einsetzenden
Abb. 7 Bosquetträume.
Dimensionen dem großen Vorbild von Versailles
folgten. Treillagepavillons und Arkaden in den
Formen der gleichzeitigen Architektur gewähren
großartige Durchblicke (Abb. 8). Die Ähnlichkeit
dieser graziösen Bauten mit solchen im Garten
des Belvedere, die heute nur mehr aus zahlreichen
Abbildungen24) bekannt sind, ist unverkennbar und
läßt die Entwürfe auf einen und denselben Meister
zurückführen. Wenn Kückelbeckers Beschreibung
des Belvedere25) erwähnt, daß die in den „Allee’s“
befindlichen „Retiraden“ nicht nur „grün gemahlet
und die Dächer stark vergoldet, sondern auch mit
lebendigen Bäumen umzogen“ seien, so ist wohl
2)) Sal. Kleiner, Wunderwürdiges Kriegs- und Siegs-
lager usw. 1731.
25) Johann Basil. Küchelbecker, Allerneueste Nach-
richt vom römischen kays. Hofe usw. Hannover 1730.
Reaktion mit ihren weitestgehenden Forderungen
nach völliger Rückkehr zur Natur zum Siege. Unter
den im Harrachschen Archiv verwahrten Akten, die
sich auf Palast und Garten in der Ungargasse be-
ziehen, findet sich ein „Catalogus“ des Regensburger
Gärtners Detleff Simson, der 1739 in einer Lotterie
Kakteen in allen Abarten ausspielen ließ. Demnach
erscheint es wahrscheinlich, daß auch die Harrachsche
Gartenleitung die Freude an gärtnerischen Kuriosi-
täten teilte, die das 18. Jh. aus den Zeiten der Re-
naissance übernommen hatte.
174326) starb Aloys Raymund Thomas Harrach
und hinterließ seinen Besitz in der Ungargasse seinem
jüngsten Sohn aus zweiter Ehe Ferdinand Bonaven-
tura II., Oberst Erblandstallmeister, Landmarschall
26) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach im
Harrachschen Familienarchiv in Wien.
Jahrbuch des kunsthist Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920. Beiblatt.
2