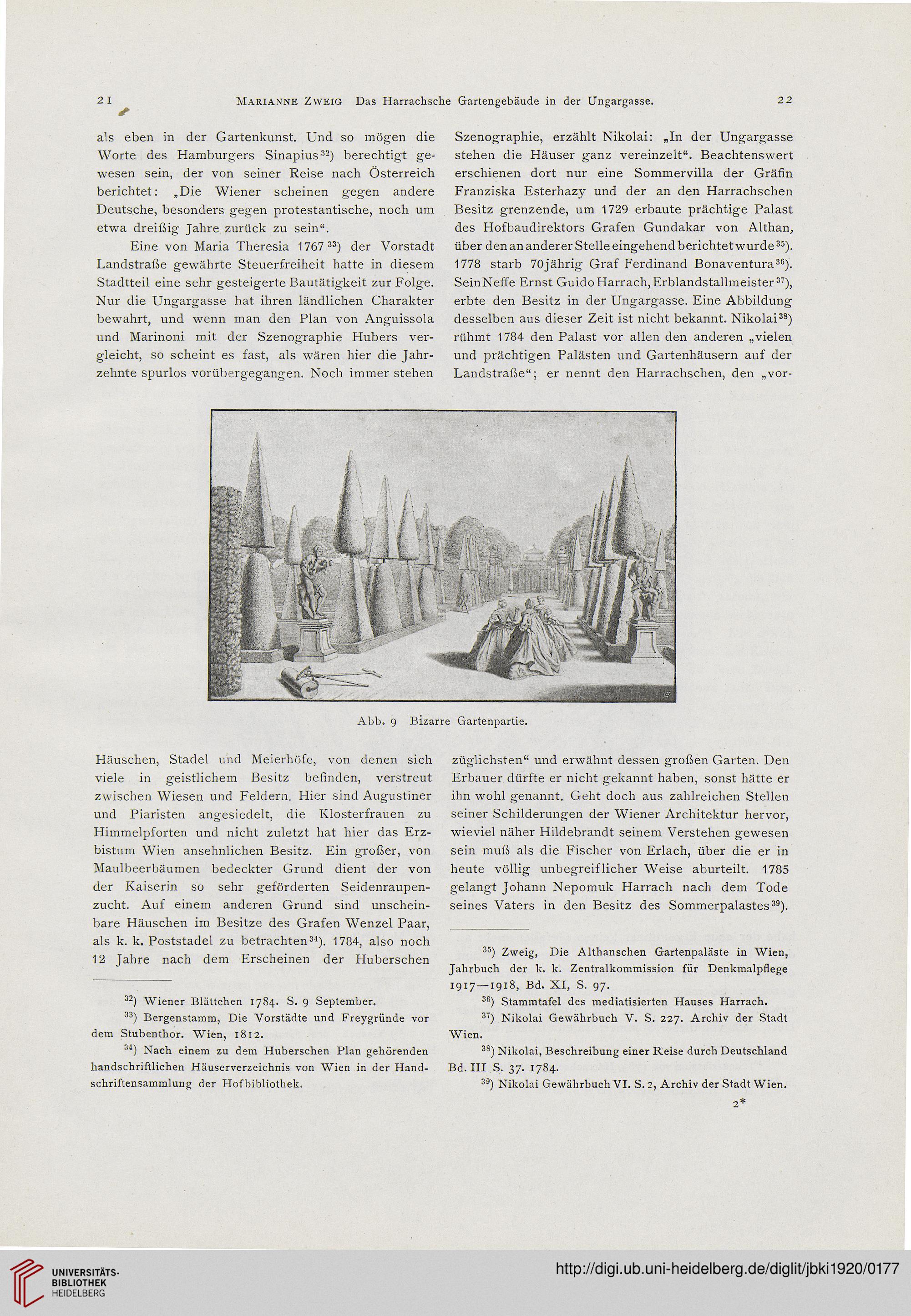Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.
22
2 I
S
als eben in der Gartenkunst. Und so mögen die
Worte des Hamburgers Sinapius32) berechtigt ge-
wesen sein, der von seiner Reise nach Österreich
berichtet: „Die Wiener scheinen gegen andere
Deutsche, besonders gegen protestantische, noch um
etwa dreißig Jahre zurück zu sein“.
Eine von Maria Theresia 1767 33) der Vorstadt
Landstraße gewährte Steuerfreiheit hatte in diesem
Stadtteil eine sehr gesteigerte Bautätigkeit zur Folge.
Nur die Ungargasse hat ihren ländlichen Charakter
bewahrt, und wenn man den Plan von Anguissola
und Marinoni mit der Szenographie Hubers ver-
gleicht, so scheint es fast, als wären hier die Jahr-
zehnte spurlos vorübergegangen. Noch immer stehen
Szenographie, erzählt Nikolai: „In der Ungargasse
stehen die Häuser ganz vereinzelt“. Beachtenswert
erschienen dort nur eine Sommervilla der Gräfin
Franziska Esterhazy und der an den Harrachschen
Besitz grenzende, um 1729 erbaute prächtige Palast
des Hofbaudirektors Grafen Gundakar von Althan,
über den an anderer Stelle eingehend berichtet wurde35).
1778 starb 70jährig Graf Ferdinand Bonaventura36).
SeinNeffe Ernst Guido Harrach, Erblandstallmeister37),
erbte den Besitz in der Ungargasse. Eine Abbildung
desselben aus dieser Zeit ist nicht bekannt. Nikolai38)
rühmt 178+ den Palast vor allen den anderen „vielen
und prächtigen Palästen und Gartenhäusern auf der
Landstraße“; er nennt den Harrachschen, den „vor-
Abb. 9 Bizarre Gartenpartie.
Häuschen, Stadel und Meierhöfe, von denen sich
viele in geistlichem Besitz befinden, verstreut
zwischen Wiesen und Feldern. Hier sind Augustiner
und Piaristen angesiedelt, die Klosterfrauen zu
Himmelpforten und nicht zuletzt hat hier das Erz-
bistum Wien ansehnlichen Besitz. Ein großer, von
Maulbeerbäumen bedeckter Grund dient der von
der Kaiserin so sehr geförderten Seidenraupen-
zucht. Auf einem anderen Grund sind unschein-
bare Häuschen im Besitze des Grafen Wenzel Paar,
als k. k. Poststadel zu betrachten34). 178+, also noch
12 Jahre nach dem Erscheinen der Huberschen
32) Wiener Blättchen 1784. S. 9 September.
33) Bergenstamm, Die Vorstädte und Freygründe vor
dem Stubenthor. Wien, 1812.
34) Nach einem zu dem Huberschen Plan gehörenden
handschriftlichen Häuserverzeichnis von Wien in der Hand-
schriftensammlung der Hofbibliothek.
züglichsten“ und erwähnt dessen großen Garten. Den
Erbauer dürfte er nicht gekannt haben, sonst hätte er
ihn wohl genannt. Geht doch aus zahlreichen Stellen
seiner Schilderungen der Wiener Architektur hervor,
wieviel näher Hildebrandt seinem Verstehen gewesen
sein muß als die Fischer von Erlach, über die er in
heute völlig unbegreiflicher Weise aburteilt. 1785
gelangt Johann Nepomuk Harrach nach dem Tode
seines Vaters in den Besitz des Sommerpalastes39).
35) Zweig, Die Althanschen Gartenpaläste in Wien,
Jahrbuch der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege
1917—1918, Bd. XI, S. 97.
36) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach.
3‘) Nikolai Gewährbuch V. S. 227. Archiv der Stadt
Wien.
38) Nikolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland
Bd. III S. 37. 1784.
39) Nikolai GewährbuchVI. S. 2, Archiv der Stadt Wien.
2:
22
2 I
S
als eben in der Gartenkunst. Und so mögen die
Worte des Hamburgers Sinapius32) berechtigt ge-
wesen sein, der von seiner Reise nach Österreich
berichtet: „Die Wiener scheinen gegen andere
Deutsche, besonders gegen protestantische, noch um
etwa dreißig Jahre zurück zu sein“.
Eine von Maria Theresia 1767 33) der Vorstadt
Landstraße gewährte Steuerfreiheit hatte in diesem
Stadtteil eine sehr gesteigerte Bautätigkeit zur Folge.
Nur die Ungargasse hat ihren ländlichen Charakter
bewahrt, und wenn man den Plan von Anguissola
und Marinoni mit der Szenographie Hubers ver-
gleicht, so scheint es fast, als wären hier die Jahr-
zehnte spurlos vorübergegangen. Noch immer stehen
Szenographie, erzählt Nikolai: „In der Ungargasse
stehen die Häuser ganz vereinzelt“. Beachtenswert
erschienen dort nur eine Sommervilla der Gräfin
Franziska Esterhazy und der an den Harrachschen
Besitz grenzende, um 1729 erbaute prächtige Palast
des Hofbaudirektors Grafen Gundakar von Althan,
über den an anderer Stelle eingehend berichtet wurde35).
1778 starb 70jährig Graf Ferdinand Bonaventura36).
SeinNeffe Ernst Guido Harrach, Erblandstallmeister37),
erbte den Besitz in der Ungargasse. Eine Abbildung
desselben aus dieser Zeit ist nicht bekannt. Nikolai38)
rühmt 178+ den Palast vor allen den anderen „vielen
und prächtigen Palästen und Gartenhäusern auf der
Landstraße“; er nennt den Harrachschen, den „vor-
Abb. 9 Bizarre Gartenpartie.
Häuschen, Stadel und Meierhöfe, von denen sich
viele in geistlichem Besitz befinden, verstreut
zwischen Wiesen und Feldern. Hier sind Augustiner
und Piaristen angesiedelt, die Klosterfrauen zu
Himmelpforten und nicht zuletzt hat hier das Erz-
bistum Wien ansehnlichen Besitz. Ein großer, von
Maulbeerbäumen bedeckter Grund dient der von
der Kaiserin so sehr geförderten Seidenraupen-
zucht. Auf einem anderen Grund sind unschein-
bare Häuschen im Besitze des Grafen Wenzel Paar,
als k. k. Poststadel zu betrachten34). 178+, also noch
12 Jahre nach dem Erscheinen der Huberschen
32) Wiener Blättchen 1784. S. 9 September.
33) Bergenstamm, Die Vorstädte und Freygründe vor
dem Stubenthor. Wien, 1812.
34) Nach einem zu dem Huberschen Plan gehörenden
handschriftlichen Häuserverzeichnis von Wien in der Hand-
schriftensammlung der Hofbibliothek.
züglichsten“ und erwähnt dessen großen Garten. Den
Erbauer dürfte er nicht gekannt haben, sonst hätte er
ihn wohl genannt. Geht doch aus zahlreichen Stellen
seiner Schilderungen der Wiener Architektur hervor,
wieviel näher Hildebrandt seinem Verstehen gewesen
sein muß als die Fischer von Erlach, über die er in
heute völlig unbegreiflicher Weise aburteilt. 1785
gelangt Johann Nepomuk Harrach nach dem Tode
seines Vaters in den Besitz des Sommerpalastes39).
35) Zweig, Die Althanschen Gartenpaläste in Wien,
Jahrbuch der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege
1917—1918, Bd. XI, S. 97.
36) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach.
3‘) Nikolai Gewährbuch V. S. 227. Archiv der Stadt
Wien.
38) Nikolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland
Bd. III S. 37. 1784.
39) Nikolai GewährbuchVI. S. 2, Archiv der Stadt Wien.
2: