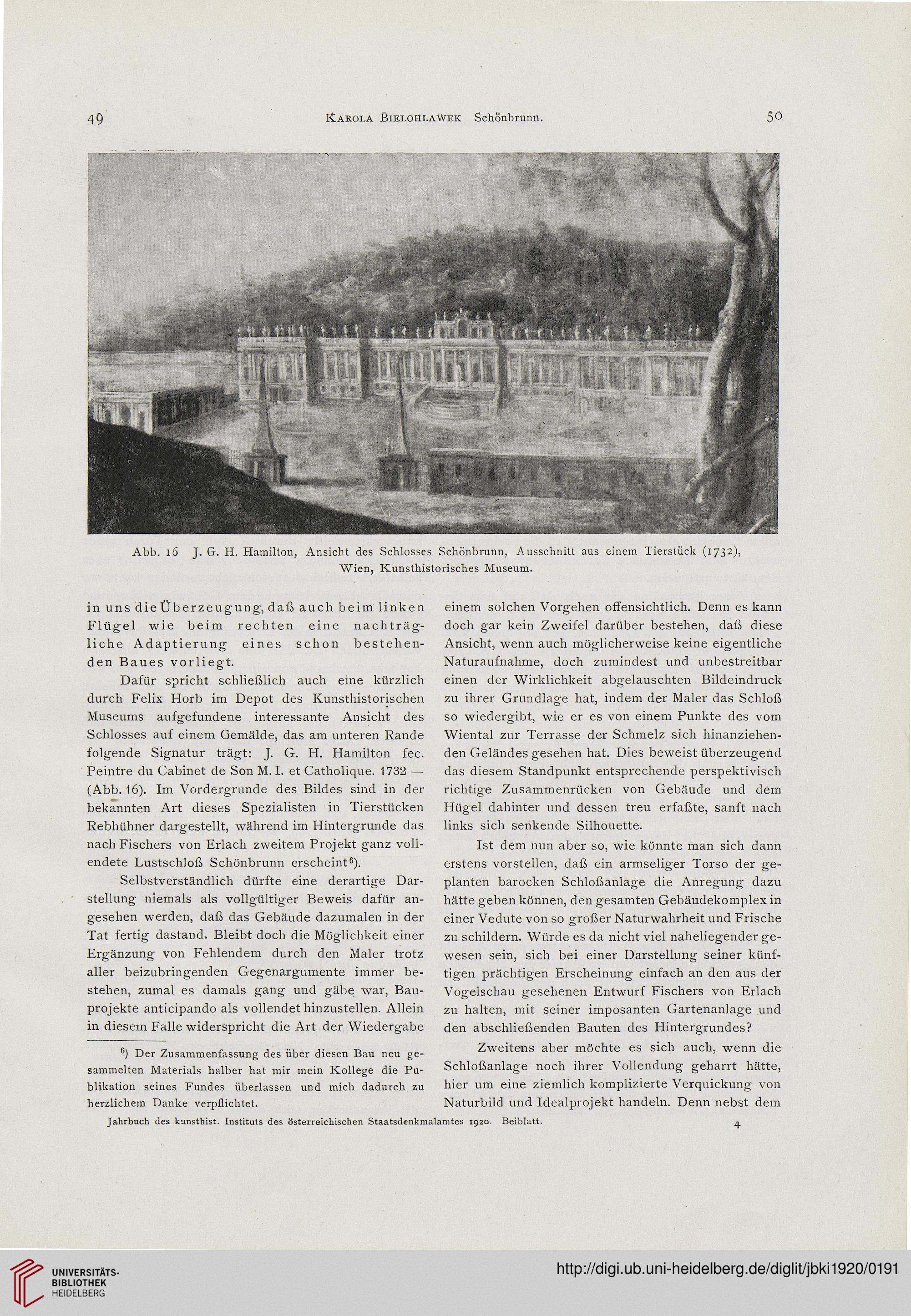49
Karola BieloHi.aWek Schönbrmm.
50
V7f>-
Abb. 16 J. G. H. Hamilton, Ansicht des Schlosses Schönbrunn, Ausschnitt aus einem Tierstück (1732),
Wien, Kunsthistorisches Museum.
in uns die Überzeugung, daß auch beim linken
Flügel wie beim rechten eine nachträg-
liche Adaptierung eines schon bestehen-
den Baues vorliegt.
Dafür spricht schließlich auch eine kürzlich
durch Felix Horb im Depot des Kunsthistorischen
Museums aufgefundene interessante Ansicht des
Schlosses auf einem Gemälde, das am unteren Rande
folgende Signatur trägt: J. G. H. Hamilton fec.
Peintre du Cabinet de Son M. I. et Catholique. 1732 —
(Abb. 16). Im Vordergründe des Bildes sind in der
bekannten Art dieses Spezialisten in Tierstücken
Rebhühner dargestellt, während im Hintergründe das
nach Fischers von Erlach zweitem Projekt ganz voll-
endete Lustschloß Schönbrunn erscheint6).
Selbstverständlich dürfte eine derartige Dar-
stellung niemals als vollgültiger Beweis dafür an-
gesehen werden, daß das Gebäude dazumalen in der
Tat fertig dastand. Bleibt doch die Möglichkeit einer
Ergänzung von Fehlendem durch den Maler trotz
aller beizubringenden Gegenargumente immer be-
stehen, zumal es damals gang und gäbe war, Bau-
projekte anticipando als vollendet hinzustellen. Allein
in diesem Falle widerspricht die Art der Wiedergabe
6) Der Zusammenfassung des über diesen Bau neu ge-
sammelten Materials halber hat mir mein Kollege die Pu-
blikation seines Fundes überlassen und mich dadurch zu
herzlichem Danke verpflichtet.
einem solchen Vorgehen offensichtlich. Denn es kann
doch gar kein Zweifel darüber bestehen, daß diese
Ansicht, wenn auch möglicherweise keine eigentliche
Naturaufnahme, doch zumindest und unbestreitbar
einen der Wirklichkeit abgelauschten Bildeindruck
zu ihrer Grundlage hat, indem der Maler das Schloß
so wiedergibt, wie er es von einem Punkte des vom
Wiental zur Terrasse der Schmelz sich hinanziehen-
den Geländes gesehen hat. Dies beweist überzeugend
das diesem Standpunkt entsprechende perspektivisch
richtige Zusammenrücken von Gebäude und dem
Hügel dahinter und dessen treu erfaßte, sanft nach
links sich senkende Silhouette.
Ist dem nun aber so, wie könnte man sich dann
erstens vorstellen, daß ein armseliger Torso der ge-
planten barocken Schloßanlage die Anregung dazu
hätte geben können, den gesamten Gebäudekomplex in
einer Vedute von so großer Naturwahrheit und Frische
zu schildern. Würde es da nicht viel naheliegender ge-
wesen sein, sich bei einer Darstellung seiner künf-
tigen prächtigen Erscheinung einfach an den aus der
Vogelschau gesehenen Entwurf Fischers von Erlach
zu halten, mit seiner imposanten Gartenanlage und
den abschließenden Bauten des Hintergrundes?
Zweitens aber möchte es sich auch, wenn die
Schloßanlage noch ihrer Vollendung geharrt hätte,
hier um eine ziemlich komplizierte Verquickung von
Naturbild und Idealprojekt handeln. Denn nebst dem
Jahrbuch des kansthist. Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920- Beiblatt.
4
Karola BieloHi.aWek Schönbrmm.
50
V7f>-
Abb. 16 J. G. H. Hamilton, Ansicht des Schlosses Schönbrunn, Ausschnitt aus einem Tierstück (1732),
Wien, Kunsthistorisches Museum.
in uns die Überzeugung, daß auch beim linken
Flügel wie beim rechten eine nachträg-
liche Adaptierung eines schon bestehen-
den Baues vorliegt.
Dafür spricht schließlich auch eine kürzlich
durch Felix Horb im Depot des Kunsthistorischen
Museums aufgefundene interessante Ansicht des
Schlosses auf einem Gemälde, das am unteren Rande
folgende Signatur trägt: J. G. H. Hamilton fec.
Peintre du Cabinet de Son M. I. et Catholique. 1732 —
(Abb. 16). Im Vordergründe des Bildes sind in der
bekannten Art dieses Spezialisten in Tierstücken
Rebhühner dargestellt, während im Hintergründe das
nach Fischers von Erlach zweitem Projekt ganz voll-
endete Lustschloß Schönbrunn erscheint6).
Selbstverständlich dürfte eine derartige Dar-
stellung niemals als vollgültiger Beweis dafür an-
gesehen werden, daß das Gebäude dazumalen in der
Tat fertig dastand. Bleibt doch die Möglichkeit einer
Ergänzung von Fehlendem durch den Maler trotz
aller beizubringenden Gegenargumente immer be-
stehen, zumal es damals gang und gäbe war, Bau-
projekte anticipando als vollendet hinzustellen. Allein
in diesem Falle widerspricht die Art der Wiedergabe
6) Der Zusammenfassung des über diesen Bau neu ge-
sammelten Materials halber hat mir mein Kollege die Pu-
blikation seines Fundes überlassen und mich dadurch zu
herzlichem Danke verpflichtet.
einem solchen Vorgehen offensichtlich. Denn es kann
doch gar kein Zweifel darüber bestehen, daß diese
Ansicht, wenn auch möglicherweise keine eigentliche
Naturaufnahme, doch zumindest und unbestreitbar
einen der Wirklichkeit abgelauschten Bildeindruck
zu ihrer Grundlage hat, indem der Maler das Schloß
so wiedergibt, wie er es von einem Punkte des vom
Wiental zur Terrasse der Schmelz sich hinanziehen-
den Geländes gesehen hat. Dies beweist überzeugend
das diesem Standpunkt entsprechende perspektivisch
richtige Zusammenrücken von Gebäude und dem
Hügel dahinter und dessen treu erfaßte, sanft nach
links sich senkende Silhouette.
Ist dem nun aber so, wie könnte man sich dann
erstens vorstellen, daß ein armseliger Torso der ge-
planten barocken Schloßanlage die Anregung dazu
hätte geben können, den gesamten Gebäudekomplex in
einer Vedute von so großer Naturwahrheit und Frische
zu schildern. Würde es da nicht viel naheliegender ge-
wesen sein, sich bei einer Darstellung seiner künf-
tigen prächtigen Erscheinung einfach an den aus der
Vogelschau gesehenen Entwurf Fischers von Erlach
zu halten, mit seiner imposanten Gartenanlage und
den abschließenden Bauten des Hintergrundes?
Zweitens aber möchte es sich auch, wenn die
Schloßanlage noch ihrer Vollendung geharrt hätte,
hier um eine ziemlich komplizierte Verquickung von
Naturbild und Idealprojekt handeln. Denn nebst dem
Jahrbuch des kansthist. Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920- Beiblatt.
4