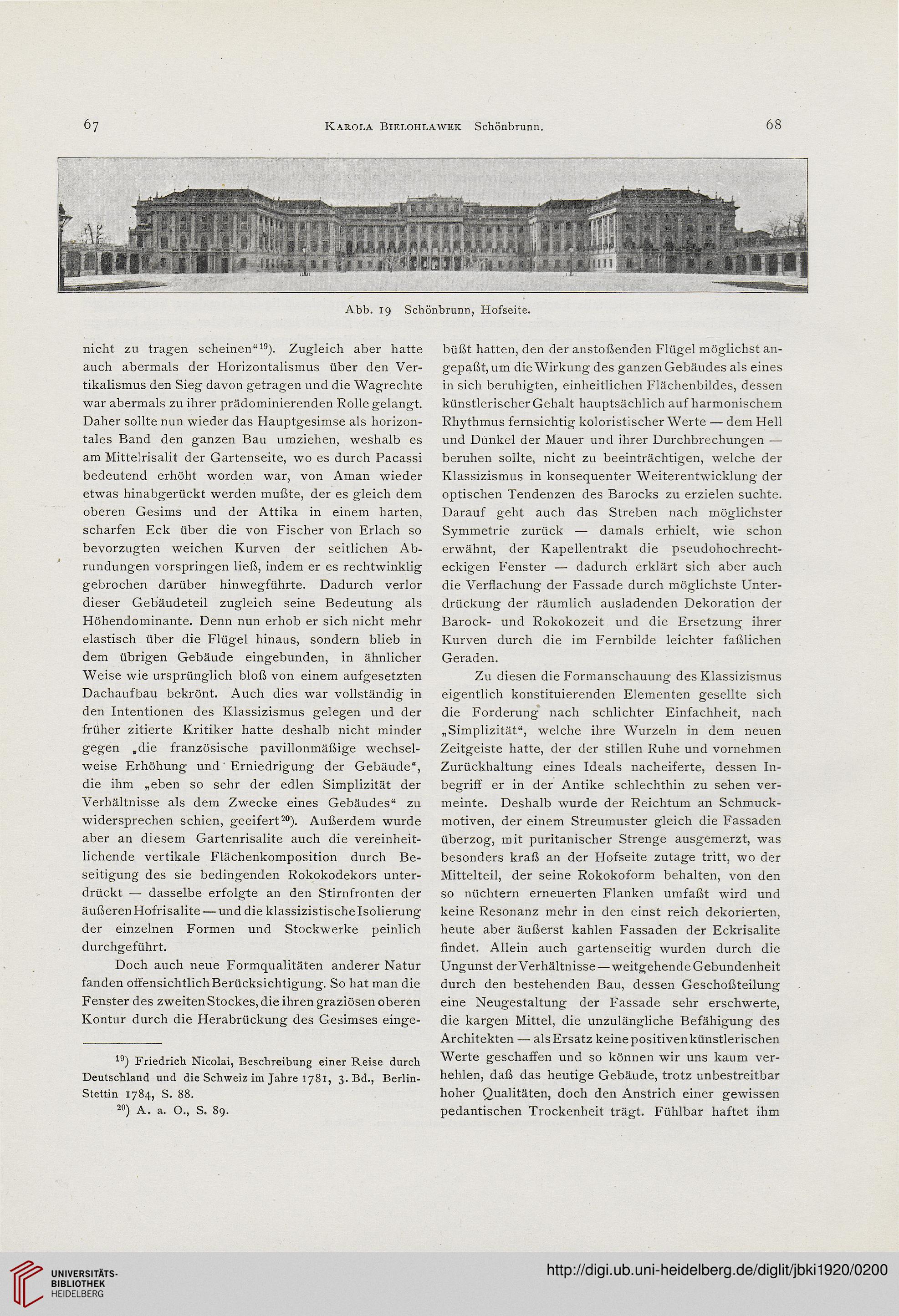67
Kaiioi.A Bielohlawek Schönbrunn.
68
Abb. 19 Schönbrunn, Hofseite.
nicht zu tragen scheinen“19). Zugleich aber hatte
auch abermals der Horizontalismus über den Ver-
tikalismus den Sieg davon getragen und die Wagrechte
war abermals zu ihrer prädominierenden Rolle gelangt.
Daher sollte nun wieder das Hauptgesimse als horizon-
tales Band den ganzen Bau umziehen, weshalb es
am Mittelrisalit der Gartenseite, wo es durch Pacassi
bedeutend erhöht worden war, von Aman wieder
etwas hinabgerückt werden mußte, der es gleich dem
oberen Gesims und der Attika in einem harten,
scharfen Eck über die von Fischer von Erlach so
bevorzugten weichen Kurven der seitlichen Ab-
rundungen vorspringen ließ, indem er es rechtwinklig
gebrochen darüber hinwegführte. Dadurch verlor
dieser Gebäudeteil zugleich seine Bedeutung als
Höhendominante. Denn nun erhob er sich nicht mehr
elastisch über die Flügel hinaus, sondern blieb in
dem übrigen Gebäude eingebunden, in ähnlicher
Weise wie ursprünglich bloß von einem aufgesetzten
Dachaufbau bekrönt. Auch dies war vollständig in
den Intentionen des Klassizismus gelegen und der
früher zitierte Kritiker hatte deshalb nicht minder
gegen .die französische pavillonmäßige wechsel-
weise Erhöhung und' Erniedrigung der Gebäude“,
die ihm „eben so sehr der edlen Simplizität der
Verhältnisse als dem Zwecke eines Gebäudes“ zu
widersprechen schien, geeifert20). Außerdem wurde
aber an diesem Gartenrisalite auch die vereinheit-
lichende vertikale Flächenkomposition durch Be-
seitigung des sie bedingenden Rokokodekors unter-
drückt — dasselbe erfolgte an den Stirnfronten der
äußeren Hofrisalite — und die klassizistische Isolierung
der einzelnen Formen und Stockwerke peinlich
durchgeführt.
Doch auch neue Formqualitäten anderer Natur
fanden offensichtlich Berücksichtigung. So hat man die
Fenster des zweitenStockes, die ihren graziösen oberen
Kontur durch die Herabrückung des Gesimses einge-
19) Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch
Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, 3. Bd., Berlin-
Stettin 1784, S. 88.
20) A. a. O., S. 89.
büßt hatten, den der anstoßenden Flügel möglichst an-
gepaßt, um die Wirkung des ganzen Gebäudes als eines
in sich beruhigten, einheitlichen Flächenbildes, dessen
künstlerischer Gehalt hauptsächlich auf harmonischem
Rhythmus fernsichtig koloristischer Werte — dem Hell
und Dünkel der Mauer und ihrer Durchbrechungen —•
beruhen sollte, nicht zu beeinträchtigen, welche der
Klassizismus in konsequenter Weiterentwicklung der
optischen Tendenzen des Barocks zu erzielen suchte.
Darauf geht auch das Streben nach möglichster
Symmetrie zurück -— damals erhielt, wie schon
erwähnt, der Kapellentrakt die pseudohochrecht-
eckigen Fenster — dadurch erklärt sich aber auch
die Verflachung der Fassade durch möglichste Unter-
drückung der räumlich ausladenden Dekoration der
Barock- und Rokokozeit und die Ersetzung ihrer
Kurven durch die im Fernbilde leichter faßlichen
Geraden.
Zu diesen die Formanschauung des Klassizismus
eigentlich konstituierenden Elementen gesellte sich
die Forderung nach schlichter Einfachheit, nach
„Simplizität“, welche ihre Wurzeln in dem neuen
Zeitgeiste hatte, der der stillen Ruhe und vornehmen
Zurückhaltung eines Ideals nacheiferte, dessen In-
begriff er in der Antike schlechthin zu sehen ver-
meinte. Deshalb wurde der Reichtum an Schmuck-
motiven, der einem Streumuster gleich die Fassaden
überzog, mit puritanischer Strenge ausgemerzt, was
besonders kraß an der Hofseite zutage tritt, wo der
Mittelteil, der seine Rokokoform behalten, von den
so nüchtern erneuerten Flanken umfaßt wird und
keine Resonanz mehr in den einst reich dekorierten,
heute aber äußerst kahlen Fassaden der Eckrisalite
findet. Allein auch gartenseitig wurden durch die
Ungunst der Verhältnisse—weitgehende Gebundenheit
durch den bestehenden Bau, dessen Geschoßteilung
eine Neugestaltung der Fassade sehr erschwerte,
die kargen Mittel, die unzulängliche Befähigung des
Architekten — als Ersatz keine positiven künstlerischen
Werte geschaffen und so können wir uns kaum ver-
hehlen, daß das heutige Gebäude, trotz unbestreitbar
hoher Qualitäten, doch den Anstrich einer gewissen
pedantischen Trockenheit trägt. Fühlbar haftet ihm
Kaiioi.A Bielohlawek Schönbrunn.
68
Abb. 19 Schönbrunn, Hofseite.
nicht zu tragen scheinen“19). Zugleich aber hatte
auch abermals der Horizontalismus über den Ver-
tikalismus den Sieg davon getragen und die Wagrechte
war abermals zu ihrer prädominierenden Rolle gelangt.
Daher sollte nun wieder das Hauptgesimse als horizon-
tales Band den ganzen Bau umziehen, weshalb es
am Mittelrisalit der Gartenseite, wo es durch Pacassi
bedeutend erhöht worden war, von Aman wieder
etwas hinabgerückt werden mußte, der es gleich dem
oberen Gesims und der Attika in einem harten,
scharfen Eck über die von Fischer von Erlach so
bevorzugten weichen Kurven der seitlichen Ab-
rundungen vorspringen ließ, indem er es rechtwinklig
gebrochen darüber hinwegführte. Dadurch verlor
dieser Gebäudeteil zugleich seine Bedeutung als
Höhendominante. Denn nun erhob er sich nicht mehr
elastisch über die Flügel hinaus, sondern blieb in
dem übrigen Gebäude eingebunden, in ähnlicher
Weise wie ursprünglich bloß von einem aufgesetzten
Dachaufbau bekrönt. Auch dies war vollständig in
den Intentionen des Klassizismus gelegen und der
früher zitierte Kritiker hatte deshalb nicht minder
gegen .die französische pavillonmäßige wechsel-
weise Erhöhung und' Erniedrigung der Gebäude“,
die ihm „eben so sehr der edlen Simplizität der
Verhältnisse als dem Zwecke eines Gebäudes“ zu
widersprechen schien, geeifert20). Außerdem wurde
aber an diesem Gartenrisalite auch die vereinheit-
lichende vertikale Flächenkomposition durch Be-
seitigung des sie bedingenden Rokokodekors unter-
drückt — dasselbe erfolgte an den Stirnfronten der
äußeren Hofrisalite — und die klassizistische Isolierung
der einzelnen Formen und Stockwerke peinlich
durchgeführt.
Doch auch neue Formqualitäten anderer Natur
fanden offensichtlich Berücksichtigung. So hat man die
Fenster des zweitenStockes, die ihren graziösen oberen
Kontur durch die Herabrückung des Gesimses einge-
19) Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch
Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, 3. Bd., Berlin-
Stettin 1784, S. 88.
20) A. a. O., S. 89.
büßt hatten, den der anstoßenden Flügel möglichst an-
gepaßt, um die Wirkung des ganzen Gebäudes als eines
in sich beruhigten, einheitlichen Flächenbildes, dessen
künstlerischer Gehalt hauptsächlich auf harmonischem
Rhythmus fernsichtig koloristischer Werte — dem Hell
und Dünkel der Mauer und ihrer Durchbrechungen —•
beruhen sollte, nicht zu beeinträchtigen, welche der
Klassizismus in konsequenter Weiterentwicklung der
optischen Tendenzen des Barocks zu erzielen suchte.
Darauf geht auch das Streben nach möglichster
Symmetrie zurück -— damals erhielt, wie schon
erwähnt, der Kapellentrakt die pseudohochrecht-
eckigen Fenster — dadurch erklärt sich aber auch
die Verflachung der Fassade durch möglichste Unter-
drückung der räumlich ausladenden Dekoration der
Barock- und Rokokozeit und die Ersetzung ihrer
Kurven durch die im Fernbilde leichter faßlichen
Geraden.
Zu diesen die Formanschauung des Klassizismus
eigentlich konstituierenden Elementen gesellte sich
die Forderung nach schlichter Einfachheit, nach
„Simplizität“, welche ihre Wurzeln in dem neuen
Zeitgeiste hatte, der der stillen Ruhe und vornehmen
Zurückhaltung eines Ideals nacheiferte, dessen In-
begriff er in der Antike schlechthin zu sehen ver-
meinte. Deshalb wurde der Reichtum an Schmuck-
motiven, der einem Streumuster gleich die Fassaden
überzog, mit puritanischer Strenge ausgemerzt, was
besonders kraß an der Hofseite zutage tritt, wo der
Mittelteil, der seine Rokokoform behalten, von den
so nüchtern erneuerten Flanken umfaßt wird und
keine Resonanz mehr in den einst reich dekorierten,
heute aber äußerst kahlen Fassaden der Eckrisalite
findet. Allein auch gartenseitig wurden durch die
Ungunst der Verhältnisse—weitgehende Gebundenheit
durch den bestehenden Bau, dessen Geschoßteilung
eine Neugestaltung der Fassade sehr erschwerte,
die kargen Mittel, die unzulängliche Befähigung des
Architekten — als Ersatz keine positiven künstlerischen
Werte geschaffen und so können wir uns kaum ver-
hehlen, daß das heutige Gebäude, trotz unbestreitbar
hoher Qualitäten, doch den Anstrich einer gewissen
pedantischen Trockenheit trägt. Fühlbar haftet ihm