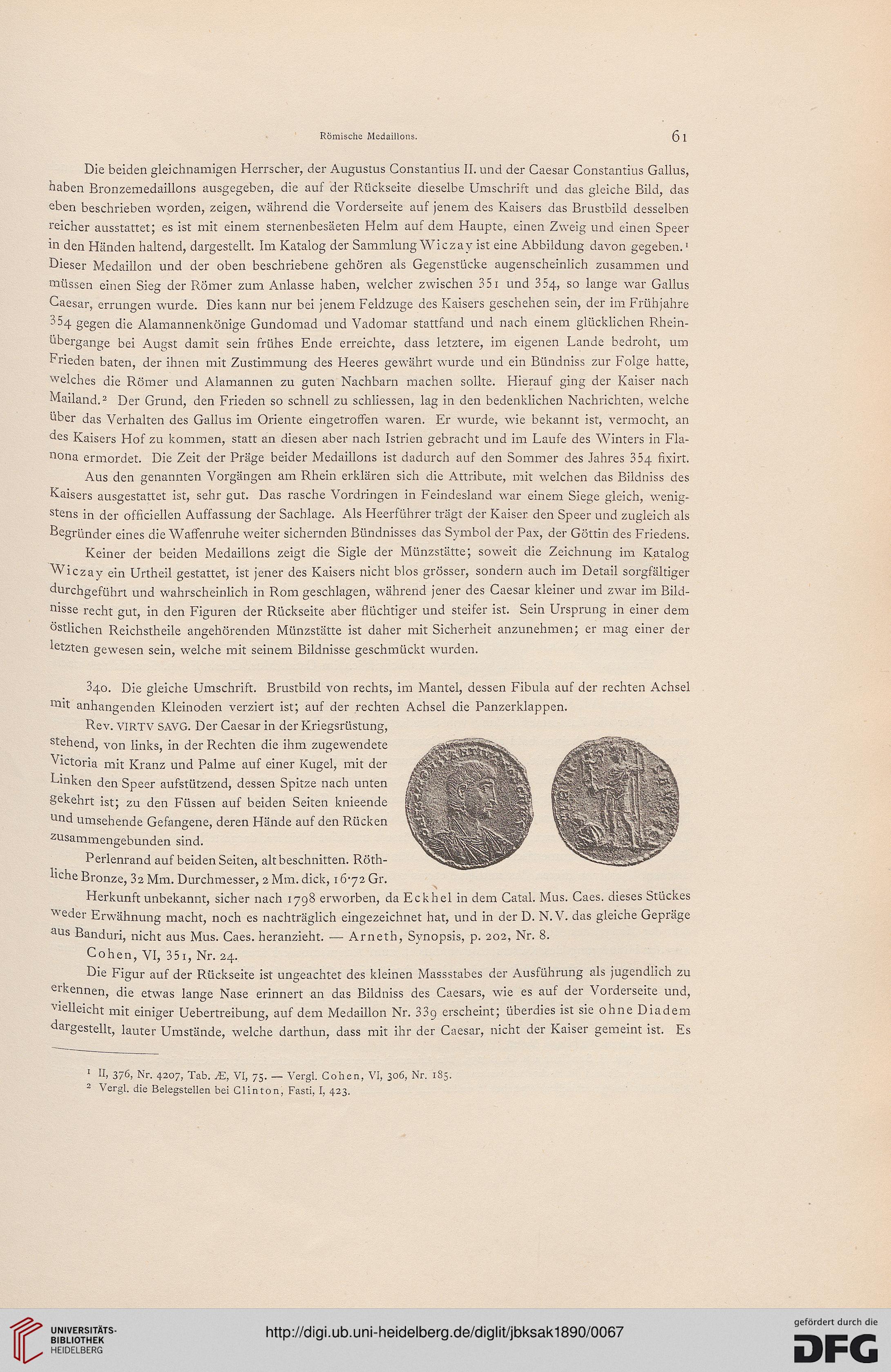Römische Medaillons.
61
Die beiden gleichnamigen Herrscher, der Augustus Constantius II. und der Caesar Constantius Gallus,
haben Bronzemedaillons ausgegeben, die auf der Rückseite dieselbe Umschrift und das gleiche Bild, das
eben beschrieben worden, zeigen, während die Vorderseite auf jenem des Kaisers das Brustbild desselben
reicher ausstattet; es ist mit einem sternenbesäeten Helm auf dem Haupte, einen Zweig und einen Speer
in den Händen haltend, dargestellt. Im Katalog der Sammlung Wiezay ist eine Abbildung davon gegeben.1
Dieser Medaillon und der oben beschriebene gehören als Gegenstücke augenscheinlich zusammen und
müssen einen Sieg der Römer zum Anlasse haben, welcher zwischen 351 und 354, so lange war Gallus
Caesar, errungen wurde. Dies kann nur bei jenem Feldzuge des Kaisers geschehen sein, der im Frühjahre
354 gegen die Alamannenkönige Gundomad und Vadomar stattfand und nach einem glücklichen Rhein-
übergange bei Äugst damit sein frühes Ende erreichte, dass letztere, im eigenen Lande bedroht, um
Frieden baten, der ihnen mit Zustimmung des Heeres gewährt wurde und ein Bündniss zur Folge hatte,
welches die Römer und Alamannen zu guten Nachbarn machen sollte. Hierauf ging der Kaiser nach
Mailand.2 Der Grund, den Frieden so schnell zu schliessen, lag in den bedenklichen Nachrichten, welche
über das Verhalten des Gallus im Oriente eingetroffen waren. Er wurde, wie bekannt ist, vermocht, an
des Kaisers Hof zu kommen, statt an diesen aber nach Istrien gebracht und im Laufe des Winters in Fla-
nona ermordet. Die Zeit der Präge beider Medaillons ist dadurch auf den Sommer des Jahres 354 fixirt.
Aus den benannten Vorgängen am Rhein erklären sich die Attribute, mit welchen das Bildniss des
Kaisers ausgestattet ist, sehr gut. Das rasche Vordringen in Feindesland war einem Siege gleich, wenig-
stens in der officiellen Auffassung der Sachlage. Als Heerführer trägt der Kaiser den Speer und zugleich als
Begründer eines die Waffenruhe weiter sichernden Bündnisses das Symbol der Pax, der Göttin des Friedens.
Keiner der beiden Medaillons zeigt die Sigle der Münzstätte; soweit die Zeichnung im Katalog
Wiczay ein Urtheil gestattet, ist jener des Kaisers nicht blos grösser, sondern auch im Detail sorgfältiger
durchgeführt und wahrscheinlich in Rom geschlagen, während jener des Caesar kleiner und zwar im Bild-
nisse recht gut, in den Figuren der Rückseite aber flüchtiger und steifer ist. Sein Ursprung in einer dem
östlichen Reichstheile angehörenden Münzstätte ist daher mit Sicherheit anzunehmen; er mag einer der
letzten gewesen sein, welche mit seinem Bildnisse geschmückt wurden.
340. Die gleiche Umschrift. Brustbild von rechts, im Mantel, dessen Fibula auf der rechten Achsel
mit anhangenden Kleinoden verziert ist; auf der rechten Achsel die Panzerklappen.
Rev. VIRTV SAVG. Der Caesar in der Kriegsrüstung,
stehend, von links, in der Rechten die ihm zugewendete
Victoria mit Kranz und Palme auf einer Kugel, mit der
Linken den Speer aufstützend, dessen Spitze nach unten
gekehrt ist; zu den Füssen auf beiden Seiten knieende
und umsehende Gefangene, deren Hände auf den Rücken
zusammengebunden sind.
Perlenrand auf beiden Seiten, alt beschnitten. Röth-
hche Bronze, 32 Mm. Durchmesser, 2 Mm. dick, 1672 Gr.
Herkunft unbekannt, sicher nach 1798 erworben, da Eckhel in dem Catal. Mus. Caes. dieses Stückes
weder Erwähnung macht, noch es nachträglich eingezeichnet hat, und in der D. N. V. das gleiche Gepräge
aus Banduri, nicht aus Mus. Caes. heranzieht. — Arneth, Synopsis, p. 202, Nr. 8.
Cohen, VI, 351, Nr. 24.
Die Figur auf der Rückseite ist ungeachtet des kleinen Massstabes der Ausführung als jugendlich zu
erkennen, die etwas lange Nase erinnert an das Bildniss des Caesars, wie es auf der Vorderseite und,
vielleicht mit einiger Uebertreibung, auf dem Medaillon Nr. 339 erscheint; Überdies ist sie ohne Diadem
dargestellt, lauter Umstände, welche darthun, dass mit ihr der Caesar, nicht der Kaiser gemeint ist. Es
1 II, 376, Nr. 4207, Tab. JE, VI, 75. — Vergl. Cohen, VI, 3°6> Nr- l85-
2 Vergl. die Belegstellen bei Clinton, Fasti, I, 423.
61
Die beiden gleichnamigen Herrscher, der Augustus Constantius II. und der Caesar Constantius Gallus,
haben Bronzemedaillons ausgegeben, die auf der Rückseite dieselbe Umschrift und das gleiche Bild, das
eben beschrieben worden, zeigen, während die Vorderseite auf jenem des Kaisers das Brustbild desselben
reicher ausstattet; es ist mit einem sternenbesäeten Helm auf dem Haupte, einen Zweig und einen Speer
in den Händen haltend, dargestellt. Im Katalog der Sammlung Wiezay ist eine Abbildung davon gegeben.1
Dieser Medaillon und der oben beschriebene gehören als Gegenstücke augenscheinlich zusammen und
müssen einen Sieg der Römer zum Anlasse haben, welcher zwischen 351 und 354, so lange war Gallus
Caesar, errungen wurde. Dies kann nur bei jenem Feldzuge des Kaisers geschehen sein, der im Frühjahre
354 gegen die Alamannenkönige Gundomad und Vadomar stattfand und nach einem glücklichen Rhein-
übergange bei Äugst damit sein frühes Ende erreichte, dass letztere, im eigenen Lande bedroht, um
Frieden baten, der ihnen mit Zustimmung des Heeres gewährt wurde und ein Bündniss zur Folge hatte,
welches die Römer und Alamannen zu guten Nachbarn machen sollte. Hierauf ging der Kaiser nach
Mailand.2 Der Grund, den Frieden so schnell zu schliessen, lag in den bedenklichen Nachrichten, welche
über das Verhalten des Gallus im Oriente eingetroffen waren. Er wurde, wie bekannt ist, vermocht, an
des Kaisers Hof zu kommen, statt an diesen aber nach Istrien gebracht und im Laufe des Winters in Fla-
nona ermordet. Die Zeit der Präge beider Medaillons ist dadurch auf den Sommer des Jahres 354 fixirt.
Aus den benannten Vorgängen am Rhein erklären sich die Attribute, mit welchen das Bildniss des
Kaisers ausgestattet ist, sehr gut. Das rasche Vordringen in Feindesland war einem Siege gleich, wenig-
stens in der officiellen Auffassung der Sachlage. Als Heerführer trägt der Kaiser den Speer und zugleich als
Begründer eines die Waffenruhe weiter sichernden Bündnisses das Symbol der Pax, der Göttin des Friedens.
Keiner der beiden Medaillons zeigt die Sigle der Münzstätte; soweit die Zeichnung im Katalog
Wiczay ein Urtheil gestattet, ist jener des Kaisers nicht blos grösser, sondern auch im Detail sorgfältiger
durchgeführt und wahrscheinlich in Rom geschlagen, während jener des Caesar kleiner und zwar im Bild-
nisse recht gut, in den Figuren der Rückseite aber flüchtiger und steifer ist. Sein Ursprung in einer dem
östlichen Reichstheile angehörenden Münzstätte ist daher mit Sicherheit anzunehmen; er mag einer der
letzten gewesen sein, welche mit seinem Bildnisse geschmückt wurden.
340. Die gleiche Umschrift. Brustbild von rechts, im Mantel, dessen Fibula auf der rechten Achsel
mit anhangenden Kleinoden verziert ist; auf der rechten Achsel die Panzerklappen.
Rev. VIRTV SAVG. Der Caesar in der Kriegsrüstung,
stehend, von links, in der Rechten die ihm zugewendete
Victoria mit Kranz und Palme auf einer Kugel, mit der
Linken den Speer aufstützend, dessen Spitze nach unten
gekehrt ist; zu den Füssen auf beiden Seiten knieende
und umsehende Gefangene, deren Hände auf den Rücken
zusammengebunden sind.
Perlenrand auf beiden Seiten, alt beschnitten. Röth-
hche Bronze, 32 Mm. Durchmesser, 2 Mm. dick, 1672 Gr.
Herkunft unbekannt, sicher nach 1798 erworben, da Eckhel in dem Catal. Mus. Caes. dieses Stückes
weder Erwähnung macht, noch es nachträglich eingezeichnet hat, und in der D. N. V. das gleiche Gepräge
aus Banduri, nicht aus Mus. Caes. heranzieht. — Arneth, Synopsis, p. 202, Nr. 8.
Cohen, VI, 351, Nr. 24.
Die Figur auf der Rückseite ist ungeachtet des kleinen Massstabes der Ausführung als jugendlich zu
erkennen, die etwas lange Nase erinnert an das Bildniss des Caesars, wie es auf der Vorderseite und,
vielleicht mit einiger Uebertreibung, auf dem Medaillon Nr. 339 erscheint; Überdies ist sie ohne Diadem
dargestellt, lauter Umstände, welche darthun, dass mit ihr der Caesar, nicht der Kaiser gemeint ist. Es
1 II, 376, Nr. 4207, Tab. JE, VI, 75. — Vergl. Cohen, VI, 3°6> Nr- l85-
2 Vergl. die Belegstellen bei Clinton, Fasti, I, 423.