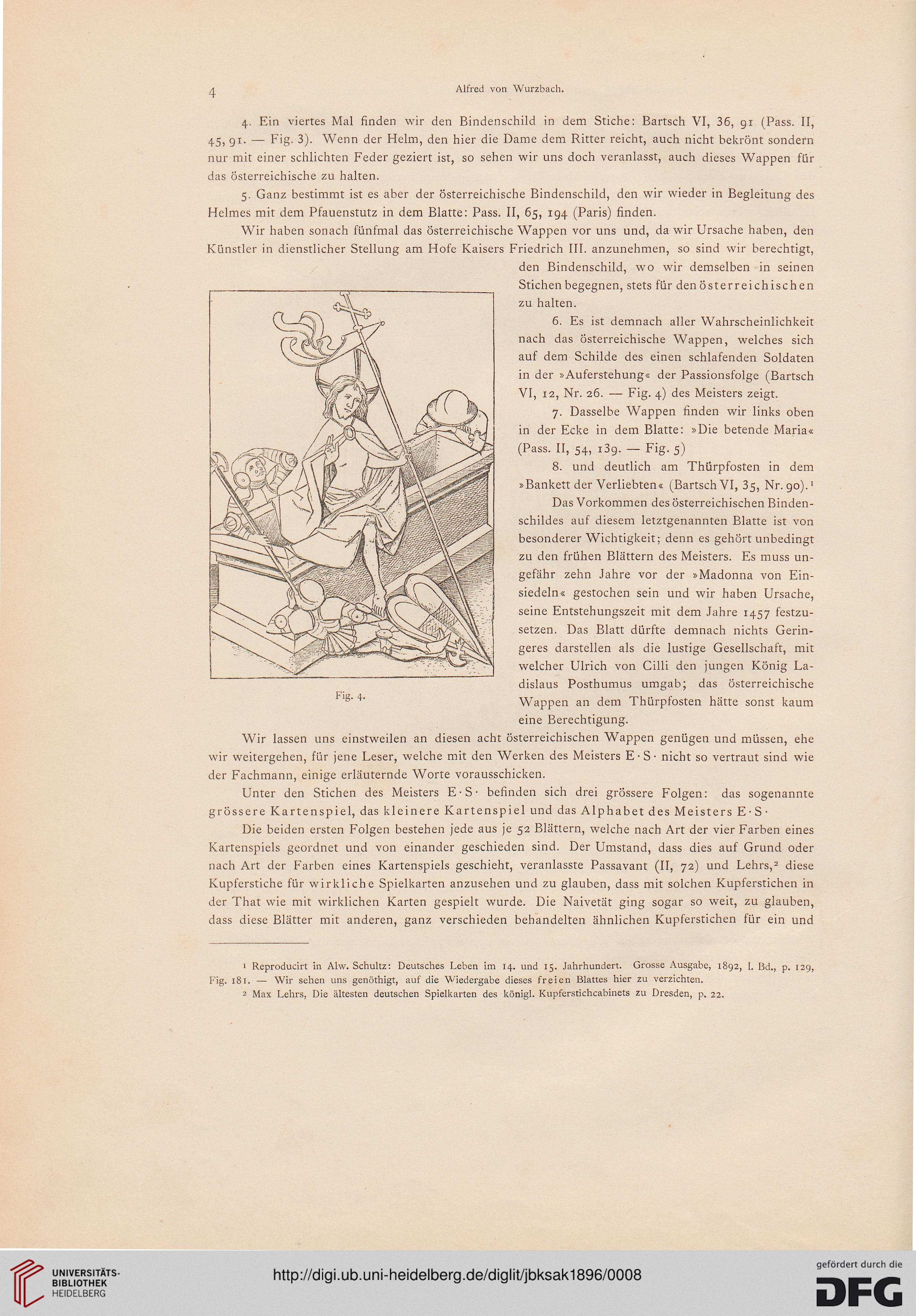4
Alfred von Wurzbach.
4. Ein viertes Mal finden wir den Bindenschild in dem Stiche: Bartsch VI, 36, gi (Pass. II,
45, 91. — Fig. 3). Wenn der Helm, den hier die Dame dem Ritter reicht, auch nicht bekrönt sondern
nur mit einer schlichten Feder geziert ist, so sehen wir uns doch veranlasst, auch dieses Wappen für
das österreichische zu halten.
5. Ganz bestimmt ist es aber der österreichische Bindenschild, den wir wieder in Begleitung des
Helmes mit dem Pfauenstutz in dem Blatte: Pass. II, 65, 194 (Paris) finden.
Wir haben sonach fünfmal das österreichische Wappen vor uns und, da wir Ursache haben, den
Künstler in dienstlicher Stellung am Hofe Kaisers Friedrich III. anzunehmen, so sind wir berechtigt,
den Bindenschild, wo wir demselben in seinen
Stichen begegnen, stets für den österreichisch en
zu halten.
6. Es ist demnach aller Wahrscheinlichkeit
nach das österreichische Wappen, welches sich
auf dem Schilde des einen schlafenden Soldaten
in der »Auferstehung« der Passionsfolge (Bartsch
VI, 12, Nr. 26. — Fig. 4) des Meisters zeigt.
7. Dasselbe Wappen finden wir links oben
in der Ecke in dem Blatte: »Die betende Maria«
(Pass. II, 54, i3g. — Fig. 5)
8. und deutlich am Thürpfosten in dem
»Bankett der Verliebten« (Bartsch VI, 35, Nr. 90).1
Das Vorkommen des österreichischen Binden-
schildes auf diesem letztgenannten Blatte ist von
besonderer Wichtigkeit; denn es gehört unbedingt
zu den frühen Blättern des Meisters. Es muss un-
gefähr zehn Jahre vor der »Madonna von Ein-
siedeln« gestochen sein und wir haben Ursache,
seine Entstehungszeit mit dem Jahre 1457 festzu-
setzen. Das Blatt dürfte demnach nichts Gerin-
geres darstellen als die lustige Gesellschaft, mit
welcher Ulrich von Cilli den jungen König La-
dislaus Posthumus umgab; das österreichische
Wappen an dem Thürpfosten hätte sonst kaum
eine Berechtigung.
Wir lassen uns einstweilen an diesen acht österreichischen Wappen genügen und müssen, ehe
wir weitergehen, für jene Leser, welche mit den Werken des Meisters E-S- nicht so vertraut sind wie
der Fachmann, einige erläuternde Worte vorausschicken.
Unter den Stichen des Meisters E-S- befinden sich drei grössere Folgen: das sogenannte
grössere Kartenspiel, das kleinere Kartenspiel und das Alphabet des Meisters E-S-
Die beiden ersten Folgen bestehen jede aus je 52 Blättern, welche nach Art der vier Farben eines
Kartenspiels geordnet und von einander geschieden sind. Der Umstand, dass dies auf Grund oder
nach Art der P'arben eines Kartenspiels geschieht, veranlasste Passavant (II, 72) und Lehrs,2 diese
Kupferstiche für wirkliche Spielkarten anzusehen und zu glauben, dass mit solchen Kupferstichen in
der That wie mit wirklichen Karten gespielt wurde. Die Naivetät ging sogar so weit, zu glauben,
dass diese Blätter mit anderen, ganz verschieden behandelten ähnlichen Kupferstichen für ein und
1 Reproducirt in Alw. Schultz: Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Grosse Ausgabe, 1892, I. Bd., p. 129,
Fig. 181. — Wir sehen uns genöthigt, auf die Wiedergabe dieses freien Blattes hier zu verzichten.
2 Max Lehrs, Die ältesten deutschen Spielkarten des königl. Kupferstichcabinets zu Dresden, p. 22.
Fig. 4.
Alfred von Wurzbach.
4. Ein viertes Mal finden wir den Bindenschild in dem Stiche: Bartsch VI, 36, gi (Pass. II,
45, 91. — Fig. 3). Wenn der Helm, den hier die Dame dem Ritter reicht, auch nicht bekrönt sondern
nur mit einer schlichten Feder geziert ist, so sehen wir uns doch veranlasst, auch dieses Wappen für
das österreichische zu halten.
5. Ganz bestimmt ist es aber der österreichische Bindenschild, den wir wieder in Begleitung des
Helmes mit dem Pfauenstutz in dem Blatte: Pass. II, 65, 194 (Paris) finden.
Wir haben sonach fünfmal das österreichische Wappen vor uns und, da wir Ursache haben, den
Künstler in dienstlicher Stellung am Hofe Kaisers Friedrich III. anzunehmen, so sind wir berechtigt,
den Bindenschild, wo wir demselben in seinen
Stichen begegnen, stets für den österreichisch en
zu halten.
6. Es ist demnach aller Wahrscheinlichkeit
nach das österreichische Wappen, welches sich
auf dem Schilde des einen schlafenden Soldaten
in der »Auferstehung« der Passionsfolge (Bartsch
VI, 12, Nr. 26. — Fig. 4) des Meisters zeigt.
7. Dasselbe Wappen finden wir links oben
in der Ecke in dem Blatte: »Die betende Maria«
(Pass. II, 54, i3g. — Fig. 5)
8. und deutlich am Thürpfosten in dem
»Bankett der Verliebten« (Bartsch VI, 35, Nr. 90).1
Das Vorkommen des österreichischen Binden-
schildes auf diesem letztgenannten Blatte ist von
besonderer Wichtigkeit; denn es gehört unbedingt
zu den frühen Blättern des Meisters. Es muss un-
gefähr zehn Jahre vor der »Madonna von Ein-
siedeln« gestochen sein und wir haben Ursache,
seine Entstehungszeit mit dem Jahre 1457 festzu-
setzen. Das Blatt dürfte demnach nichts Gerin-
geres darstellen als die lustige Gesellschaft, mit
welcher Ulrich von Cilli den jungen König La-
dislaus Posthumus umgab; das österreichische
Wappen an dem Thürpfosten hätte sonst kaum
eine Berechtigung.
Wir lassen uns einstweilen an diesen acht österreichischen Wappen genügen und müssen, ehe
wir weitergehen, für jene Leser, welche mit den Werken des Meisters E-S- nicht so vertraut sind wie
der Fachmann, einige erläuternde Worte vorausschicken.
Unter den Stichen des Meisters E-S- befinden sich drei grössere Folgen: das sogenannte
grössere Kartenspiel, das kleinere Kartenspiel und das Alphabet des Meisters E-S-
Die beiden ersten Folgen bestehen jede aus je 52 Blättern, welche nach Art der vier Farben eines
Kartenspiels geordnet und von einander geschieden sind. Der Umstand, dass dies auf Grund oder
nach Art der P'arben eines Kartenspiels geschieht, veranlasste Passavant (II, 72) und Lehrs,2 diese
Kupferstiche für wirkliche Spielkarten anzusehen und zu glauben, dass mit solchen Kupferstichen in
der That wie mit wirklichen Karten gespielt wurde. Die Naivetät ging sogar so weit, zu glauben,
dass diese Blätter mit anderen, ganz verschieden behandelten ähnlichen Kupferstichen für ein und
1 Reproducirt in Alw. Schultz: Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Grosse Ausgabe, 1892, I. Bd., p. 129,
Fig. 181. — Wir sehen uns genöthigt, auf die Wiedergabe dieses freien Blattes hier zu verzichten.
2 Max Lehrs, Die ältesten deutschen Spielkarten des königl. Kupferstichcabinets zu Dresden, p. 22.
Fig. 4.