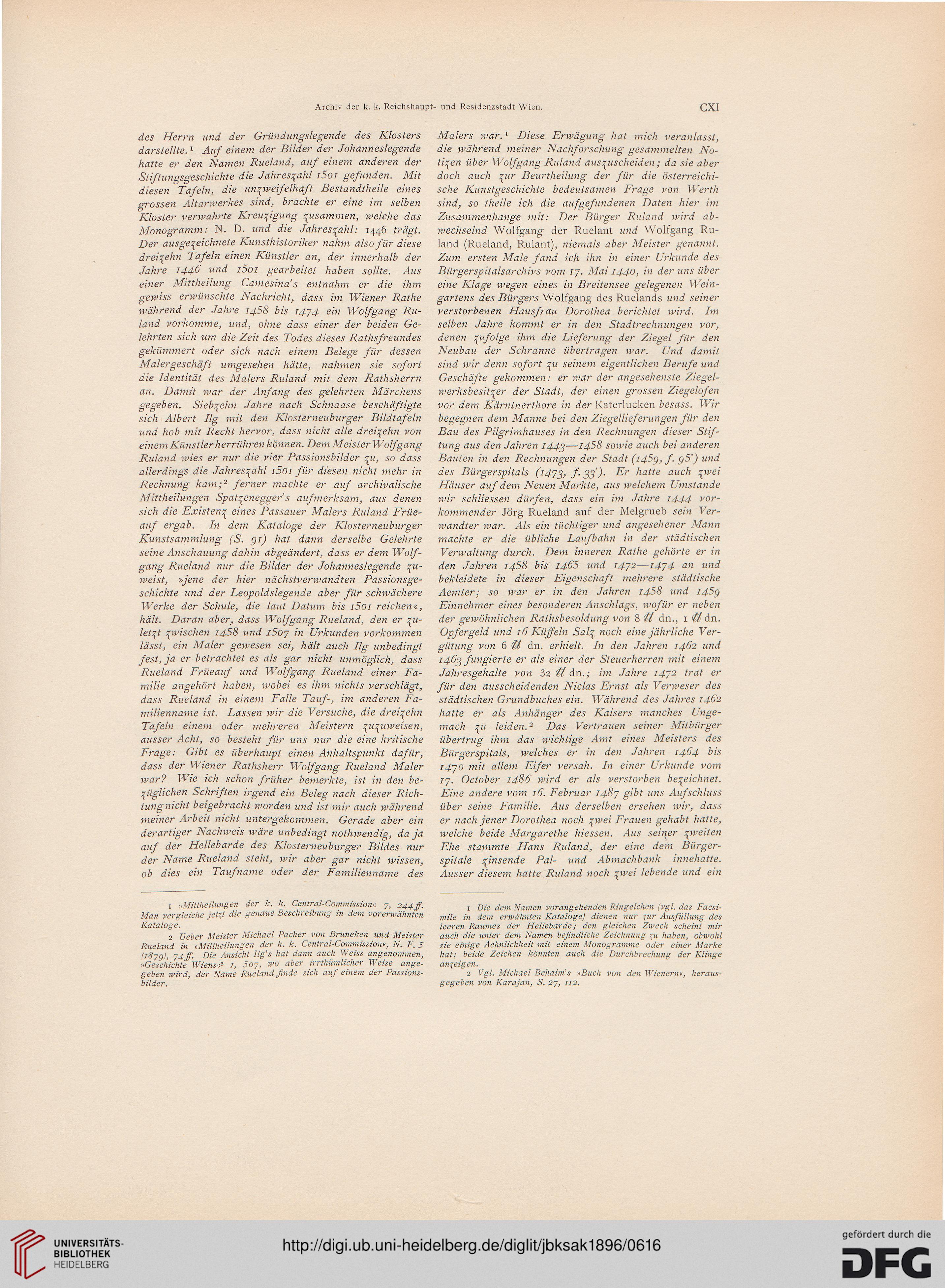Archiv der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
CXI
des Herrn und der Gründungslegende des Klosters
darstellte.1 Auf einem der Bilder der Johanneslegende
hatte er den Namen Rueland, auf einem anderen der
Stiftungsgeschichte die Jahreszahl i5oi gefunden. Mit
diesen Tafeln, die unzweifelhaft Bestandtheile eines
grossen Altarwerkes sind, brachte er eine im selben
Kloster verwahrte Kreuzigung zusammen, welche das
Monogramm: N. D. und die Jahreszahl: 1446 trägt.
Der ausgezeichnete Kunsthistoriker nahm also für diese
dreizehn Tafeln einen Künstler an, der innerhalb der
Jahre 1446 und 'Soi gearbeitet haben sollte. Aus
einer Mittheilung Camesina's entnahm er die ihm
gewiss erwünschte Nachricht, dass im Wiener Rathe
während der Jahre 1458 bis 1474 ein Wolfgang Ru-
land vorkomme, und, ohne dass einer der beiden Ge-
lehrten sich um die Zeit des Todes dieses Rathsfreundes
gekümmert oder sich nach einem Belege für dessen
Malergeschäft umgesehen hätte, nahmen sie sofort
die Identität des Malers Ruland mit dem Rathsherrn
an. Damit war der Anfang des gelehrten Märchens
gegeben. Siebzehn Jahre nach Schnaase beschäftigte
sich Albert Hg mit den Klosterneuburger Bildtafeln
und hob mit Recht hervor, dass nicht alle dreizehn von
einem Künstler herrühren können. Dem MeisterW olfgang
Ruland wies er nur die vier Passionsbilder zu> so dass
allerdings die Jahreszahl i5oi für diesen nicht mehr in
Rechnung kam;2 ferner machte er auf archivalische
Mittheilungen Spatzenegger''s aufmerksam, aus denen
sich die Existenz eines Passauer Malers Ruland Früe-
auf ergab. In dem Kataloge der Klosterneuburger
Kunstsammlung (S. gl) hat dann derselbe Gelehrte
seine Anschauung dahin abgeändert, dass er dem Wolf-
gang Rueland nur die Bilder der Johanneslegende zu-
weist, »jene der hier nächstverwandten Passionsge-
schichte und der Leopoldslegende aber für schwächere
Werke der Schule, die laut Datum bis i5oi reichen«.,
hält. Daran aber, dass Wolfgang Rueland, den er zu-
letzt zwischen 14S8 und i5oj in Urkunden vorkommen
lässt, ein Maler gewesen sei, hält auch Ilg unbedingt
fest, ja er betrachtet es als gar nicht unmöglich, dass
Rueland Früeauf und Wolfgang Rueland einer Fa-
milie angehört haben, wobei es ihm nichts verschlägt,
dass Rueland in einem Falle Tauf-, im anderen Fa-
milienname ist. Lassen wir die Versuche, die dreizehn
Tafeln einem oder mehreren Meistern zuzuweisen,
ausser Acht, so besteht für uns nur die eine kritische
Frage: Gibt es überhaupt einen Anhaltspunkt dafür,
dass der Wiener Rathsherr Wolfgang Rueland Maler
war? Wie ich schon früher bemerkte, ist in den be-
züglichen Schriften irgend ein Beleg nach dieser Rich-
tung nicht beigebracht worden und ist mir auch während
meiner Arbeit nicht untergekommen. Gerade aber ein
derartiger Nachweis wäre unbedingt nothwendig, da ja
auf der Hellebarde des Klosterneuburger Bildes nur
der Name Rueland steht, wir aber gar nicht wissen,
ob dies ein Taufname oder der Familienname des
1 «Mittheilungen der k. k. Central-Commissiom 7,
Man vergleiche jet\t die genaue Beschreibung in dem vorerwähnten
Kataloge.
2 Ueber Meister Michael Fächer von Bruneken und Meister
Rueland in Mittheilungen der k. k. Central-Commission«, N. F. S
(l8ygl, 74 ff. Die Ansicht Ilg's hat dann auch Weiss angenommen,
«Geschichte Wiens«'1 1, 5oy, wo aber irrthümlicher Weise ange-
geben wird, der Name Rueland finde sich auf einem der Passions-
bilder.
Malers war.1 Diese Erwägung hat mich veranlasst,
die während meiner Nachforschung gesammelten No-
tizen über Wolfgang Ruland auszuscheiden; da sie aber
doch auch zur Beurtheilung der für die österreichi-
sche Kunstgeschichte bedeutsamen Frage von Werth
sind, so theile ich die aufgefundenen Daten hier im
Zusammenhange mit: Der Bürger Ruland wird ab-
wechselnd Wolfgang- der Ruelant und Wolfgang Ru-
land (Rueland, Rulant), niemals aber Meister genannt.
Zum ersten Male fand ich ihn in einer Urkunde des
Bürgerspitalsarchivs vom 17. Mai 1440, in der uns über
eine Klage wegen eines in Breitensee gelegenen Wein-
gartens des Bürgers Wolfgang des Ruelands und seiner
verstorbenen Hausfrau Dorothea berichtet wird. Im
selben Jahre kommt er in den Stadtrechnungen vor,
denen zuf°ig'e ihm die Lieferung- der Ziegel für den
Neubau der Schranne übertragen war. Und damit
sind wir denn sofort zu seinem eigentlichen Berufe und
Geschäfte gekommen: er war der angesehenste Ziegel-
werksbesitzer der Stadt, der einen grossen Ziegelofen
vor dem Kärntnerthore in der Katerlucken besass. Wir
begegnen dem Manne bei den Ziegellieferungen für den
Bau des Pilgrimhauses in den Rechnungen dieser Stif-
tung aus den Jahren 1443—1458 sowie auch bei anderen
Bauten in den Rechnungen der Stadt (i45q, f. g5') und
des Bürgerspitals (1473, f. 33')- Er hatte auch zwe'
Häuser auf dem Neuen Markte, aus welchem Umstände
wir schliessen dürfen, dass ein im Jahre 1444 vor-
kommender Jörg Rueland auf der Melgrueb sein Ver-
wandter war. Als ein tüchtiger und angesehener Mann
machte er die übliche Laufbahn in der städtischen
Verwaltung durch. Dem inneren Rathe gehörte er in
den Jahren 1458 bis 1465 und 1472—1474 an und
bekleidete in dieser Eigenschaft mehrere städtische
Aemter; so war er in den Jahren 1458 und I45g
Einnehmer eines besonderen Anschlags, wofür er neben
der gewöhnlichen Rathsbesoldung von 8 ü dn., 1 t( An.
Opfergeld und 16 Küffeln Salz noch eine jährliche Ver-
gütung von 6 <U dn. erhielt. In den Jahren 1462 und
1463 fungierte er als einer der Steuerherren mit einem
Jahresgehalte von 32 & dn.; im Jahre 1472 trat er
für den ausscheidenden Niclas Ernst als Verweser des
städtischen Grundbuches ein. Während des Jahres 1462
hatte er als Anhänger des Kaisers manches Unge-
mach zu leiden.2 Das Vertrauen seiner Mitbürger
übertrug ihm das wichtige Amt eines Meisters des
Bürgerspitals, welches er in den Jahren 1464 bis
1410 mit allem Eifer versah. In einer Urkunde vom
17. October i486 wird er als verstorben bezeichnet.
Eine andere vom 16. Februar 1487 gibt uns Aufschluss
über seine Familie. Aus derselben ersehen wir, dass
er nach jener Dorothea noch zwei Frauen gehabt hatte,
welche beide Margarethe Messen. Aus seiner zweiten
Ehe stammte Hans Ruland, der eine dem Bürger-
spitale z'nsende Pal- und Abmachbank innehatte.
Ausser diesem hatte Ruland noch zwei lebende und ein
1 Die dem Namen vorangehenden Ringelchen (vgl. das Facsi-
mile in dem erwähnten Kataloge) dienen nur jar Ausfüllung des
leeren Raumes der Hellebarde; den gleichen Zweck scheint mir
auch die unter dem Namen befindliche Zeichnung \u haben, obwohl
sie einige Aehnlichkeit mit einem Monogramme oder einer Marke
hat; beide Zeichen könnten auch die Durchbrechung der Klinge
anzeigen.
2 Vgl. Michael Behaim's «Buch von den Wienern«, heraus-
gegeben von Karajan, S. 27, 112.
CXI
des Herrn und der Gründungslegende des Klosters
darstellte.1 Auf einem der Bilder der Johanneslegende
hatte er den Namen Rueland, auf einem anderen der
Stiftungsgeschichte die Jahreszahl i5oi gefunden. Mit
diesen Tafeln, die unzweifelhaft Bestandtheile eines
grossen Altarwerkes sind, brachte er eine im selben
Kloster verwahrte Kreuzigung zusammen, welche das
Monogramm: N. D. und die Jahreszahl: 1446 trägt.
Der ausgezeichnete Kunsthistoriker nahm also für diese
dreizehn Tafeln einen Künstler an, der innerhalb der
Jahre 1446 und 'Soi gearbeitet haben sollte. Aus
einer Mittheilung Camesina's entnahm er die ihm
gewiss erwünschte Nachricht, dass im Wiener Rathe
während der Jahre 1458 bis 1474 ein Wolfgang Ru-
land vorkomme, und, ohne dass einer der beiden Ge-
lehrten sich um die Zeit des Todes dieses Rathsfreundes
gekümmert oder sich nach einem Belege für dessen
Malergeschäft umgesehen hätte, nahmen sie sofort
die Identität des Malers Ruland mit dem Rathsherrn
an. Damit war der Anfang des gelehrten Märchens
gegeben. Siebzehn Jahre nach Schnaase beschäftigte
sich Albert Hg mit den Klosterneuburger Bildtafeln
und hob mit Recht hervor, dass nicht alle dreizehn von
einem Künstler herrühren können. Dem MeisterW olfgang
Ruland wies er nur die vier Passionsbilder zu> so dass
allerdings die Jahreszahl i5oi für diesen nicht mehr in
Rechnung kam;2 ferner machte er auf archivalische
Mittheilungen Spatzenegger''s aufmerksam, aus denen
sich die Existenz eines Passauer Malers Ruland Früe-
auf ergab. In dem Kataloge der Klosterneuburger
Kunstsammlung (S. gl) hat dann derselbe Gelehrte
seine Anschauung dahin abgeändert, dass er dem Wolf-
gang Rueland nur die Bilder der Johanneslegende zu-
weist, »jene der hier nächstverwandten Passionsge-
schichte und der Leopoldslegende aber für schwächere
Werke der Schule, die laut Datum bis i5oi reichen«.,
hält. Daran aber, dass Wolfgang Rueland, den er zu-
letzt zwischen 14S8 und i5oj in Urkunden vorkommen
lässt, ein Maler gewesen sei, hält auch Ilg unbedingt
fest, ja er betrachtet es als gar nicht unmöglich, dass
Rueland Früeauf und Wolfgang Rueland einer Fa-
milie angehört haben, wobei es ihm nichts verschlägt,
dass Rueland in einem Falle Tauf-, im anderen Fa-
milienname ist. Lassen wir die Versuche, die dreizehn
Tafeln einem oder mehreren Meistern zuzuweisen,
ausser Acht, so besteht für uns nur die eine kritische
Frage: Gibt es überhaupt einen Anhaltspunkt dafür,
dass der Wiener Rathsherr Wolfgang Rueland Maler
war? Wie ich schon früher bemerkte, ist in den be-
züglichen Schriften irgend ein Beleg nach dieser Rich-
tung nicht beigebracht worden und ist mir auch während
meiner Arbeit nicht untergekommen. Gerade aber ein
derartiger Nachweis wäre unbedingt nothwendig, da ja
auf der Hellebarde des Klosterneuburger Bildes nur
der Name Rueland steht, wir aber gar nicht wissen,
ob dies ein Taufname oder der Familienname des
1 «Mittheilungen der k. k. Central-Commissiom 7,
Man vergleiche jet\t die genaue Beschreibung in dem vorerwähnten
Kataloge.
2 Ueber Meister Michael Fächer von Bruneken und Meister
Rueland in Mittheilungen der k. k. Central-Commission«, N. F. S
(l8ygl, 74 ff. Die Ansicht Ilg's hat dann auch Weiss angenommen,
«Geschichte Wiens«'1 1, 5oy, wo aber irrthümlicher Weise ange-
geben wird, der Name Rueland finde sich auf einem der Passions-
bilder.
Malers war.1 Diese Erwägung hat mich veranlasst,
die während meiner Nachforschung gesammelten No-
tizen über Wolfgang Ruland auszuscheiden; da sie aber
doch auch zur Beurtheilung der für die österreichi-
sche Kunstgeschichte bedeutsamen Frage von Werth
sind, so theile ich die aufgefundenen Daten hier im
Zusammenhange mit: Der Bürger Ruland wird ab-
wechselnd Wolfgang- der Ruelant und Wolfgang Ru-
land (Rueland, Rulant), niemals aber Meister genannt.
Zum ersten Male fand ich ihn in einer Urkunde des
Bürgerspitalsarchivs vom 17. Mai 1440, in der uns über
eine Klage wegen eines in Breitensee gelegenen Wein-
gartens des Bürgers Wolfgang des Ruelands und seiner
verstorbenen Hausfrau Dorothea berichtet wird. Im
selben Jahre kommt er in den Stadtrechnungen vor,
denen zuf°ig'e ihm die Lieferung- der Ziegel für den
Neubau der Schranne übertragen war. Und damit
sind wir denn sofort zu seinem eigentlichen Berufe und
Geschäfte gekommen: er war der angesehenste Ziegel-
werksbesitzer der Stadt, der einen grossen Ziegelofen
vor dem Kärntnerthore in der Katerlucken besass. Wir
begegnen dem Manne bei den Ziegellieferungen für den
Bau des Pilgrimhauses in den Rechnungen dieser Stif-
tung aus den Jahren 1443—1458 sowie auch bei anderen
Bauten in den Rechnungen der Stadt (i45q, f. g5') und
des Bürgerspitals (1473, f. 33')- Er hatte auch zwe'
Häuser auf dem Neuen Markte, aus welchem Umstände
wir schliessen dürfen, dass ein im Jahre 1444 vor-
kommender Jörg Rueland auf der Melgrueb sein Ver-
wandter war. Als ein tüchtiger und angesehener Mann
machte er die übliche Laufbahn in der städtischen
Verwaltung durch. Dem inneren Rathe gehörte er in
den Jahren 1458 bis 1465 und 1472—1474 an und
bekleidete in dieser Eigenschaft mehrere städtische
Aemter; so war er in den Jahren 1458 und I45g
Einnehmer eines besonderen Anschlags, wofür er neben
der gewöhnlichen Rathsbesoldung von 8 ü dn., 1 t( An.
Opfergeld und 16 Küffeln Salz noch eine jährliche Ver-
gütung von 6 <U dn. erhielt. In den Jahren 1462 und
1463 fungierte er als einer der Steuerherren mit einem
Jahresgehalte von 32 & dn.; im Jahre 1472 trat er
für den ausscheidenden Niclas Ernst als Verweser des
städtischen Grundbuches ein. Während des Jahres 1462
hatte er als Anhänger des Kaisers manches Unge-
mach zu leiden.2 Das Vertrauen seiner Mitbürger
übertrug ihm das wichtige Amt eines Meisters des
Bürgerspitals, welches er in den Jahren 1464 bis
1410 mit allem Eifer versah. In einer Urkunde vom
17. October i486 wird er als verstorben bezeichnet.
Eine andere vom 16. Februar 1487 gibt uns Aufschluss
über seine Familie. Aus derselben ersehen wir, dass
er nach jener Dorothea noch zwei Frauen gehabt hatte,
welche beide Margarethe Messen. Aus seiner zweiten
Ehe stammte Hans Ruland, der eine dem Bürger-
spitale z'nsende Pal- und Abmachbank innehatte.
Ausser diesem hatte Ruland noch zwei lebende und ein
1 Die dem Namen vorangehenden Ringelchen (vgl. das Facsi-
mile in dem erwähnten Kataloge) dienen nur jar Ausfüllung des
leeren Raumes der Hellebarde; den gleichen Zweck scheint mir
auch die unter dem Namen befindliche Zeichnung \u haben, obwohl
sie einige Aehnlichkeit mit einem Monogramme oder einer Marke
hat; beide Zeichen könnten auch die Durchbrechung der Klinge
anzeigen.
2 Vgl. Michael Behaim's «Buch von den Wienern«, heraus-
gegeben von Karajan, S. 27, 112.