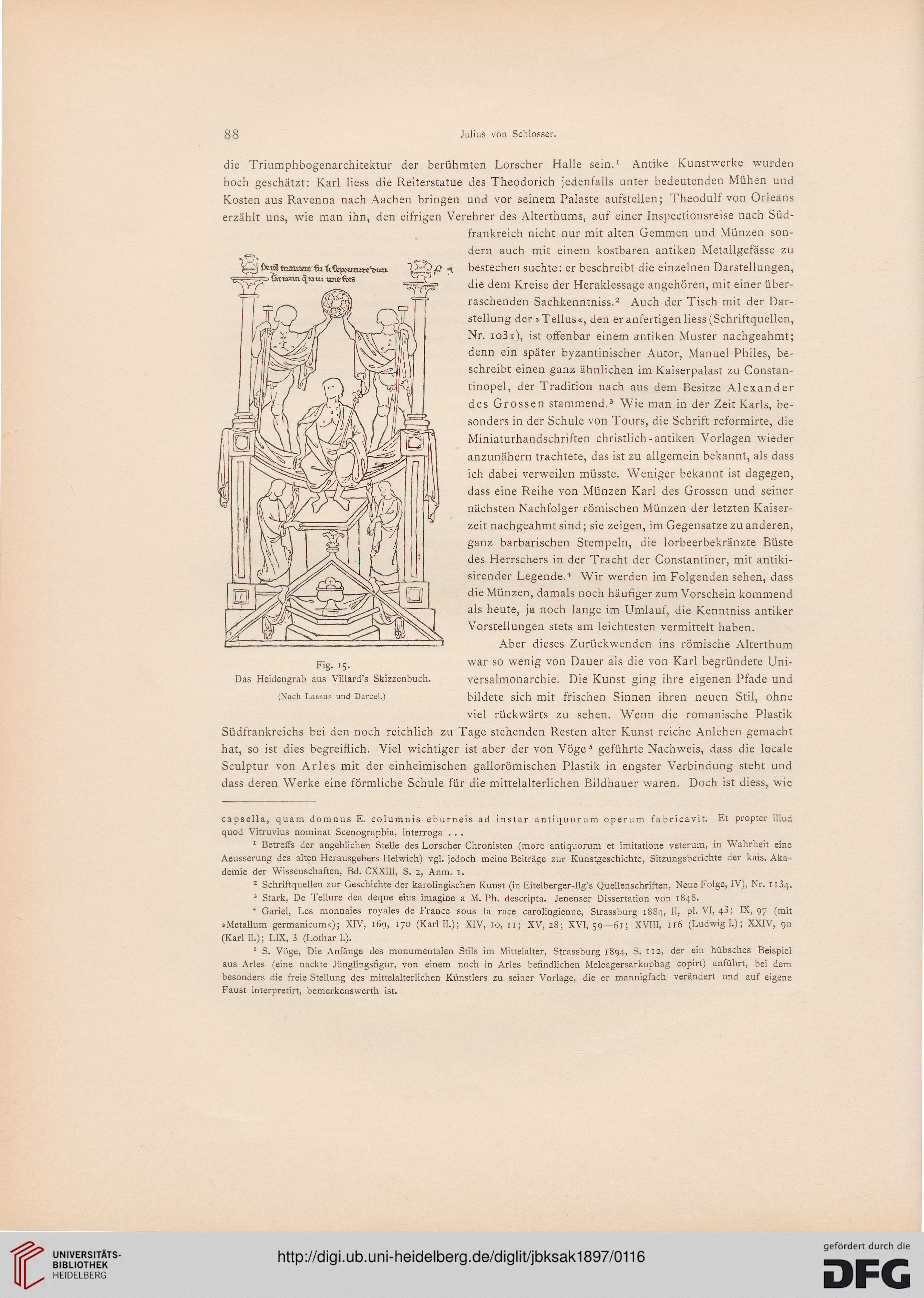88
Julius von Schlosser.
UtX
3 ^äxtatm cftoui uneftiS
die Triumphbogenarchitektur der berühmten Lorscher Halle sein.1 Antike Kunstwerke wurden
hoch geschätzt: Karl liess die Reiterstatue des Theodorich jedenfalls unter bedeutenden Mühen und
Kosten aus Ravenna nach Aachen bringen und vor seinem Palaste aufstellen; Theodulf von Orleans
erzahlt uns, wie man ihn, den eifrigen Verehrer des Alterthums, auf einer Inspectionsreise nach Süd-
frankreich nicht nur mit alten Gemmen und Münzen son-
Ä dern auch mit einem kostbaren antiken Metallgefässe zu
bestechen suchte: er beschreibt die einzelnen Darstellungen,
die dem Kreise der Heraklessage angehören, mit einer über-
raschenden Sachkenntniss.2 Auch der Tisch mit der Dar-
stellung der »Tellus«, den er anfertigen liess (Schriftquellen,
Nr. io3i), ist offenbar einem antiken Muster nachgeahmt;
denn ein später byzantinischer Autor, Manuel Philes, be-
schreibt einen ganz ähnlichen im Kaiserpalast zu Constan-
tinopel, der Tradition nach aus dem Besitze Alexander
des Grossen stammend.3 Wie man in der Zeit Karls, be-
sonders in der Schule von Tours, die Schrift reformirte, die
Miniaturhandschriften christlich-antiken Vorlagen wieder
anzunähern trachtete, das ist zu allgemein bekannt, als dass
ich dabei verweilen müsste. Weniger bekannt ist dagegen,
dass eine Reihe von Münzen Karl des Grossen und seiner
nächsten Nachfolger römischen Münzen der letzten Kaiser-
zeit nachgeahmt sind; sie zeigen, im Gegensatze zu anderen,
ganz barbarischen Stempeln, die lorbeerbekränzte Büste
des Herrschers in der Tracht der Constantiner, mit antiki-
sirender Legende.4 Wir werden im Folgenden sehen, dass
die Münzen, damals noch häufiger zum Vorschein kommend
als heute, ja noch lange im Umlauf, die Kenntniss antiker
Vorstellungen stets am leichtesten vermittelt haben.
Aber dieses Zurückwenden ins römische Alterthum
war so wenig von Dauer als die von Karl begründete Uni-
versalmonarchie. Die Kunst ging ihre eigenen Pfade und
bildete sich mit frischen Sinnen ihren neuen Stil, ohne
viel rückwärts zu sehen. Wenn die romanische Plastik
Südfrankreichs bei den noch reichlich zu Tage stehenden Resten alter Kunst reiche Anlehen gemacht
hat, so ist dies begreiflich. Viel wichtiger ist aber der von Vöge5 geführte Nachweis, dass die locale
Sculptur von Arles mit der einheimischen gallorömischen Plastik in engster Verbindung steht und
dass deren Werke eine förmliche Schule für die mittelalterlichen Bildhauer waren. Doch ist diess, wie
Fig. iS-
Das Heidengrab aus Villard's Skizzenbuch.
(Nach Lassus und Darcel.)
capsella, quam domnus E. columnis eburneis ad instar antiquorum operum fabricavit. Et propter illud
quod Vitruvius nominat Scenographia, interroga . . .
1 Betreffs der angeblichen Stelle des Lorscher Chronisten (more antiquorum et imitatione veterum, in Wahrheit eine
Aeusserung des alten Herausgebers Helwich) vgl. jedoch meine Beiträge zur Kunstgeschichte, Sitzungsberichte der kais. Aka-
demie der Wissenschaften, Bd. CXXIII, S. 2, Anm. i.
2 Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst (in Eitelberger-Ilg's Quellenschriften, Neue Folge, IV), Nr. 1134.
3 Stark, De Tellure dea deque eius imagine a M. Ph. descripta. Jenenser Dissertation von 1848.
4 Gariel, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Strassburg 1884, II, pl. VI, 43; IX, 97 (mit
»Metallum germanicum«); XIV, 169, 170 (Karl II.); XIV, 10, Ii; XV, 28; XVI, 59—61; XVIII, 116 (Ludwig I.); XXIV, 90
(Karl II.); LIX, 3 (Lothar L).
5 S. Vöge, Die Anfänge des monumentalen Stils im Mittelalter, Strassburg 1894, S. 112, der ein hübsches Beispiel
aus Arles (eine nackte Jünglingsfigur, von einem noch in Arles befindlichen Meleagersarkophag copirt) anführt, bei dem
besonders die freie Stellung des mittelalterlichen Künstlers zu seiner Vorlage, die er mannigfach verändert und auf eigene
Faust interpretirt, bemerkenswert!! ist.
Julius von Schlosser.
UtX
3 ^äxtatm cftoui uneftiS
die Triumphbogenarchitektur der berühmten Lorscher Halle sein.1 Antike Kunstwerke wurden
hoch geschätzt: Karl liess die Reiterstatue des Theodorich jedenfalls unter bedeutenden Mühen und
Kosten aus Ravenna nach Aachen bringen und vor seinem Palaste aufstellen; Theodulf von Orleans
erzahlt uns, wie man ihn, den eifrigen Verehrer des Alterthums, auf einer Inspectionsreise nach Süd-
frankreich nicht nur mit alten Gemmen und Münzen son-
Ä dern auch mit einem kostbaren antiken Metallgefässe zu
bestechen suchte: er beschreibt die einzelnen Darstellungen,
die dem Kreise der Heraklessage angehören, mit einer über-
raschenden Sachkenntniss.2 Auch der Tisch mit der Dar-
stellung der »Tellus«, den er anfertigen liess (Schriftquellen,
Nr. io3i), ist offenbar einem antiken Muster nachgeahmt;
denn ein später byzantinischer Autor, Manuel Philes, be-
schreibt einen ganz ähnlichen im Kaiserpalast zu Constan-
tinopel, der Tradition nach aus dem Besitze Alexander
des Grossen stammend.3 Wie man in der Zeit Karls, be-
sonders in der Schule von Tours, die Schrift reformirte, die
Miniaturhandschriften christlich-antiken Vorlagen wieder
anzunähern trachtete, das ist zu allgemein bekannt, als dass
ich dabei verweilen müsste. Weniger bekannt ist dagegen,
dass eine Reihe von Münzen Karl des Grossen und seiner
nächsten Nachfolger römischen Münzen der letzten Kaiser-
zeit nachgeahmt sind; sie zeigen, im Gegensatze zu anderen,
ganz barbarischen Stempeln, die lorbeerbekränzte Büste
des Herrschers in der Tracht der Constantiner, mit antiki-
sirender Legende.4 Wir werden im Folgenden sehen, dass
die Münzen, damals noch häufiger zum Vorschein kommend
als heute, ja noch lange im Umlauf, die Kenntniss antiker
Vorstellungen stets am leichtesten vermittelt haben.
Aber dieses Zurückwenden ins römische Alterthum
war so wenig von Dauer als die von Karl begründete Uni-
versalmonarchie. Die Kunst ging ihre eigenen Pfade und
bildete sich mit frischen Sinnen ihren neuen Stil, ohne
viel rückwärts zu sehen. Wenn die romanische Plastik
Südfrankreichs bei den noch reichlich zu Tage stehenden Resten alter Kunst reiche Anlehen gemacht
hat, so ist dies begreiflich. Viel wichtiger ist aber der von Vöge5 geführte Nachweis, dass die locale
Sculptur von Arles mit der einheimischen gallorömischen Plastik in engster Verbindung steht und
dass deren Werke eine förmliche Schule für die mittelalterlichen Bildhauer waren. Doch ist diess, wie
Fig. iS-
Das Heidengrab aus Villard's Skizzenbuch.
(Nach Lassus und Darcel.)
capsella, quam domnus E. columnis eburneis ad instar antiquorum operum fabricavit. Et propter illud
quod Vitruvius nominat Scenographia, interroga . . .
1 Betreffs der angeblichen Stelle des Lorscher Chronisten (more antiquorum et imitatione veterum, in Wahrheit eine
Aeusserung des alten Herausgebers Helwich) vgl. jedoch meine Beiträge zur Kunstgeschichte, Sitzungsberichte der kais. Aka-
demie der Wissenschaften, Bd. CXXIII, S. 2, Anm. i.
2 Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst (in Eitelberger-Ilg's Quellenschriften, Neue Folge, IV), Nr. 1134.
3 Stark, De Tellure dea deque eius imagine a M. Ph. descripta. Jenenser Dissertation von 1848.
4 Gariel, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Strassburg 1884, II, pl. VI, 43; IX, 97 (mit
»Metallum germanicum«); XIV, 169, 170 (Karl II.); XIV, 10, Ii; XV, 28; XVI, 59—61; XVIII, 116 (Ludwig I.); XXIV, 90
(Karl II.); LIX, 3 (Lothar L).
5 S. Vöge, Die Anfänge des monumentalen Stils im Mittelalter, Strassburg 1894, S. 112, der ein hübsches Beispiel
aus Arles (eine nackte Jünglingsfigur, von einem noch in Arles befindlichen Meleagersarkophag copirt) anführt, bei dem
besonders die freie Stellung des mittelalterlichen Künstlers zu seiner Vorlage, die er mannigfach verändert und auf eigene
Faust interpretirt, bemerkenswert!! ist.