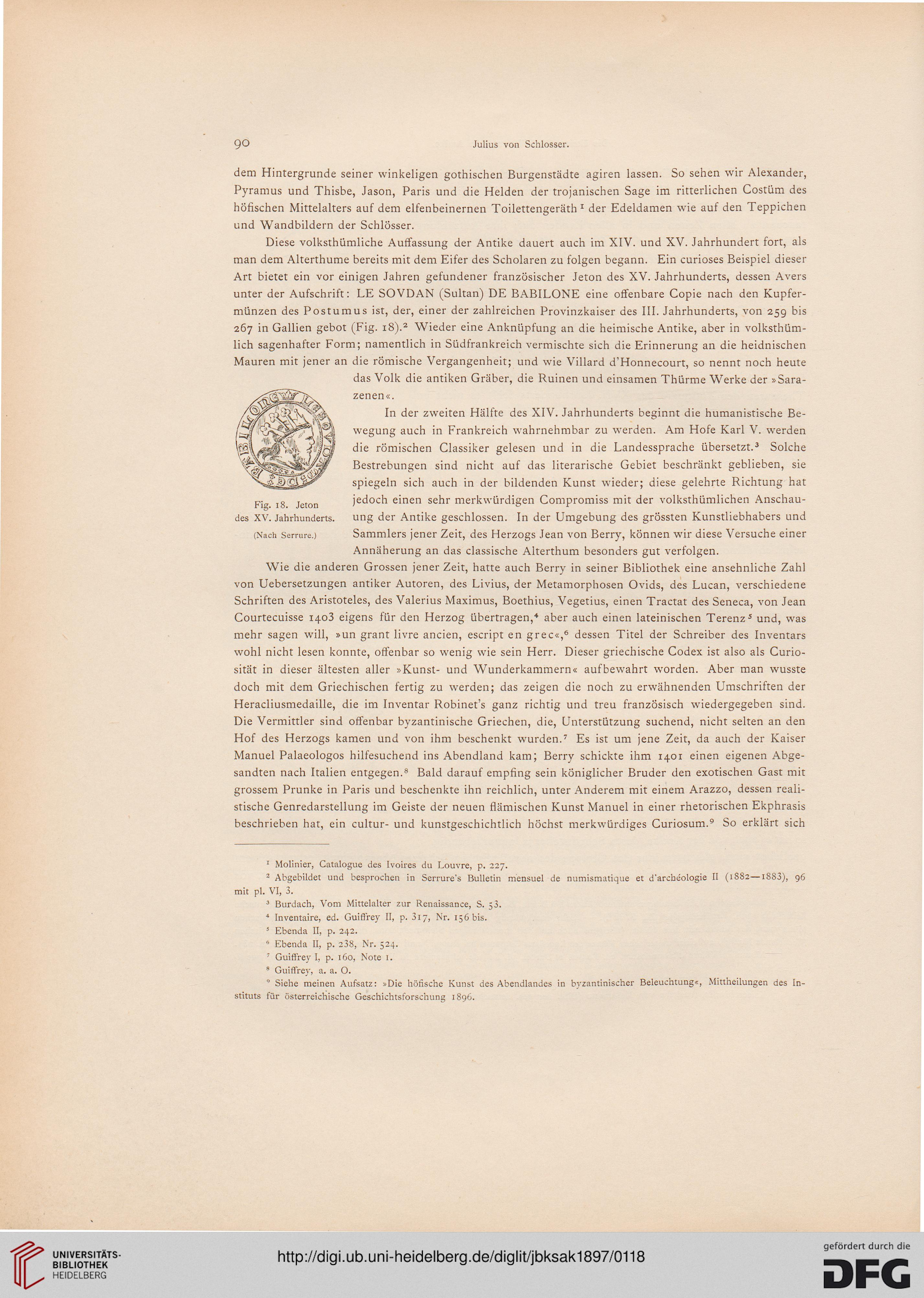go
Julius von Schlosser.
dem Hintergrunde seiner winkeligen gothischen Burgenstädte agiren lassen. So sehen wir Alexander,
Pyramus und Thisbe, Jason, Paris und die Helden der trojanischen Sage im ritterlichen Costüm des
höfischen Mittelalters auf dem elfenbeinernen Toilettengeräth 1 der Edeldamen wie auf den Teppichen
und Wandbildern der Schlösser.
Diese volksthümliche Auffassung der Antike dauert auch im XIV. und XV. Jahrhundert fort, als
man dem Alterthume bereits mit dem Eifer des Scholaren zu folgen begann. Ein curioses Beispiel dieser
Art bietet ein vor einigen Jahren gefundener französischer Jeton des XV. Jahrhunderts, dessen Avers
unter der Aufschrift: LE SOVDAN (Sultan) DE BABILONE eine offenbare Copie nach den Kupfer-
münzen des Postumus ist, der, einer der zahlreichen Provinzkaiser des III. Jahrhunderts, von 25g bis
267 in Gallien gebot (Fig. 18).2 Wieder eine Anknüpfung an die heimische Antike, aber in volkstüm-
lich sagenhafter Form; namentlich in Südfrankreich vermischte sich die Erinnerung an die heidnischen
Mauren mit jener an die römische Vergangenheit; und wie Villard d'Honnecourt, so nennt noch heute
das Volk die antiken Gräber, die Ruinen und einsamen Thürme Werke der »Sara-
zenen«.
In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts beginnt die humanistische Be-
wegung auch in Frankreich wahrnehmbar zu werden. Am Hofe Karl V. werden
die römischen Classiker gelesen und in die Landessprache übersetzt.3 Solche
Bestrebungen sind nicht auf das literarische Gebiet beschränkt geblieben, sie
spiegeln sich auch in der bildenden Kunst wieder; diese gelehrte Richtung hat
jedoch einen sehr merkwürdigen Compromiss mit der volksthümlichen Anschau-
des XV. Jahrhunderts. ung der Antike geschlossen. In der Umgebung des grössten Kunstliebhabers und
(Nach Serrare.) Sammlers jener Zeit, des Herzogs Jean von Berry, können wir diese Versuche einer
Annäherung an das classische Alterthum besonders gut verfolgen.
Wie die anderen Grossen jener Zeit, hatte auch Berry in seiner Bibliothek eine ansehnliche Zahl
von Uebersetzungen antiker Autoren, des Livius, der Metamorphosen Ovids, des Lucan, verschiedene
Schriften des Aristoteles, des Valerius Maximus, Boethius, Vegetius, einen Tractat des Seneca, von Jean
Courtecuisse 1403 eigens für den Herzog übertragen,4 aber auch einen lateinischen Terenz5 und, was
mehr sagen will, »un grant livre ancien, escript en grec«,6 dessen Titel der Schreiber des Inventars
wohl nicht lesen konnte, offenbar so wenig wie sein Herr. Dieser griechische Codex ist also als Curio-
sität in dieser ältesten aller »Kunst- und Wunderkammern« aufbewahrt worden. Aber man wusste
doch mit dem Griechischen fertig zu werden; das zeigen die noch zu erwähnenden Umschriften der
Heracliusmedaille, die im Inventar Robinet's ganz richtig und treu französisch wiedergegeben sind.
Die Vermittler sind offenbar byzantinische Griechen, die, Unterstützung suchend, nicht selten an den
Hof des Herzogs kamen und von ihm beschenkt wurden.7 Es ist um jene Zeit, da auch der Kaiser
Manuel Palaeologos hilfesuchend ins Abendland kam; Berry schickte ihm 1401 einen eigenen Abge-
sandten nach Italien entgegen.8 Bald darauf empfing sein königlicher Bruder den exotischen Gast mit
grossem Prunke in Paris und beschenkte ihn reichlich, unter Anderem mit einem Arazzo, dessen reali-
stische Genredarstellung im Geiste der neuen flämischen Kunst Manuel in einer rhetorischen Ekphrasis
beschrieben hat, ein cultur- und kunstgeschichtlich höchst merkwürdiges Guriosum.9 So erklärt sich
1 Molinier, Catalogue des Ivoires du Louvre, p. 227.
2 Abgebildet und besprochen in Serrure's Bulletin mensuel de numismatique et d'arcbeologie II (1882—1883), 96
mit pl. VI, 3.
3 Burdach, Vom Mittelalter zur Renaissance, S. $3.
4 Inventaire, ed. Guiffrey II, p. 317, Nr. 156 bis.
5 Ebenda II, p. 242.
" Ebenda II, p. 238, Nr. 524.
' Guiffrey I, p. 160, Note 1.
8 Guiffrey, a. a. O.
" Siehe meinen Aufsatz: »Die höfische Kunst des Abendlandes in byzantinischer Beleuchtung«, Mittheilungen des In-
stituts für österreichische Geschichtsforschung 1896.
Julius von Schlosser.
dem Hintergrunde seiner winkeligen gothischen Burgenstädte agiren lassen. So sehen wir Alexander,
Pyramus und Thisbe, Jason, Paris und die Helden der trojanischen Sage im ritterlichen Costüm des
höfischen Mittelalters auf dem elfenbeinernen Toilettengeräth 1 der Edeldamen wie auf den Teppichen
und Wandbildern der Schlösser.
Diese volksthümliche Auffassung der Antike dauert auch im XIV. und XV. Jahrhundert fort, als
man dem Alterthume bereits mit dem Eifer des Scholaren zu folgen begann. Ein curioses Beispiel dieser
Art bietet ein vor einigen Jahren gefundener französischer Jeton des XV. Jahrhunderts, dessen Avers
unter der Aufschrift: LE SOVDAN (Sultan) DE BABILONE eine offenbare Copie nach den Kupfer-
münzen des Postumus ist, der, einer der zahlreichen Provinzkaiser des III. Jahrhunderts, von 25g bis
267 in Gallien gebot (Fig. 18).2 Wieder eine Anknüpfung an die heimische Antike, aber in volkstüm-
lich sagenhafter Form; namentlich in Südfrankreich vermischte sich die Erinnerung an die heidnischen
Mauren mit jener an die römische Vergangenheit; und wie Villard d'Honnecourt, so nennt noch heute
das Volk die antiken Gräber, die Ruinen und einsamen Thürme Werke der »Sara-
zenen«.
In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts beginnt die humanistische Be-
wegung auch in Frankreich wahrnehmbar zu werden. Am Hofe Karl V. werden
die römischen Classiker gelesen und in die Landessprache übersetzt.3 Solche
Bestrebungen sind nicht auf das literarische Gebiet beschränkt geblieben, sie
spiegeln sich auch in der bildenden Kunst wieder; diese gelehrte Richtung hat
jedoch einen sehr merkwürdigen Compromiss mit der volksthümlichen Anschau-
des XV. Jahrhunderts. ung der Antike geschlossen. In der Umgebung des grössten Kunstliebhabers und
(Nach Serrare.) Sammlers jener Zeit, des Herzogs Jean von Berry, können wir diese Versuche einer
Annäherung an das classische Alterthum besonders gut verfolgen.
Wie die anderen Grossen jener Zeit, hatte auch Berry in seiner Bibliothek eine ansehnliche Zahl
von Uebersetzungen antiker Autoren, des Livius, der Metamorphosen Ovids, des Lucan, verschiedene
Schriften des Aristoteles, des Valerius Maximus, Boethius, Vegetius, einen Tractat des Seneca, von Jean
Courtecuisse 1403 eigens für den Herzog übertragen,4 aber auch einen lateinischen Terenz5 und, was
mehr sagen will, »un grant livre ancien, escript en grec«,6 dessen Titel der Schreiber des Inventars
wohl nicht lesen konnte, offenbar so wenig wie sein Herr. Dieser griechische Codex ist also als Curio-
sität in dieser ältesten aller »Kunst- und Wunderkammern« aufbewahrt worden. Aber man wusste
doch mit dem Griechischen fertig zu werden; das zeigen die noch zu erwähnenden Umschriften der
Heracliusmedaille, die im Inventar Robinet's ganz richtig und treu französisch wiedergegeben sind.
Die Vermittler sind offenbar byzantinische Griechen, die, Unterstützung suchend, nicht selten an den
Hof des Herzogs kamen und von ihm beschenkt wurden.7 Es ist um jene Zeit, da auch der Kaiser
Manuel Palaeologos hilfesuchend ins Abendland kam; Berry schickte ihm 1401 einen eigenen Abge-
sandten nach Italien entgegen.8 Bald darauf empfing sein königlicher Bruder den exotischen Gast mit
grossem Prunke in Paris und beschenkte ihn reichlich, unter Anderem mit einem Arazzo, dessen reali-
stische Genredarstellung im Geiste der neuen flämischen Kunst Manuel in einer rhetorischen Ekphrasis
beschrieben hat, ein cultur- und kunstgeschichtlich höchst merkwürdiges Guriosum.9 So erklärt sich
1 Molinier, Catalogue des Ivoires du Louvre, p. 227.
2 Abgebildet und besprochen in Serrure's Bulletin mensuel de numismatique et d'arcbeologie II (1882—1883), 96
mit pl. VI, 3.
3 Burdach, Vom Mittelalter zur Renaissance, S. $3.
4 Inventaire, ed. Guiffrey II, p. 317, Nr. 156 bis.
5 Ebenda II, p. 242.
" Ebenda II, p. 238, Nr. 524.
' Guiffrey I, p. 160, Note 1.
8 Guiffrey, a. a. O.
" Siehe meinen Aufsatz: »Die höfische Kunst des Abendlandes in byzantinischer Beleuchtung«, Mittheilungen des In-
stituts für österreichische Geschichtsforschung 1896.