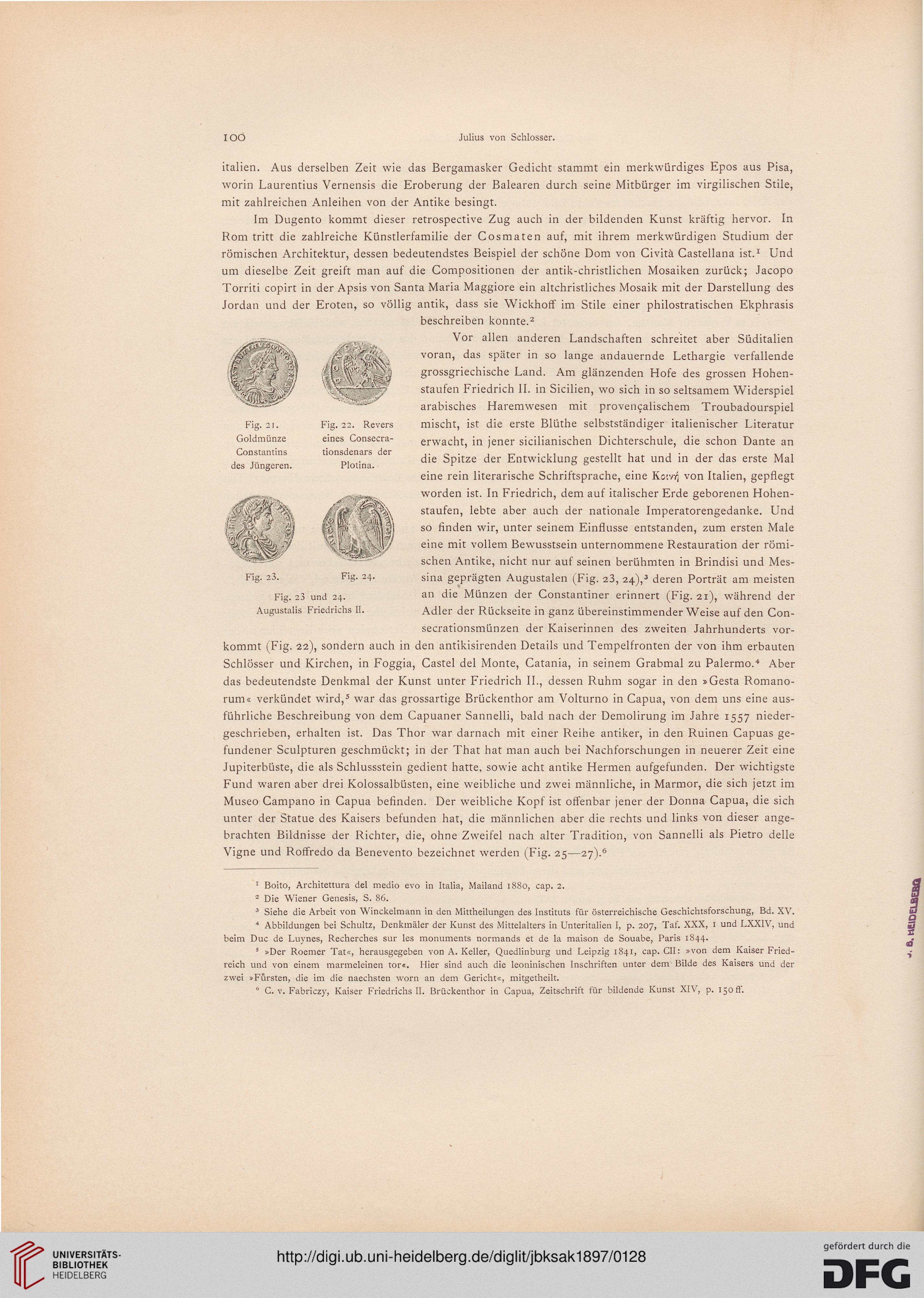IOO
Julius von Schlosser.
italien. Aus derselben Zeit wie das Bergamasker Gedicht stammt ein merkwürdiges Epos aus Pisa,
worin Laurentius Vernensis die Eroberung der Balearen durch seine Mitbürger im virgilischen Stile,
mit zahlreichen Anleihen von der Antike besingt.
Im Dugento kommt dieser retrospective Zug auch in der bildenden Kunst kräftig hervor. In
Rom tritt die zahlreiche Künstlerfamilie der Cosmaten auf, mit ihrem merkwürdigen Studium der
römischen Architektur, dessen bedeutendstes Beispiel der schöne Dom von Givitä Castellana ist.1 Und
um dieselbe Zeit greift man auf die Compositionen der antik-christlichen Mosaiken zurück; Jacopo
Torriti copirt in der Apsis von Santa Maria Maggiore ein altchristliches Mosaik mit der Darstellung des
Jordan und der Eroten, so völlig antik, dass sie Wickhoff im Stile einer philostratischen Ekphrasis
beschreiben konnte.2
Vor allen anderen Landschaften schreitet aber Süditalien
voran, das später in so lange andauernde Lethargie verfallende
grossgriechische Land. Am glänzenden Hofe des grossen Hohen-
staufen Friedrich II, in Sicilien, wo sich in so seltsamem Widerspiel
arabisches Haremwesen mit provencalischem Troubadourspiel
mischt, ist die erste Blüthe selbstständiger italienischer Literatur
erwacht, in jener sicilianischen Dichterschule, die schon Dante an
die Spitze der Entwicklung gestellt hat und in der das erste Mal
eine rein literarische Schriftsprache, eine Kotvij von Italien, gepflegt
worden ist. In Friedrich, dem auf italischer Erde geborenen Hohen-
staufen, lebte aber auch der nationale Imperatorengedanke. Und
so finden wir, unter seinem Einflüsse entstanden, zum ersten Male
eine mit vollem Bewusstsein unternommene Restauration der römi-
schen Antike, nicht nur auf seinen berühmten in Brindisi und Mes-
sina geprägten Augustalen (Fig. 23, 24),3 deren Porträt am meisten
an die Münzen der Constantiner erinnert (Fig. 21), während der
Adler der Rückseite in ganz übereinstimmender Weise auf den Con-
secrationsmünzen der Kaiserinnen des zweiten Jahrhunderts vor-
kommt (Fig. 22), sondern auch in den antikisirenden Details und Tempelfronten der von ihm erbauten
Schlösser und Kirchen, in Foggia, Castel del Monte, Catania, in seinem Grabmal zu Palermo.4 Aber
das bedeutendste Denkmal der Kunst unter Friedrich II., dessen Ruhm sogar in den »Gesta Romano-
rum« verkündet wird,5 war das grossartige Brückenthor am Volturno in Capua, von dem uns eine aus-
führliche Beschreibung von dem Capuaner Sannelli, bald nach der Demolirung im Jahre 1557 nieder-
geschrieben, erhalten ist. Das Thor war darnach mit einer Reihe antiker, in den Ruinen Capuas ge-
fundener Sculpturen geschmückt; in der That hat man auch bei Nachforschungen in neuerer Zeit eine
Jupiterbüste, die als Schlussstein gedient hatte, sowie acht antike Hermen aufgefunden. Der wichtigste
Fund waren aber drei Kolossalbüsten, eine weibliche und zwei männliche, in Marmor, die sich jetzt im
Museo Campano in Capua befinden. Der weibliche Kopf ist offenbar jener der Donna Capua, die sich
unter der Statue des Kaisers befunden hat, die männlichen aber die rechts und links von dieser ange-
brachten Bildnisse der Richter, die, ohne Zweifel nach alter Tradition, von Sannelli als Pietro delle
Vigne und Roffredo da Benevento bezeichnet werden (Fig. 25—27).6
1 Boito, Architettura del medio evo in Italia, Mailand 1880, cap. 2.
2 Die Wiener Genesis, S. 86.
3 Siehe die Arbeit von Winckelmann in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. XV.
4 Abbildungen bei Schultz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien I, p. 207, Taf. XXX, 1 und LXXIV, und
beim Duc de Luynes, Recherches sur les monuments normands et de la maison de Souabe, Paris 1844.
s »Der Roemer Tat«, herausgegeben von A. Keller, Quedlinburg und Leipzig 1841, cap. CII: »von dem Kaiser Fried-
reich und von einem marmeleinen tor«. Hier sind auch die leoninischen Inschriften unter dem Bilde des Kaisers und der
zwei »Fürsten, die im die naechsten worn an dem Gericht«, mitgetheilt.
6 C. v. Fabriczy, Kaiser Friedrichs II. Brückenthor in Capua, Zeitschrift für bildende Kunst XIV, p. 150 ff.
r
i1&
Fig. 21.
Goldmünze
Constantins
des Jüngeren.
Fig. 22. Revers
eines Consecra-
tionsdenars der
Plolina.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 23 und 24.
Augustalis Friedrichs II.
Julius von Schlosser.
italien. Aus derselben Zeit wie das Bergamasker Gedicht stammt ein merkwürdiges Epos aus Pisa,
worin Laurentius Vernensis die Eroberung der Balearen durch seine Mitbürger im virgilischen Stile,
mit zahlreichen Anleihen von der Antike besingt.
Im Dugento kommt dieser retrospective Zug auch in der bildenden Kunst kräftig hervor. In
Rom tritt die zahlreiche Künstlerfamilie der Cosmaten auf, mit ihrem merkwürdigen Studium der
römischen Architektur, dessen bedeutendstes Beispiel der schöne Dom von Givitä Castellana ist.1 Und
um dieselbe Zeit greift man auf die Compositionen der antik-christlichen Mosaiken zurück; Jacopo
Torriti copirt in der Apsis von Santa Maria Maggiore ein altchristliches Mosaik mit der Darstellung des
Jordan und der Eroten, so völlig antik, dass sie Wickhoff im Stile einer philostratischen Ekphrasis
beschreiben konnte.2
Vor allen anderen Landschaften schreitet aber Süditalien
voran, das später in so lange andauernde Lethargie verfallende
grossgriechische Land. Am glänzenden Hofe des grossen Hohen-
staufen Friedrich II, in Sicilien, wo sich in so seltsamem Widerspiel
arabisches Haremwesen mit provencalischem Troubadourspiel
mischt, ist die erste Blüthe selbstständiger italienischer Literatur
erwacht, in jener sicilianischen Dichterschule, die schon Dante an
die Spitze der Entwicklung gestellt hat und in der das erste Mal
eine rein literarische Schriftsprache, eine Kotvij von Italien, gepflegt
worden ist. In Friedrich, dem auf italischer Erde geborenen Hohen-
staufen, lebte aber auch der nationale Imperatorengedanke. Und
so finden wir, unter seinem Einflüsse entstanden, zum ersten Male
eine mit vollem Bewusstsein unternommene Restauration der römi-
schen Antike, nicht nur auf seinen berühmten in Brindisi und Mes-
sina geprägten Augustalen (Fig. 23, 24),3 deren Porträt am meisten
an die Münzen der Constantiner erinnert (Fig. 21), während der
Adler der Rückseite in ganz übereinstimmender Weise auf den Con-
secrationsmünzen der Kaiserinnen des zweiten Jahrhunderts vor-
kommt (Fig. 22), sondern auch in den antikisirenden Details und Tempelfronten der von ihm erbauten
Schlösser und Kirchen, in Foggia, Castel del Monte, Catania, in seinem Grabmal zu Palermo.4 Aber
das bedeutendste Denkmal der Kunst unter Friedrich II., dessen Ruhm sogar in den »Gesta Romano-
rum« verkündet wird,5 war das grossartige Brückenthor am Volturno in Capua, von dem uns eine aus-
führliche Beschreibung von dem Capuaner Sannelli, bald nach der Demolirung im Jahre 1557 nieder-
geschrieben, erhalten ist. Das Thor war darnach mit einer Reihe antiker, in den Ruinen Capuas ge-
fundener Sculpturen geschmückt; in der That hat man auch bei Nachforschungen in neuerer Zeit eine
Jupiterbüste, die als Schlussstein gedient hatte, sowie acht antike Hermen aufgefunden. Der wichtigste
Fund waren aber drei Kolossalbüsten, eine weibliche und zwei männliche, in Marmor, die sich jetzt im
Museo Campano in Capua befinden. Der weibliche Kopf ist offenbar jener der Donna Capua, die sich
unter der Statue des Kaisers befunden hat, die männlichen aber die rechts und links von dieser ange-
brachten Bildnisse der Richter, die, ohne Zweifel nach alter Tradition, von Sannelli als Pietro delle
Vigne und Roffredo da Benevento bezeichnet werden (Fig. 25—27).6
1 Boito, Architettura del medio evo in Italia, Mailand 1880, cap. 2.
2 Die Wiener Genesis, S. 86.
3 Siehe die Arbeit von Winckelmann in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. XV.
4 Abbildungen bei Schultz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien I, p. 207, Taf. XXX, 1 und LXXIV, und
beim Duc de Luynes, Recherches sur les monuments normands et de la maison de Souabe, Paris 1844.
s »Der Roemer Tat«, herausgegeben von A. Keller, Quedlinburg und Leipzig 1841, cap. CII: »von dem Kaiser Fried-
reich und von einem marmeleinen tor«. Hier sind auch die leoninischen Inschriften unter dem Bilde des Kaisers und der
zwei »Fürsten, die im die naechsten worn an dem Gericht«, mitgetheilt.
6 C. v. Fabriczy, Kaiser Friedrichs II. Brückenthor in Capua, Zeitschrift für bildende Kunst XIV, p. 150 ff.
r
i1&
Fig. 21.
Goldmünze
Constantins
des Jüngeren.
Fig. 22. Revers
eines Consecra-
tionsdenars der
Plolina.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 23 und 24.
Augustalis Friedrichs II.