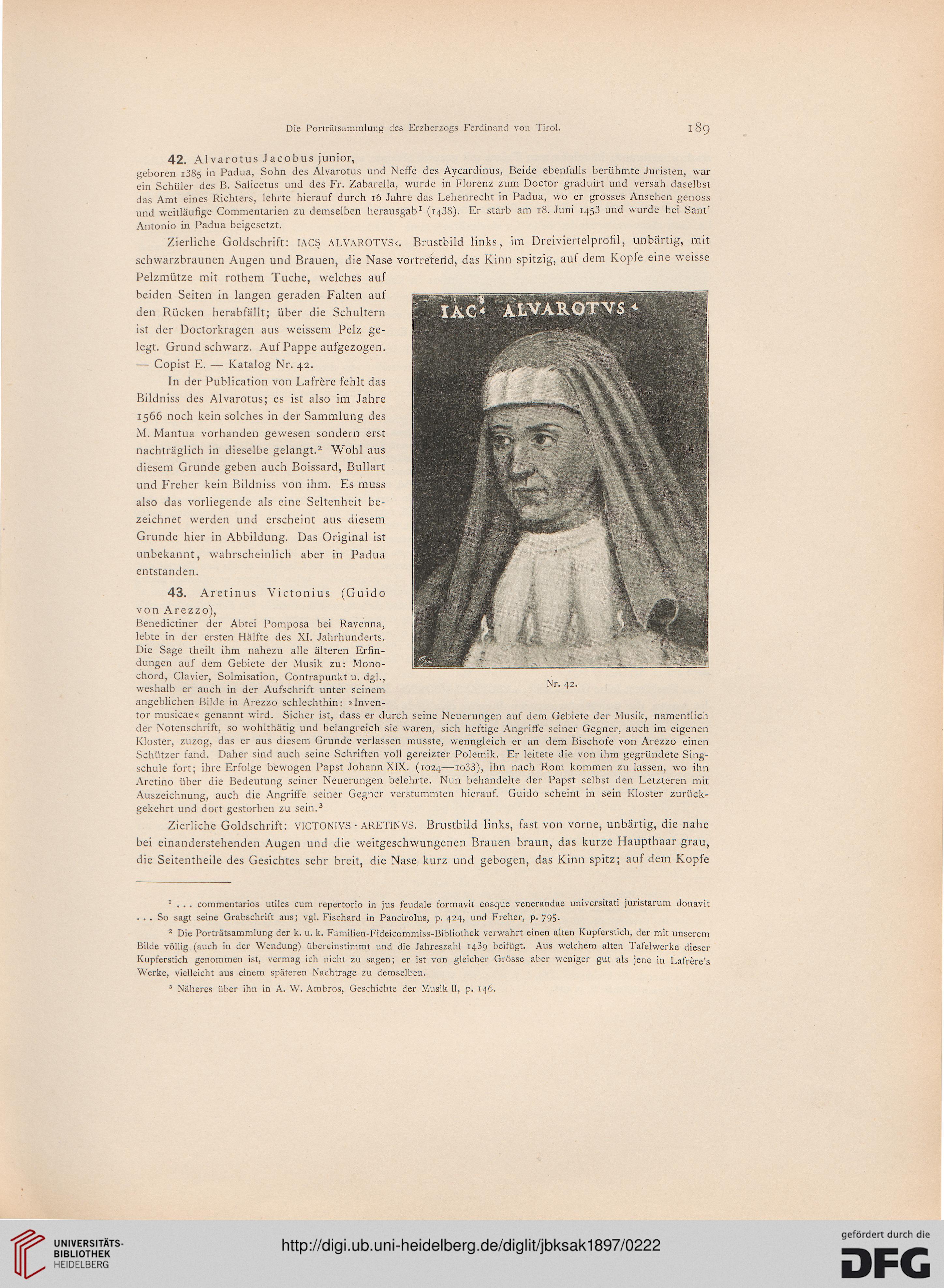Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol.
189
lAC« ALVAROTVS *
42. Alvarotus Jacobus junior,
geboren 1385 in Padua, Sohn des Alvarotus und Neffe des Aycardinus, Beide ebenfalls berühmte Juristen, war
ein Schüler des B. Salicetus und des Fr. Zabarella, wurde in Florenz zum Doctor graduirt und versah daselbst
das Amt eines Richters, lehrte hierauf durch 16 Jahre das Lehenrecht in Padua, wo er grosses Ansehen genoss
und weitläufige Commentarien zu demselben herausgab1 (1438). Er starb am 18. Juni 1453 und wurde bei Sant'
Antonio in Padua beigesetzt.
Zierliche Goldschrift: IACS ALVAROTVS<. Brustbild links, im Dreiviertelprofil, unbärtig, mit
schwarzbraunen Augen und Brauen, die Nase vortreterid, das Kinn spitzig, auf dem Kopfe eine weisse
Pelzmütze mit rothem Tuche, welches auf
beiden Seiten in langen geraden Falten auf
den Rücken herabfällt; über die Schultern
ist der Doctorkragen aus weissem Pelz ge-
legt. Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen.
— Copist E. — Katalog Nr. 42.
In der Publication von Lafrere fehlt das
Bildniss des Alvarotus; es ist also im Jahre
1566 noch kein solches in der Sammlung des
M. Mantua vorhanden gewesen sondern erst
nachträglich in dieselbe gelangt.2 Wohl aus
diesem Grunde geben auch Boissard, Bullart
und Freher kein Bildniss von ihm. Es muss
also das vorliegende als eine Seltenheit be-
zeichnet werden und erscheint aus diesem
Grunde hier in Abbildung. Das Original ist
unbekannt, wahrscheinlich aber in Padua
entstanden.
43. Aretinus Victonius (Guido
von Arezzo),
Benedictiner der Abtei Pomposa bei Ravenna,
lebte in der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts.
Die Sage theilt ihm nahezu alle älteren Erfin-
dungen auf dem Gebiete der Musik zu: Mono-
chord, Ciavier, Solmisation, Contrapunkt u. dgl.,
weshalb er auch in der Aufschrift unter seinem
angeblichen Bilde in Arezzo schlechthin: »Inven-
tor musicae« genannt wird. Sicher ist, dass er durch seine Neuerungen auf dem Gebiete der Musik, namentlich
der Notenschrift, so wohlthätig und belangreich sie waren, sich heftige Angriffe seiner Gegner, auch im eigenen
Kloster, zuzog, das er aus diesem Grunde verlassen musste, wenngleich er an dem Bischöfe von Arezzo einen
Schützer fand. Daher sind auch seine Schriften voll gereizter Polemik. Er leitete die von ihm gegründete Sing-
schule fort; ihre Erfolge bewogen Papst Johann XIX. (1024—io33), ihn nach Rom kommen zu lassen, wo ihn
Aretino über die Bedeutung seiner Neuerungen belehrte. Nun behandelte der Papst selbst den Letzteren mit
Auszeichnung, auch die Angriffe seiner Gegner verstummten hierauf. Guido scheint in sein Kloster zurück-
gekehrt und dort gestorben zu sein.3
Zierliche Goldschrift: VICTONIVS • ARETINVS. Brustbild links, fast von vorne, unbärtig, die nahe
bei einanderstehenden Augen und die weitgeschwungenen Brauen braun, das kurze Haupthaar grau,
die Seitentheile des Gesichtes sehr breit, die Nase kurz und gebogen, das Kinn spitz; auf dem Kopfe
Nr. 42.
1 . . . commentarios utiles cum repertorio in jus feudale formavit eosque venerandae universitati juristarum donavit
. . . So sagt seine Grabschrift aus; vgl. Fischard in Pancirolus, p. 424, und Freher, p. 795.
2 Die Porträtsammlung der k. u. k. Familien-Fidcicommiss-Bibliothek verwahrt einen alten Kupferstich, der mit unserem
Bilde völlig (auch in der Wendung) übereinstimmt und die Jahreszahl 1439 beifügt. Aus welchem alten Tafclwcrke dieser
Kupferstich genommen ist, vermag ich nicht zu sagen; er ist von gleicher Grösse aber weniger gut als jene in Lafrere's
Werke, vielleicht aus einem späteren Nachtrage zu demselben.
3 Näheres über ihn in A. W. Ambros, Geschichte der Musik II, p. 146.
189
lAC« ALVAROTVS *
42. Alvarotus Jacobus junior,
geboren 1385 in Padua, Sohn des Alvarotus und Neffe des Aycardinus, Beide ebenfalls berühmte Juristen, war
ein Schüler des B. Salicetus und des Fr. Zabarella, wurde in Florenz zum Doctor graduirt und versah daselbst
das Amt eines Richters, lehrte hierauf durch 16 Jahre das Lehenrecht in Padua, wo er grosses Ansehen genoss
und weitläufige Commentarien zu demselben herausgab1 (1438). Er starb am 18. Juni 1453 und wurde bei Sant'
Antonio in Padua beigesetzt.
Zierliche Goldschrift: IACS ALVAROTVS<. Brustbild links, im Dreiviertelprofil, unbärtig, mit
schwarzbraunen Augen und Brauen, die Nase vortreterid, das Kinn spitzig, auf dem Kopfe eine weisse
Pelzmütze mit rothem Tuche, welches auf
beiden Seiten in langen geraden Falten auf
den Rücken herabfällt; über die Schultern
ist der Doctorkragen aus weissem Pelz ge-
legt. Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen.
— Copist E. — Katalog Nr. 42.
In der Publication von Lafrere fehlt das
Bildniss des Alvarotus; es ist also im Jahre
1566 noch kein solches in der Sammlung des
M. Mantua vorhanden gewesen sondern erst
nachträglich in dieselbe gelangt.2 Wohl aus
diesem Grunde geben auch Boissard, Bullart
und Freher kein Bildniss von ihm. Es muss
also das vorliegende als eine Seltenheit be-
zeichnet werden und erscheint aus diesem
Grunde hier in Abbildung. Das Original ist
unbekannt, wahrscheinlich aber in Padua
entstanden.
43. Aretinus Victonius (Guido
von Arezzo),
Benedictiner der Abtei Pomposa bei Ravenna,
lebte in der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts.
Die Sage theilt ihm nahezu alle älteren Erfin-
dungen auf dem Gebiete der Musik zu: Mono-
chord, Ciavier, Solmisation, Contrapunkt u. dgl.,
weshalb er auch in der Aufschrift unter seinem
angeblichen Bilde in Arezzo schlechthin: »Inven-
tor musicae« genannt wird. Sicher ist, dass er durch seine Neuerungen auf dem Gebiete der Musik, namentlich
der Notenschrift, so wohlthätig und belangreich sie waren, sich heftige Angriffe seiner Gegner, auch im eigenen
Kloster, zuzog, das er aus diesem Grunde verlassen musste, wenngleich er an dem Bischöfe von Arezzo einen
Schützer fand. Daher sind auch seine Schriften voll gereizter Polemik. Er leitete die von ihm gegründete Sing-
schule fort; ihre Erfolge bewogen Papst Johann XIX. (1024—io33), ihn nach Rom kommen zu lassen, wo ihn
Aretino über die Bedeutung seiner Neuerungen belehrte. Nun behandelte der Papst selbst den Letzteren mit
Auszeichnung, auch die Angriffe seiner Gegner verstummten hierauf. Guido scheint in sein Kloster zurück-
gekehrt und dort gestorben zu sein.3
Zierliche Goldschrift: VICTONIVS • ARETINVS. Brustbild links, fast von vorne, unbärtig, die nahe
bei einanderstehenden Augen und die weitgeschwungenen Brauen braun, das kurze Haupthaar grau,
die Seitentheile des Gesichtes sehr breit, die Nase kurz und gebogen, das Kinn spitz; auf dem Kopfe
Nr. 42.
1 . . . commentarios utiles cum repertorio in jus feudale formavit eosque venerandae universitati juristarum donavit
. . . So sagt seine Grabschrift aus; vgl. Fischard in Pancirolus, p. 424, und Freher, p. 795.
2 Die Porträtsammlung der k. u. k. Familien-Fidcicommiss-Bibliothek verwahrt einen alten Kupferstich, der mit unserem
Bilde völlig (auch in der Wendung) übereinstimmt und die Jahreszahl 1439 beifügt. Aus welchem alten Tafclwcrke dieser
Kupferstich genommen ist, vermag ich nicht zu sagen; er ist von gleicher Grösse aber weniger gut als jene in Lafrere's
Werke, vielleicht aus einem späteren Nachtrage zu demselben.
3 Näheres über ihn in A. W. Ambros, Geschichte der Musik II, p. 146.