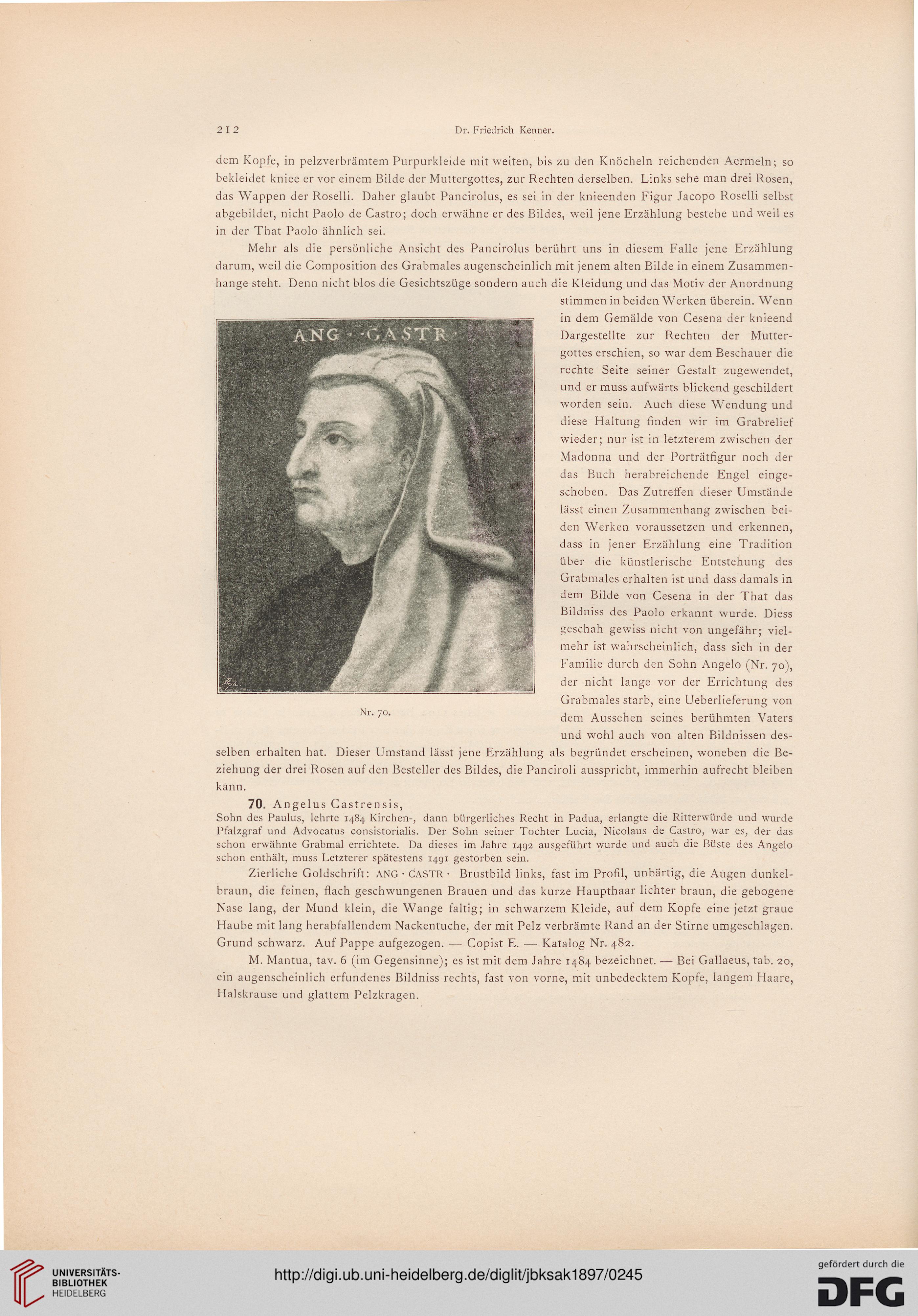2 1°
Dr. Friedrich Kenner.
dem Kopie, in pelzverbrämtem Purpurkleide mit weiten, bis zu den Knöcheln reichenden Aermeln; so
bekleidet kniee er vor einem Bilde der Muttergottes, zur Rechten derselben. Links sehe man drei Rosen,
das Wappen der Roselli. Daher glaubt Pancirolus, es sei in der knieenden Figur Jacopo Roselli selbst
abgebildet, nicht Paolo de Castro; doch erwähne er des Bildes, weil jene Erzählung bestehe und weil es
in der That Paolo ähnlich sei.
Mehr als die persönliche Ansicht des Pancirolus berührt uns in diesem Falle jene Erzählung
darum, weil die Composition des Grabmales augenscheinlich mit jenem alten Bilde in einem Zusammen-
hange steht. Denn nicht blos die Gesichtszüge sondern auch die Kleidung und das Motiv der Anordnung
stimmen in beiden Werken überein. Wenn
in dem Gemälde von Cesena der knieend
Dargestellte zur Rechten der Mutter-
gottes erschien, so war dem Beschauer die
rechte Seite seiner Gestalt zugewendet,
und er muss aufwärts blickend geschildert
worden sein. Auch diese Wendung und
diese Haltung finden wir im Grabrelief
wieder; nur ist in letzterem zwischen der
Madonna und der Porträtfigur noch der
das Buch herabreichende Engel einge-
schoben. Das Zutreffen dieser Umstände
lässt einen Zusammenhang zwischen bei-
den Werken voraussetzen und erkennen,
dass in jener Erzählung eine Tradition
über die künstlerische Entstehung des
Grabmales erhalten ist und dass damals in
dem Bilde von Cesena in der That das
Büdniss des Paolo erkannt wurde. Diess
geschah gewiss nicht von ungefähr; viel-
mehr ist wahrscheinlich, dass sich in der
Familie durch den Sohn Angelo (Nr. 70),
der nicht lange vor der Errichtung des
Grabmales starb, eine Ueberlieferung von
dem Aussehen seines berühmten Vaters
und wohl auch von alten Bildnissen des-
selben erhalten hat. Dieser Umstand lässt jene Erzählung als begründet erscheinen, woneben die Be-
ziehung der drei Rosen auf den Besteller des Bildes, die Panciroli ausspricht, immerhin aufrecht bleiben
kann.
70. Angelus Castrensis,
Sohn des Paulus, lehrte 1484 Kirchen-, dann bürgerliches Recht in Padua, erlangte die Ritterwürde und wurde
Pfalzgraf und Advocatus consistorialis. Der Sohn seiner Tochter Lucia, Nicolaus de Castro, war es, der das
schon erwähnte Grabmal errichtete. Da dieses im Jahre 1492 ausgeführt wurde und auch die Büste des Angelo
schon enthält, muss Letzterer spätestens 1491 gestorben sein.
Zierliche Goldschrift: ANG • CASTR • Brustbild links, fast im Profil, unbärtig, die Augen dunkel-
braun, die feinen, flach geschwungenen Brauen und das kurze Haupthaar lichter braun, die gebogene
Nase lang, der Mund klein, die Wange faltig; in schwarzem Kleide, auf dem Kopfe eine jetzt graue
Haube mit lang herabfallendem Nackentuche, der mit Pelz verbrämte Rand an der Stirne umgeschlagen.
Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen. — Copist E. — Katalog Nr. 482.
M. Mantua, tav. 6 (im Gegensinne); es ist mit dem Jahre 1484 bezeichnet. — Bei Gallaeus, tab. 20,
ein augenscheinlich erfundenes Bildniss rechts, fast von vorne, mit unbedecktem Kopfe, langem Haare,
Halskrause und glattem Pelzkragen.
Dr. Friedrich Kenner.
dem Kopie, in pelzverbrämtem Purpurkleide mit weiten, bis zu den Knöcheln reichenden Aermeln; so
bekleidet kniee er vor einem Bilde der Muttergottes, zur Rechten derselben. Links sehe man drei Rosen,
das Wappen der Roselli. Daher glaubt Pancirolus, es sei in der knieenden Figur Jacopo Roselli selbst
abgebildet, nicht Paolo de Castro; doch erwähne er des Bildes, weil jene Erzählung bestehe und weil es
in der That Paolo ähnlich sei.
Mehr als die persönliche Ansicht des Pancirolus berührt uns in diesem Falle jene Erzählung
darum, weil die Composition des Grabmales augenscheinlich mit jenem alten Bilde in einem Zusammen-
hange steht. Denn nicht blos die Gesichtszüge sondern auch die Kleidung und das Motiv der Anordnung
stimmen in beiden Werken überein. Wenn
in dem Gemälde von Cesena der knieend
Dargestellte zur Rechten der Mutter-
gottes erschien, so war dem Beschauer die
rechte Seite seiner Gestalt zugewendet,
und er muss aufwärts blickend geschildert
worden sein. Auch diese Wendung und
diese Haltung finden wir im Grabrelief
wieder; nur ist in letzterem zwischen der
Madonna und der Porträtfigur noch der
das Buch herabreichende Engel einge-
schoben. Das Zutreffen dieser Umstände
lässt einen Zusammenhang zwischen bei-
den Werken voraussetzen und erkennen,
dass in jener Erzählung eine Tradition
über die künstlerische Entstehung des
Grabmales erhalten ist und dass damals in
dem Bilde von Cesena in der That das
Büdniss des Paolo erkannt wurde. Diess
geschah gewiss nicht von ungefähr; viel-
mehr ist wahrscheinlich, dass sich in der
Familie durch den Sohn Angelo (Nr. 70),
der nicht lange vor der Errichtung des
Grabmales starb, eine Ueberlieferung von
dem Aussehen seines berühmten Vaters
und wohl auch von alten Bildnissen des-
selben erhalten hat. Dieser Umstand lässt jene Erzählung als begründet erscheinen, woneben die Be-
ziehung der drei Rosen auf den Besteller des Bildes, die Panciroli ausspricht, immerhin aufrecht bleiben
kann.
70. Angelus Castrensis,
Sohn des Paulus, lehrte 1484 Kirchen-, dann bürgerliches Recht in Padua, erlangte die Ritterwürde und wurde
Pfalzgraf und Advocatus consistorialis. Der Sohn seiner Tochter Lucia, Nicolaus de Castro, war es, der das
schon erwähnte Grabmal errichtete. Da dieses im Jahre 1492 ausgeführt wurde und auch die Büste des Angelo
schon enthält, muss Letzterer spätestens 1491 gestorben sein.
Zierliche Goldschrift: ANG • CASTR • Brustbild links, fast im Profil, unbärtig, die Augen dunkel-
braun, die feinen, flach geschwungenen Brauen und das kurze Haupthaar lichter braun, die gebogene
Nase lang, der Mund klein, die Wange faltig; in schwarzem Kleide, auf dem Kopfe eine jetzt graue
Haube mit lang herabfallendem Nackentuche, der mit Pelz verbrämte Rand an der Stirne umgeschlagen.
Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen. — Copist E. — Katalog Nr. 482.
M. Mantua, tav. 6 (im Gegensinne); es ist mit dem Jahre 1484 bezeichnet. — Bei Gallaeus, tab. 20,
ein augenscheinlich erfundenes Bildniss rechts, fast von vorne, mit unbedecktem Kopfe, langem Haare,
Halskrause und glattem Pelzkragen.