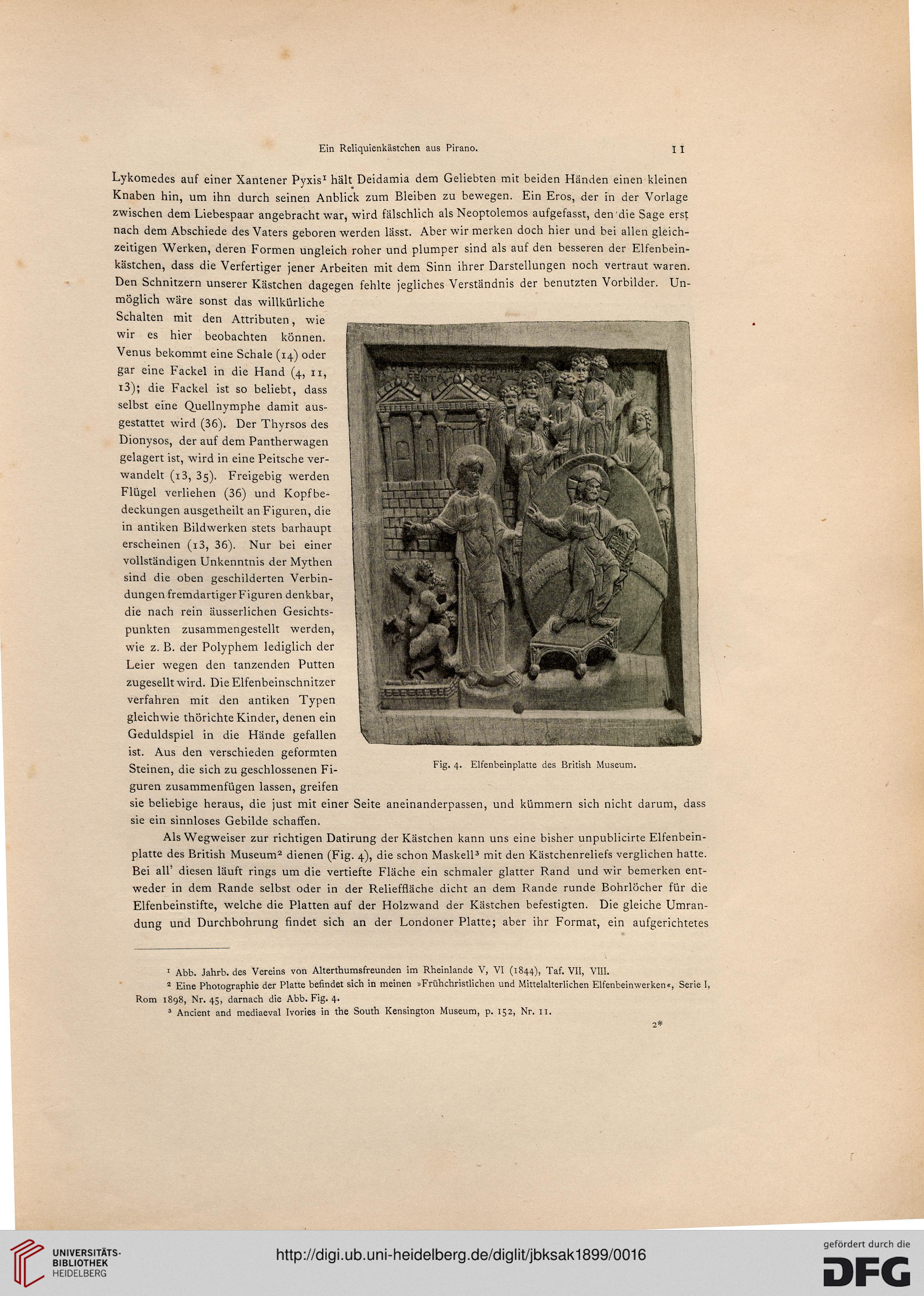Ein Reliquienkästchen aus Pirano.
II
Lykomedes auf einer Xantener Pvxis1 hält Deidamia dem Geliebten mit beiden Händen einen kleinen
Knaben hin, um ihn durch seinen Anblick zum Bleiben zu bewegen. Ein Eros, der in der Vorlage
zwischen dem Liebespaar angebracht war, wird fälschlich als Neoptolemos aufgefasst, den die Sage erst
nach dem Abschiede des Vaters geboren werden lässt. Aber wir merken doch hier und bei allen gleich-
zeitigen Werken, deren Formen ungleich roher und plumper sind als auf den besseren der Elfenbein-
kästchen, dass die Verfertiger jener Arbeiten mit dem Sinn ihrer Darstellungen noch vertraut waren.
Den Schnitzern unserer Kästchen dagegen fehlte jegliches Verständnis der benutzten Vorbilder. Un-
möglich wäre sonst das willkürliche
Schalten mit den Attributen, wie
wir es hier beobachten können.
Venus bekommt eine Schale (14) oder
gar eine Fackel in die Hand (4, n,
i3); die Fackel ist so beliebt, dass
selbst eine Quellnymphe damit aus-
gestattet wird (36). Der Thyrsos des
Dionysos, der auf dem Pantherwagen
gelagert ist, wird in eine Peitsche ver-
wandelt (i3, 35). Freigebig werden
Flügel verliehen (36) und Kopfbe-
deckungen ausgetheilt an Figuren, die
in antiken Bildwerken stets barhaupt
erscheinen (i3, 36). Nur bei einer
vollständigen Unkenntnis der Mythen
sind die oben geschilderten Verbin-
dungen fremdartiger Figuren denkbar,
die nach rein äusserlichen Gesichts-
punkten zusammengestellt werden,
wie z. B. der Polyphem lediglich der
Leier wegen den tanzenden Putten
zugesellt wird. Die Elfenbeinschnitzer
verfahren mit den antiken Typen
gleichwie thörichte Kinder, denen ein
Geduldspiel in die Hände gefallen
ist. Aus den verschieden geformten
Steinen, die sich zu geschlossenen Fi-
guren zusammenfügen lassen, greifen
Fig. 4. Elfenbeinplatte des British Museum.
sie beliebige heraus, die just mit einer Seite aneinanderpassen, und kümmern sich nicht darum, dass
sie ein sinnloses Gebilde schaffen.
Als Wegweiser zur richtigen Datirung der Kästchen kann uns eine bisher unpublicirte Elfenbein-
platte des British Museum2 dienen (Fig. 4), die schon Maskell3 mit den Kästchenreliefs verglichen hatte.
Bei all' diesen läuft rings um die vertiefte Fläche ein schmaler glatter Rand und wir bemerken ent-
weder in dem Rande selbst oder in der Relieffläche dicht an dem Rande runde Bohrlöcher für die
Elfenbeinstifte, welche die Platten auf der Holzwand der Kästchen befestigten. Die gleiche Umran-
dung und Durchbohrung findet sich an der Londoner Platte; aber ihr Format, ein aufgerichtetes
1 Abb. Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V, VI (1844), Taf. VII, VIII.
2 Eine Photographie der Platte befindet sich in meinen »Frühchristlichen und Mittelalterlichen Elfenbeinwerken«, Serie I,
Rom 1898, Nr. 45, darnach die Abb. Fig. 4.
3 Ancient and mediaeval Ivories in the South Kensington Museum, p. 152, Nr. 11.
2*
II
Lykomedes auf einer Xantener Pvxis1 hält Deidamia dem Geliebten mit beiden Händen einen kleinen
Knaben hin, um ihn durch seinen Anblick zum Bleiben zu bewegen. Ein Eros, der in der Vorlage
zwischen dem Liebespaar angebracht war, wird fälschlich als Neoptolemos aufgefasst, den die Sage erst
nach dem Abschiede des Vaters geboren werden lässt. Aber wir merken doch hier und bei allen gleich-
zeitigen Werken, deren Formen ungleich roher und plumper sind als auf den besseren der Elfenbein-
kästchen, dass die Verfertiger jener Arbeiten mit dem Sinn ihrer Darstellungen noch vertraut waren.
Den Schnitzern unserer Kästchen dagegen fehlte jegliches Verständnis der benutzten Vorbilder. Un-
möglich wäre sonst das willkürliche
Schalten mit den Attributen, wie
wir es hier beobachten können.
Venus bekommt eine Schale (14) oder
gar eine Fackel in die Hand (4, n,
i3); die Fackel ist so beliebt, dass
selbst eine Quellnymphe damit aus-
gestattet wird (36). Der Thyrsos des
Dionysos, der auf dem Pantherwagen
gelagert ist, wird in eine Peitsche ver-
wandelt (i3, 35). Freigebig werden
Flügel verliehen (36) und Kopfbe-
deckungen ausgetheilt an Figuren, die
in antiken Bildwerken stets barhaupt
erscheinen (i3, 36). Nur bei einer
vollständigen Unkenntnis der Mythen
sind die oben geschilderten Verbin-
dungen fremdartiger Figuren denkbar,
die nach rein äusserlichen Gesichts-
punkten zusammengestellt werden,
wie z. B. der Polyphem lediglich der
Leier wegen den tanzenden Putten
zugesellt wird. Die Elfenbeinschnitzer
verfahren mit den antiken Typen
gleichwie thörichte Kinder, denen ein
Geduldspiel in die Hände gefallen
ist. Aus den verschieden geformten
Steinen, die sich zu geschlossenen Fi-
guren zusammenfügen lassen, greifen
Fig. 4. Elfenbeinplatte des British Museum.
sie beliebige heraus, die just mit einer Seite aneinanderpassen, und kümmern sich nicht darum, dass
sie ein sinnloses Gebilde schaffen.
Als Wegweiser zur richtigen Datirung der Kästchen kann uns eine bisher unpublicirte Elfenbein-
platte des British Museum2 dienen (Fig. 4), die schon Maskell3 mit den Kästchenreliefs verglichen hatte.
Bei all' diesen läuft rings um die vertiefte Fläche ein schmaler glatter Rand und wir bemerken ent-
weder in dem Rande selbst oder in der Relieffläche dicht an dem Rande runde Bohrlöcher für die
Elfenbeinstifte, welche die Platten auf der Holzwand der Kästchen befestigten. Die gleiche Umran-
dung und Durchbohrung findet sich an der Londoner Platte; aber ihr Format, ein aufgerichtetes
1 Abb. Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V, VI (1844), Taf. VII, VIII.
2 Eine Photographie der Platte befindet sich in meinen »Frühchristlichen und Mittelalterlichen Elfenbeinwerken«, Serie I,
Rom 1898, Nr. 45, darnach die Abb. Fig. 4.
3 Ancient and mediaeval Ivories in the South Kensington Museum, p. 152, Nr. 11.
2*