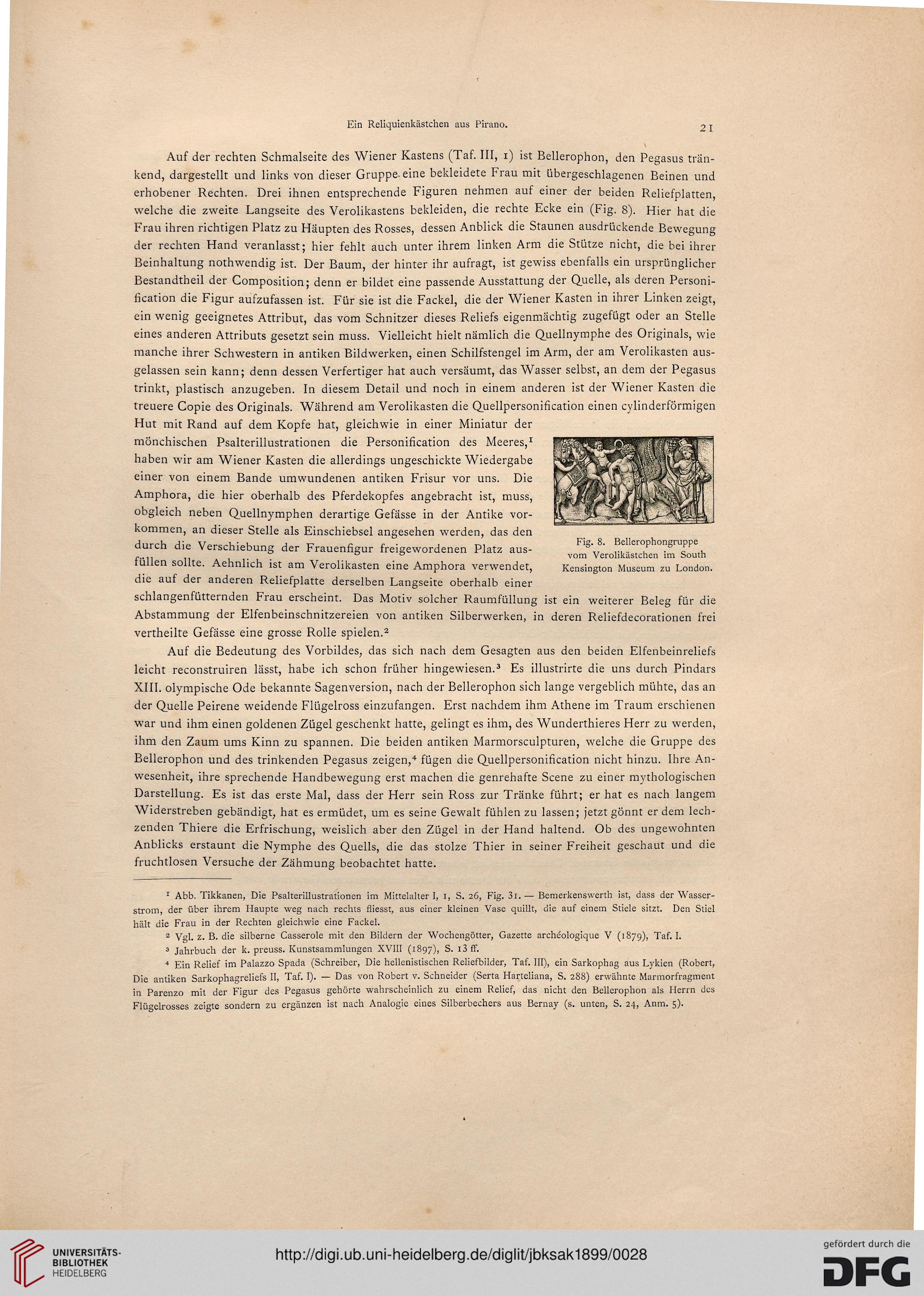Ein Reliquienkästchen aus Pirano. 2 i
Auf der rechten Schmalseite des Wiener Kastens (Taf. III, i) ist Bellerophon, den Pegasus trän-
kend, dargestellt und links von dieser Gruppe-eine bekleidete Frau mit übergeschlagenen Beinen und
erhobener Rechten. Drei ihnen entsprechende Figuren nehmen auf einer der beiden Reliefplatten,
welche die zweite Langseite des Verolikastens bekleiden, die rechte Ecke ein (Fig. 8). Hier hat die
Frau ihren richtigen Platz zu Häupten des Rosses, dessen Anblick die Staunen ausdrückende Bewegung
der rechten Hand veranlasst; hier fehlt auch unter ihrem linken Arm die Stütze nicht, die bei ihrer
Beinhaltung nothwendig ist. Der Baum, der hinter ihr aufragt, ist gewiss ebenfalls ein ursprünglicher
Bestandtheil der Gomposition; denn er bildet eine passende Ausstattung der Quelle, als deren Personi-
fication die Figur aufzufassen ist. Für sie ist die Fackel, die der Wiener Kasten in ihrer Linken zeigt,
ein wenig geeignetes Attribut, das vom Schnitzer dieses Reliefs eigenmächtig zugefügt oder an Stelle
eines anderen Attributs gesetzt sein muss. Vielleicht hielt nämlich die Quellnymphe des Originals, wie
manche ihrer Schwestern in antiken Bildwerken, einen Schilfstengel im Arm, der am Verolikasten aus-
gelassen sein kann; denn dessen Verfertiger hat auch versäumt, das Wasser selbst, an dem der Pegasus
trinkt, plastisch anzugeben. In diesem Detail und noch in einem anderen ist der Wiener Kasten die
treuere Copie des Originals. Während am Verolikasten die Quellpersonification einen cylinderförmigen
Hut mit Rand auf dem Kopfe hat, gleichwie in einer Miniatur der
mönchischen Psalterillustrationen die Personifikation des Meeres,1
haben wir am Wiener Kasten die allerdings ungeschickte Wiedergabe
einer von einem Bande umwundenen antiken Frisur vor uns. Die
Amphora, die hier oberhalb des Pferdekopfes angebracht ist, muss,
obgleich neben Quellnymphen derartige Gefässe in der Antike vor-
kommen, an dieser Stelle als Einschiebsel angesehen werden, das den
durch die Verschiebung der Frauenfigur freigewordenen Platz aus- ^ SffTT"
r.. 11 i, vom Verohkastchen im soutn
tullen sollte. Aehnhch ist am Verolikasten eine Amphora verwendet, Kensington Museum zu London.
die auf der anderen Reliefplatte derselben Langseite oberhalb einer
schlangenfütternden Frau erscheint. Das Motiv solcher Raumfüllung ist ein weiterer Beleg für die
Abstammung der Elfenbeinschnitzereien von antiken Silberwerken, in deren Reliefdecorationen frei
vertheilte Gefässe eine grosse Rolle spielen.2
Auf die Bedeutung des Vorbildes, das sich nach dem Gesagten aus den beiden Elfenbeinreliefs
leicht reconstruiren lässt, habe ich schon früher hingewiesen.3 Es illustrirte die uns durch Pindars
XIII. olympische Ode bekannte Sagenversion, nach der Bellerophon sich lange vergeblich mühte, das an
der Quelle Peirene weidende Flügelross einzufangen. Erst nachdem ihm Athene im Traum erschienen
war und ihm einen goldenen Zügel geschenkt hatte, gelingt es ihm, des Wunderthieres Herr zu werden,
ihm den Zaum ums Kinn zu spannen. Die beiden antiken Marmorsculpturen, welche die Gruppe des
Bellerophon und des trinkenden Pegasus zeigen,4 fügen die Quellpersonification nicht hinzu. Ihre An-
wesenheit, ihre sprechende Handbewegung erst machen die genrehafte Scene zu einer mythologischen
Darstellung. Es ist das erste Mal, dass der Herr sein Ross zur Tränke führt; er hat es nach langem
Widerstreben gebändigt, hat es ermüdet, um es seine Gewalt fühlen zu lassen; jetzt gönnt er dem lech-
zenden Thiere die Erfrischung, weislich aber den Zügel in der Hand haltend. Ob des ungewohnten
Anblicks erstaunt die Nymphe des Quells, die das stolze Thier in seiner Freiheit geschaut und die
fruchtlosen Versuche der Zähmung beobachtet hatte.
1 Abb. Tikkanen, Die Psalterillustrationcn im Mittelalter I, I, S. 26, Fig. 3l.— Bemerkenswerth ist, dass der Wasser-
Strom, der über ihrem Haupte weg nach rechts fliesst, aus einer kleinen Vase quillt, die auf einem Stiele sitzt. Den Stiel
hält die Frau in der Rechten gleichwie eine Fackel.
2 Vgl. z. B. die silberne Casserole mit den Bildern der Wochengötter, Gazette archeologique V (1879), Taf. 1.
3 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XVIII (1897), S. i3 ff.
4 Ein Relief im Palazzo Spada (Schreiber, Die hellenistischen Reliefbilder, Taf. III), ein Sarkophag aus Lykien (Robert,
Die antiken Sarkophagreliefs II, Taf. I). — Das von Robert v. Schneider (Serta Harteliana, S. 288) erwähnte Marmorfragment
in Parenzo mit der Figur des Pegasus gehörte wahrscheinlich zu einem Relief, das nicht den Bellerophon als Herrn des
Flügelrosses zeigte sondern zu ergänzen ist nach Analogie eines Silberbechers aus Bernay (s. unten, S. 24, Anm. 5).
Auf der rechten Schmalseite des Wiener Kastens (Taf. III, i) ist Bellerophon, den Pegasus trän-
kend, dargestellt und links von dieser Gruppe-eine bekleidete Frau mit übergeschlagenen Beinen und
erhobener Rechten. Drei ihnen entsprechende Figuren nehmen auf einer der beiden Reliefplatten,
welche die zweite Langseite des Verolikastens bekleiden, die rechte Ecke ein (Fig. 8). Hier hat die
Frau ihren richtigen Platz zu Häupten des Rosses, dessen Anblick die Staunen ausdrückende Bewegung
der rechten Hand veranlasst; hier fehlt auch unter ihrem linken Arm die Stütze nicht, die bei ihrer
Beinhaltung nothwendig ist. Der Baum, der hinter ihr aufragt, ist gewiss ebenfalls ein ursprünglicher
Bestandtheil der Gomposition; denn er bildet eine passende Ausstattung der Quelle, als deren Personi-
fication die Figur aufzufassen ist. Für sie ist die Fackel, die der Wiener Kasten in ihrer Linken zeigt,
ein wenig geeignetes Attribut, das vom Schnitzer dieses Reliefs eigenmächtig zugefügt oder an Stelle
eines anderen Attributs gesetzt sein muss. Vielleicht hielt nämlich die Quellnymphe des Originals, wie
manche ihrer Schwestern in antiken Bildwerken, einen Schilfstengel im Arm, der am Verolikasten aus-
gelassen sein kann; denn dessen Verfertiger hat auch versäumt, das Wasser selbst, an dem der Pegasus
trinkt, plastisch anzugeben. In diesem Detail und noch in einem anderen ist der Wiener Kasten die
treuere Copie des Originals. Während am Verolikasten die Quellpersonification einen cylinderförmigen
Hut mit Rand auf dem Kopfe hat, gleichwie in einer Miniatur der
mönchischen Psalterillustrationen die Personifikation des Meeres,1
haben wir am Wiener Kasten die allerdings ungeschickte Wiedergabe
einer von einem Bande umwundenen antiken Frisur vor uns. Die
Amphora, die hier oberhalb des Pferdekopfes angebracht ist, muss,
obgleich neben Quellnymphen derartige Gefässe in der Antike vor-
kommen, an dieser Stelle als Einschiebsel angesehen werden, das den
durch die Verschiebung der Frauenfigur freigewordenen Platz aus- ^ SffTT"
r.. 11 i, vom Verohkastchen im soutn
tullen sollte. Aehnhch ist am Verolikasten eine Amphora verwendet, Kensington Museum zu London.
die auf der anderen Reliefplatte derselben Langseite oberhalb einer
schlangenfütternden Frau erscheint. Das Motiv solcher Raumfüllung ist ein weiterer Beleg für die
Abstammung der Elfenbeinschnitzereien von antiken Silberwerken, in deren Reliefdecorationen frei
vertheilte Gefässe eine grosse Rolle spielen.2
Auf die Bedeutung des Vorbildes, das sich nach dem Gesagten aus den beiden Elfenbeinreliefs
leicht reconstruiren lässt, habe ich schon früher hingewiesen.3 Es illustrirte die uns durch Pindars
XIII. olympische Ode bekannte Sagenversion, nach der Bellerophon sich lange vergeblich mühte, das an
der Quelle Peirene weidende Flügelross einzufangen. Erst nachdem ihm Athene im Traum erschienen
war und ihm einen goldenen Zügel geschenkt hatte, gelingt es ihm, des Wunderthieres Herr zu werden,
ihm den Zaum ums Kinn zu spannen. Die beiden antiken Marmorsculpturen, welche die Gruppe des
Bellerophon und des trinkenden Pegasus zeigen,4 fügen die Quellpersonification nicht hinzu. Ihre An-
wesenheit, ihre sprechende Handbewegung erst machen die genrehafte Scene zu einer mythologischen
Darstellung. Es ist das erste Mal, dass der Herr sein Ross zur Tränke führt; er hat es nach langem
Widerstreben gebändigt, hat es ermüdet, um es seine Gewalt fühlen zu lassen; jetzt gönnt er dem lech-
zenden Thiere die Erfrischung, weislich aber den Zügel in der Hand haltend. Ob des ungewohnten
Anblicks erstaunt die Nymphe des Quells, die das stolze Thier in seiner Freiheit geschaut und die
fruchtlosen Versuche der Zähmung beobachtet hatte.
1 Abb. Tikkanen, Die Psalterillustrationcn im Mittelalter I, I, S. 26, Fig. 3l.— Bemerkenswerth ist, dass der Wasser-
Strom, der über ihrem Haupte weg nach rechts fliesst, aus einer kleinen Vase quillt, die auf einem Stiele sitzt. Den Stiel
hält die Frau in der Rechten gleichwie eine Fackel.
2 Vgl. z. B. die silberne Casserole mit den Bildern der Wochengötter, Gazette archeologique V (1879), Taf. 1.
3 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XVIII (1897), S. i3 ff.
4 Ein Relief im Palazzo Spada (Schreiber, Die hellenistischen Reliefbilder, Taf. III), ein Sarkophag aus Lykien (Robert,
Die antiken Sarkophagreliefs II, Taf. I). — Das von Robert v. Schneider (Serta Harteliana, S. 288) erwähnte Marmorfragment
in Parenzo mit der Figur des Pegasus gehörte wahrscheinlich zu einem Relief, das nicht den Bellerophon als Herrn des
Flügelrosses zeigte sondern zu ergänzen ist nach Analogie eines Silberbechers aus Bernay (s. unten, S. 24, Anm. 5).