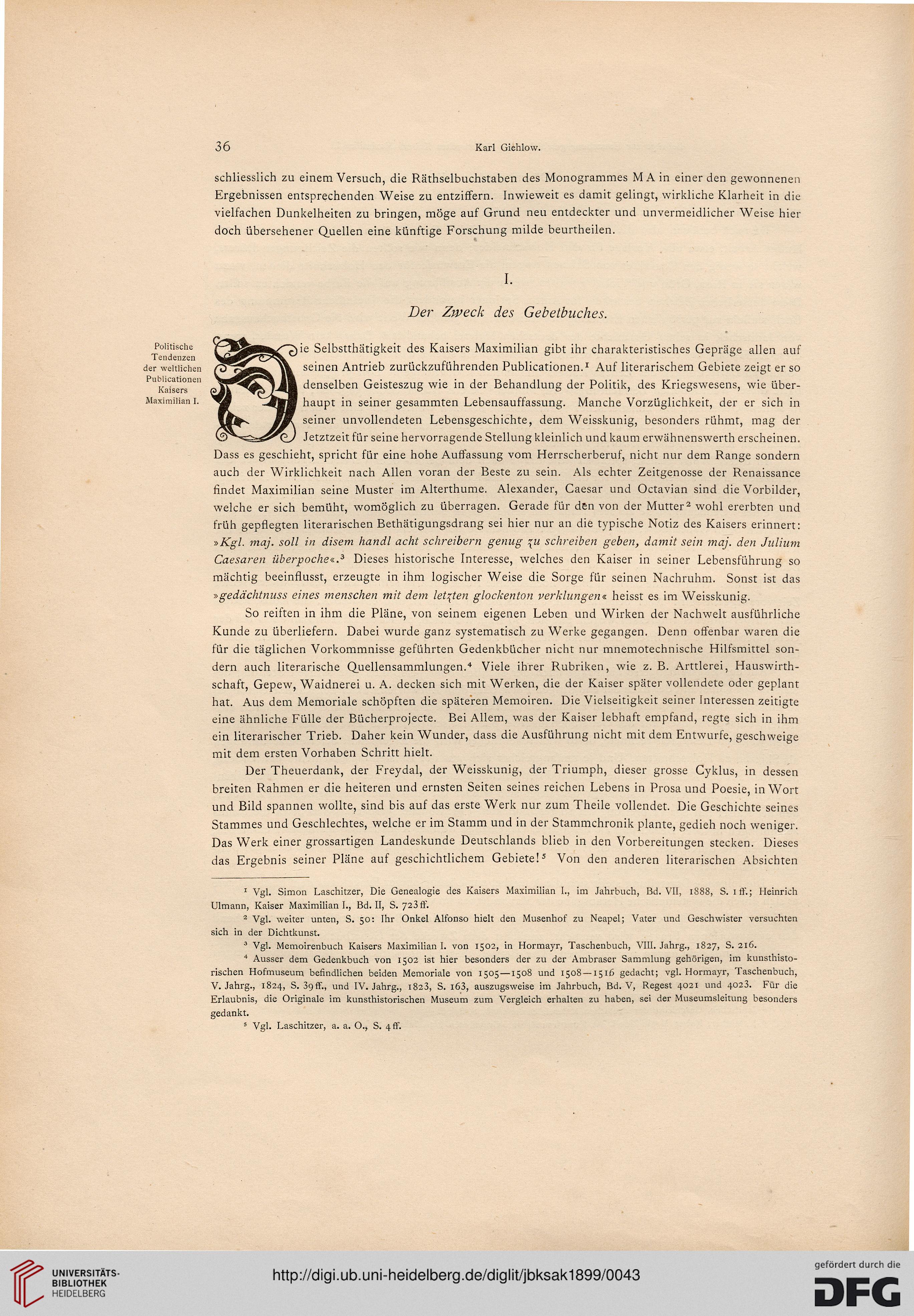36
Karl Giehlovv.
schliesslich zu einem Versuch, die Räthselbuchstaben des Monogrammes M A in einerden gewonnenen
Ergebnissen entsprechenden Weise zu entziffern. Inwieweit es damit gelingt, wirkliche Klarheit in die
vielfachen Dunkelheiten zu bringen, möge auf Grund neu entdeckter und unvermeidlicher Weise hier
doch übersehener Quellen eine künftige Forschung milde beurtheilen.
I.
Der Zweck des Gebetbuches.
Politische
Tendenzen
der weltlichen
Publicationen
Kaisers
Maximilian I.
ie Selbstthätigkeit des Kaisers Maximilian gibt ihr charakteristisches Gepräge allen auf
seinen Antrieb zurückzuführenden Publicationen.1 Auf literarischem Gebiete zeigt er so
denselben Geisteszug wie in der Behandlung der Politik, des Kriegswesens, wie über-
haupt in seiner gesammten Lebensauffassung. Manche Vorzüglichkeit, der er sich in
seiner unvollendeten Lebensgeschichte, dem Weisskunig, besonders rühmt, mag der
Jetztzeit für seine hervorragende Stellung kleinlich und kaum erwähnenswerth erscheinen.
Dass es geschieht, spricht für eine hohe Auffassung vom Herrscherberuf, nicht nur dem Range sondern
auch der Wirklichkeit nach Allen voran der Beste zu sein. Als echter Zeitgenosse der Renaissance
findet Maximilian seine Muster im Alterthume. Alexander, Caesar und Octavian sind die Vorbilder,
welche er sich bemüht, womöglich zu überragen. Gerade für den von der Mutter2 wohl ererbten und
früh gepflegten literarischen Bethätigungsdrang sei hier nur an die typische Notiz des Kaisers erinnert:
»Kgl. maj. soll in disem handl acht Schreibern genug ■{u schreiben geben, damit sein maj. den Jnlium
Caesarea überpoche«.3 Dieses historische Interesse, welches den Kaiser in seiner Lebensführung so
mächtig beeinflusst, erzeugte in ihm logischer Weise die Sorge für seinen Nachruhm. Sonst ist das
»gedächtnuss eines menschen mit dem letzten glockenton verklungen« heisst es im Weisskunig.
So reiften in ihm die Pläne, von seinem eigenen Leben und Wirken der Nachwelt ausführliche
Kunde zu überliefern. Dabei wurde ganz systematisch zu Werke gegangen. Denn offenbar waren die
für die täglichen Vorkommnisse geführten Gedenkbücher nicht nur mnemotechnische Hilfsmittel son-
dern auch literarische Quellensammlungen.4 Viele ihrer Rubriken, wie z.B. Arttlerei, Hauswirth-
schaft, Gepew, Waidnerei u. A. decken sich mit Werken, die der Kaiser später vollendete oder geplant
hat. Aus dem Memoriale schöpften die späteren Memoiren. Die Vielseitigkeit seiner Interessen zeitigte
eine ähnliche Fülle der Bücherprojecte. Bei Allem, was der Kaiser lebhaft empfand, regte sich in ihm
ein literarischer Trieb. Daher kein Wunder, dass die Ausführung nicht mit dem Entwürfe, geschweige
mit dem ersten Vorhaben Schritt hielt.
Der Theuerdank, der Freydal, der Weisskunig, der Triumph, dieser grosse Cyklus, in dessen
breiten Rahmen er die heiteren und ernsten Seiten seines reichen Lebens in Prosa und Poesie, in Wort
und Bild spannen wollte, sind bis auf das erste Werk nur zum Theile vollendet. Die Geschichte seines
Stammes und Geschlechtes, welche er im Stamm und in der Stammchronik plante, gedieh noch weniger.
Das Werk einer grossartigen Landeskunde Deutschlands blieb in den Vorbereitungen stecken. Dieses
das Ergebnis seiner Pläne auf geschichtlichem Gebiete!5 Von den anderen literarischen Absichten
1 Vgl. Simon Laschitzer, Die Genealogie des Kaisers Maximilian I., im Jahrbuch, Bd. VII, 1888, S. lff.; Heinrich
Ulmann, Kaiser Maximilian I., Bd. II, S. 723 ff.
2 Vgl. weiter unten, S. 50: Ihr Onkel Alfonso hielt den Musenhof zu Neapel; Vater und Geschwister versuchten
sich in der Dichtkunst.
3 Vgl. Memoirenbuch Kaisers Maximilian I. von 1502, in Hormayr, Taschenbuch, VIII. Jahrg., 1827, S. 216.
4 Ausser dem Gedenkbuch von 1502 ist hier besonders der zu der Ambraser Sammlung gehörigen, im kunsthisto-
rischen Hofmuseum befindlichen beiden Memoriale von 1505 —1508 und 1508 — 1516 gedacht; vgl. Hormayr, Taschenbuch,
V. Jahrg., 1824, S. 39fr., und IV. Jahrg., 1823, S. i63, auszugsweise im Jahrbuch, Bd. V, Regest 4021 und 4023. Für die
Erlaubnis, die Originale im kunsthistorischen Museum zum Vergleich erhalten zu haben, sei der Museumsleitung besonders
gedankt.
5 Vgl. Laschitzer, a. a. O., S. 4 ff.
Karl Giehlovv.
schliesslich zu einem Versuch, die Räthselbuchstaben des Monogrammes M A in einerden gewonnenen
Ergebnissen entsprechenden Weise zu entziffern. Inwieweit es damit gelingt, wirkliche Klarheit in die
vielfachen Dunkelheiten zu bringen, möge auf Grund neu entdeckter und unvermeidlicher Weise hier
doch übersehener Quellen eine künftige Forschung milde beurtheilen.
I.
Der Zweck des Gebetbuches.
Politische
Tendenzen
der weltlichen
Publicationen
Kaisers
Maximilian I.
ie Selbstthätigkeit des Kaisers Maximilian gibt ihr charakteristisches Gepräge allen auf
seinen Antrieb zurückzuführenden Publicationen.1 Auf literarischem Gebiete zeigt er so
denselben Geisteszug wie in der Behandlung der Politik, des Kriegswesens, wie über-
haupt in seiner gesammten Lebensauffassung. Manche Vorzüglichkeit, der er sich in
seiner unvollendeten Lebensgeschichte, dem Weisskunig, besonders rühmt, mag der
Jetztzeit für seine hervorragende Stellung kleinlich und kaum erwähnenswerth erscheinen.
Dass es geschieht, spricht für eine hohe Auffassung vom Herrscherberuf, nicht nur dem Range sondern
auch der Wirklichkeit nach Allen voran der Beste zu sein. Als echter Zeitgenosse der Renaissance
findet Maximilian seine Muster im Alterthume. Alexander, Caesar und Octavian sind die Vorbilder,
welche er sich bemüht, womöglich zu überragen. Gerade für den von der Mutter2 wohl ererbten und
früh gepflegten literarischen Bethätigungsdrang sei hier nur an die typische Notiz des Kaisers erinnert:
»Kgl. maj. soll in disem handl acht Schreibern genug ■{u schreiben geben, damit sein maj. den Jnlium
Caesarea überpoche«.3 Dieses historische Interesse, welches den Kaiser in seiner Lebensführung so
mächtig beeinflusst, erzeugte in ihm logischer Weise die Sorge für seinen Nachruhm. Sonst ist das
»gedächtnuss eines menschen mit dem letzten glockenton verklungen« heisst es im Weisskunig.
So reiften in ihm die Pläne, von seinem eigenen Leben und Wirken der Nachwelt ausführliche
Kunde zu überliefern. Dabei wurde ganz systematisch zu Werke gegangen. Denn offenbar waren die
für die täglichen Vorkommnisse geführten Gedenkbücher nicht nur mnemotechnische Hilfsmittel son-
dern auch literarische Quellensammlungen.4 Viele ihrer Rubriken, wie z.B. Arttlerei, Hauswirth-
schaft, Gepew, Waidnerei u. A. decken sich mit Werken, die der Kaiser später vollendete oder geplant
hat. Aus dem Memoriale schöpften die späteren Memoiren. Die Vielseitigkeit seiner Interessen zeitigte
eine ähnliche Fülle der Bücherprojecte. Bei Allem, was der Kaiser lebhaft empfand, regte sich in ihm
ein literarischer Trieb. Daher kein Wunder, dass die Ausführung nicht mit dem Entwürfe, geschweige
mit dem ersten Vorhaben Schritt hielt.
Der Theuerdank, der Freydal, der Weisskunig, der Triumph, dieser grosse Cyklus, in dessen
breiten Rahmen er die heiteren und ernsten Seiten seines reichen Lebens in Prosa und Poesie, in Wort
und Bild spannen wollte, sind bis auf das erste Werk nur zum Theile vollendet. Die Geschichte seines
Stammes und Geschlechtes, welche er im Stamm und in der Stammchronik plante, gedieh noch weniger.
Das Werk einer grossartigen Landeskunde Deutschlands blieb in den Vorbereitungen stecken. Dieses
das Ergebnis seiner Pläne auf geschichtlichem Gebiete!5 Von den anderen literarischen Absichten
1 Vgl. Simon Laschitzer, Die Genealogie des Kaisers Maximilian I., im Jahrbuch, Bd. VII, 1888, S. lff.; Heinrich
Ulmann, Kaiser Maximilian I., Bd. II, S. 723 ff.
2 Vgl. weiter unten, S. 50: Ihr Onkel Alfonso hielt den Musenhof zu Neapel; Vater und Geschwister versuchten
sich in der Dichtkunst.
3 Vgl. Memoirenbuch Kaisers Maximilian I. von 1502, in Hormayr, Taschenbuch, VIII. Jahrg., 1827, S. 216.
4 Ausser dem Gedenkbuch von 1502 ist hier besonders der zu der Ambraser Sammlung gehörigen, im kunsthisto-
rischen Hofmuseum befindlichen beiden Memoriale von 1505 —1508 und 1508 — 1516 gedacht; vgl. Hormayr, Taschenbuch,
V. Jahrg., 1824, S. 39fr., und IV. Jahrg., 1823, S. i63, auszugsweise im Jahrbuch, Bd. V, Regest 4021 und 4023. Für die
Erlaubnis, die Originale im kunsthistorischen Museum zum Vergleich erhalten zu haben, sei der Museumsleitung besonders
gedankt.
5 Vgl. Laschitzer, a. a. O., S. 4 ff.