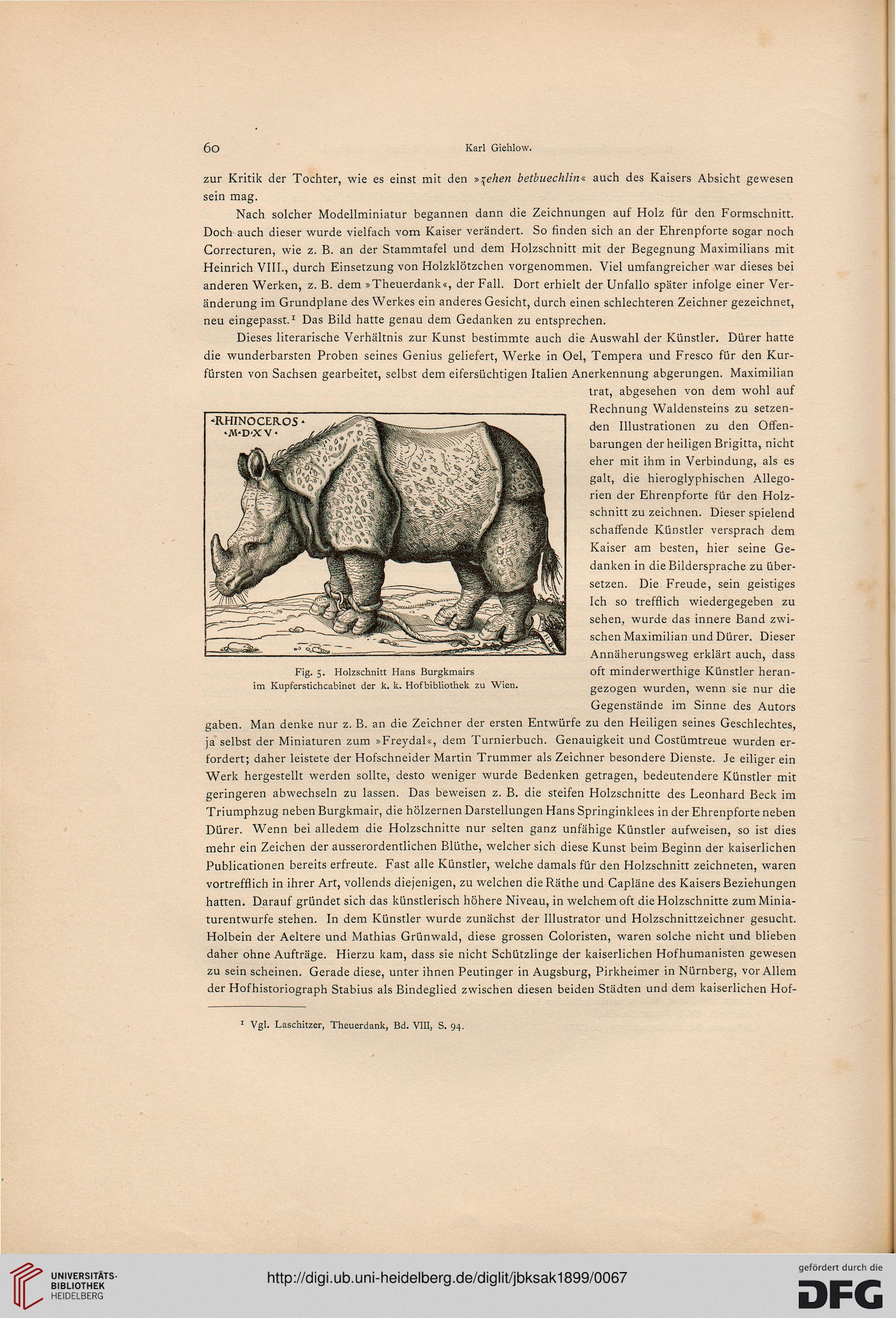6o
Karl Giehlow.
zur Kritik der Tochter, wie es einst mit den »%ehen betbuechlin«. auch des Kaisers Absicht gewesen
sein mag.
Nach solcher Modellminiatur begannen dann die Zeichnungen auf Holz für den Formschnitt.
Doch auch dieser wurde vielfach vom Kaiser verändert. So finden sich an der Ehrenpforte sogar noch
Correcturen, wie z. B. an der Stammtafel und dem Holzschnitt mit der Begegnung Maximilians mit
Heinrich VIII., durch Einsetzung von Holzklötzchen vorgenommen. Viel umfangreicher war dieses bei
anderen Werken, z. B. dem »Theuerdank«, der Fall. Dort erhielt der Unfallo später infolge einer Ver-
änderung im Grundplane des Werkes ein anderes Gesicht, durch einen schlechteren Zeichner gezeichnet,
neu eingepasst.l Das Bild hatte genau dem Gedanken zu entsprechen.
Dieses literarische Verhältnis zur Kunst bestimmte auch die Auswahl der Künstler. Dürer hatte
die wunderbarsten Proben seines Genius geliefert, Werke in Oel, Tempera und Fresco für den Kur-
fürsten von Sachsen gearbeitet, selbst dem eifersüchtigen Italien Anerkennung abgerungen. Maximilian
trat, abgesehen von dem wohl auf
Rechnung Waidensteins zu setzen-
den Illustrationen zu den Offen-
barungen der heiligen Brigitta, nicht
eher mit ihm in Verbindung, als es
galt, die hieroglyphischen Allego-
rien der Ehrenpforte für den Holz-
schnitt zu zeichnen. Dieser spielend
schaffende Künstler versprach dem
Kaiser am besten, hier seine Ge-
danken in die Bildersprache zu über-
setzen. Die Freude, sein geistiges
Ich so trefflich wiedergegeben zu
sehen, wurde das innere Band zwi-
schen Maximilian und Dürer. Dieser
Annäherungsweg erklärt auch, dass
oft minderwerthige Künstler heran-
gezogen wurden, wenn sie nur die
Gegenstände im Sinne des Autors
gaben. Man denke nur z. B. an die Zeichner der ersten Entwürfe zu den Heiligen seines Geschlechtes,
ja selbst der Miniaturen zum »Freydal«, dem Turnierbuch. Genauigkeit und Costümtreue wurden er-
fordert; daher leistete der Hofschneider Martin Trümmer als Zeichner besondere Dienste. Je eiliger ein
Werk hergestellt werden sollte, desto weniger wurde Bedenken getragen, bedeutendere Künstler mit
geringeren abwechseln zu lassen. Das beweisen z. B. die steifen Holzschnitte des Leonhard Beck im
Triumphzug neben Burgkmair, die hölzernen Darstellungen Hans Springinklees in der Ehrenpforte neben
Dürer. Wenn bei alledem die Holzschnitte nur selten ganz unfähige Künstler aufweisen, so ist dies
mehr ein Zeichen der ausserordentlichen Blüthe, welcher sich diese Kunst beim Beginn der kaiserlichen
Publicationen bereits erfreute. Fast alle Künstler, welche damals für den Holzschnitt zeichneten, waren
vortrefflich in ihrer Art, vollends diejenigen, zu welchen dieRäthe und Capläne des Kaisers Beziehungen
hatten. Darauf gründet sich das künstlerisch höhere Niveau, in welchem oft die Holzschnitte zum Minia-
turentwurfe stehen. In dem Künstler wurde zunächst der Illustrator und Holzschnittzeichner gesucht.
Holbein der Aeltere und Mathias Grünwald, diese grossen Coloristen, waren solche nicht und blieben
daher ohne Aufträge. Hierzu kam, dass sie nicht Schützlinge der kaiserlichen Hofhumanisten gewesen
zu sein scheinen. Gerade diese, unter ihnen Peutinger in Augsburg, Pirkheimer in Nürnberg, vor Allem
der Hofhistoriograph Stabius als Bindeglied zwischen diesen beiden Städten und dem kaiserlichen Hof-
Fig. ;. Holzschnitt Hans Burgkmairs
im Kupferstichcabinet der k. k. Hof bibliothek zu Wien.
1 Vgl. Laschitzer, Theuerdank, Bd. VIII, S. 94.
Karl Giehlow.
zur Kritik der Tochter, wie es einst mit den »%ehen betbuechlin«. auch des Kaisers Absicht gewesen
sein mag.
Nach solcher Modellminiatur begannen dann die Zeichnungen auf Holz für den Formschnitt.
Doch auch dieser wurde vielfach vom Kaiser verändert. So finden sich an der Ehrenpforte sogar noch
Correcturen, wie z. B. an der Stammtafel und dem Holzschnitt mit der Begegnung Maximilians mit
Heinrich VIII., durch Einsetzung von Holzklötzchen vorgenommen. Viel umfangreicher war dieses bei
anderen Werken, z. B. dem »Theuerdank«, der Fall. Dort erhielt der Unfallo später infolge einer Ver-
änderung im Grundplane des Werkes ein anderes Gesicht, durch einen schlechteren Zeichner gezeichnet,
neu eingepasst.l Das Bild hatte genau dem Gedanken zu entsprechen.
Dieses literarische Verhältnis zur Kunst bestimmte auch die Auswahl der Künstler. Dürer hatte
die wunderbarsten Proben seines Genius geliefert, Werke in Oel, Tempera und Fresco für den Kur-
fürsten von Sachsen gearbeitet, selbst dem eifersüchtigen Italien Anerkennung abgerungen. Maximilian
trat, abgesehen von dem wohl auf
Rechnung Waidensteins zu setzen-
den Illustrationen zu den Offen-
barungen der heiligen Brigitta, nicht
eher mit ihm in Verbindung, als es
galt, die hieroglyphischen Allego-
rien der Ehrenpforte für den Holz-
schnitt zu zeichnen. Dieser spielend
schaffende Künstler versprach dem
Kaiser am besten, hier seine Ge-
danken in die Bildersprache zu über-
setzen. Die Freude, sein geistiges
Ich so trefflich wiedergegeben zu
sehen, wurde das innere Band zwi-
schen Maximilian und Dürer. Dieser
Annäherungsweg erklärt auch, dass
oft minderwerthige Künstler heran-
gezogen wurden, wenn sie nur die
Gegenstände im Sinne des Autors
gaben. Man denke nur z. B. an die Zeichner der ersten Entwürfe zu den Heiligen seines Geschlechtes,
ja selbst der Miniaturen zum »Freydal«, dem Turnierbuch. Genauigkeit und Costümtreue wurden er-
fordert; daher leistete der Hofschneider Martin Trümmer als Zeichner besondere Dienste. Je eiliger ein
Werk hergestellt werden sollte, desto weniger wurde Bedenken getragen, bedeutendere Künstler mit
geringeren abwechseln zu lassen. Das beweisen z. B. die steifen Holzschnitte des Leonhard Beck im
Triumphzug neben Burgkmair, die hölzernen Darstellungen Hans Springinklees in der Ehrenpforte neben
Dürer. Wenn bei alledem die Holzschnitte nur selten ganz unfähige Künstler aufweisen, so ist dies
mehr ein Zeichen der ausserordentlichen Blüthe, welcher sich diese Kunst beim Beginn der kaiserlichen
Publicationen bereits erfreute. Fast alle Künstler, welche damals für den Holzschnitt zeichneten, waren
vortrefflich in ihrer Art, vollends diejenigen, zu welchen dieRäthe und Capläne des Kaisers Beziehungen
hatten. Darauf gründet sich das künstlerisch höhere Niveau, in welchem oft die Holzschnitte zum Minia-
turentwurfe stehen. In dem Künstler wurde zunächst der Illustrator und Holzschnittzeichner gesucht.
Holbein der Aeltere und Mathias Grünwald, diese grossen Coloristen, waren solche nicht und blieben
daher ohne Aufträge. Hierzu kam, dass sie nicht Schützlinge der kaiserlichen Hofhumanisten gewesen
zu sein scheinen. Gerade diese, unter ihnen Peutinger in Augsburg, Pirkheimer in Nürnberg, vor Allem
der Hofhistoriograph Stabius als Bindeglied zwischen diesen beiden Städten und dem kaiserlichen Hof-
Fig. ;. Holzschnitt Hans Burgkmairs
im Kupferstichcabinet der k. k. Hof bibliothek zu Wien.
1 Vgl. Laschitzer, Theuerdank, Bd. VIII, S. 94.