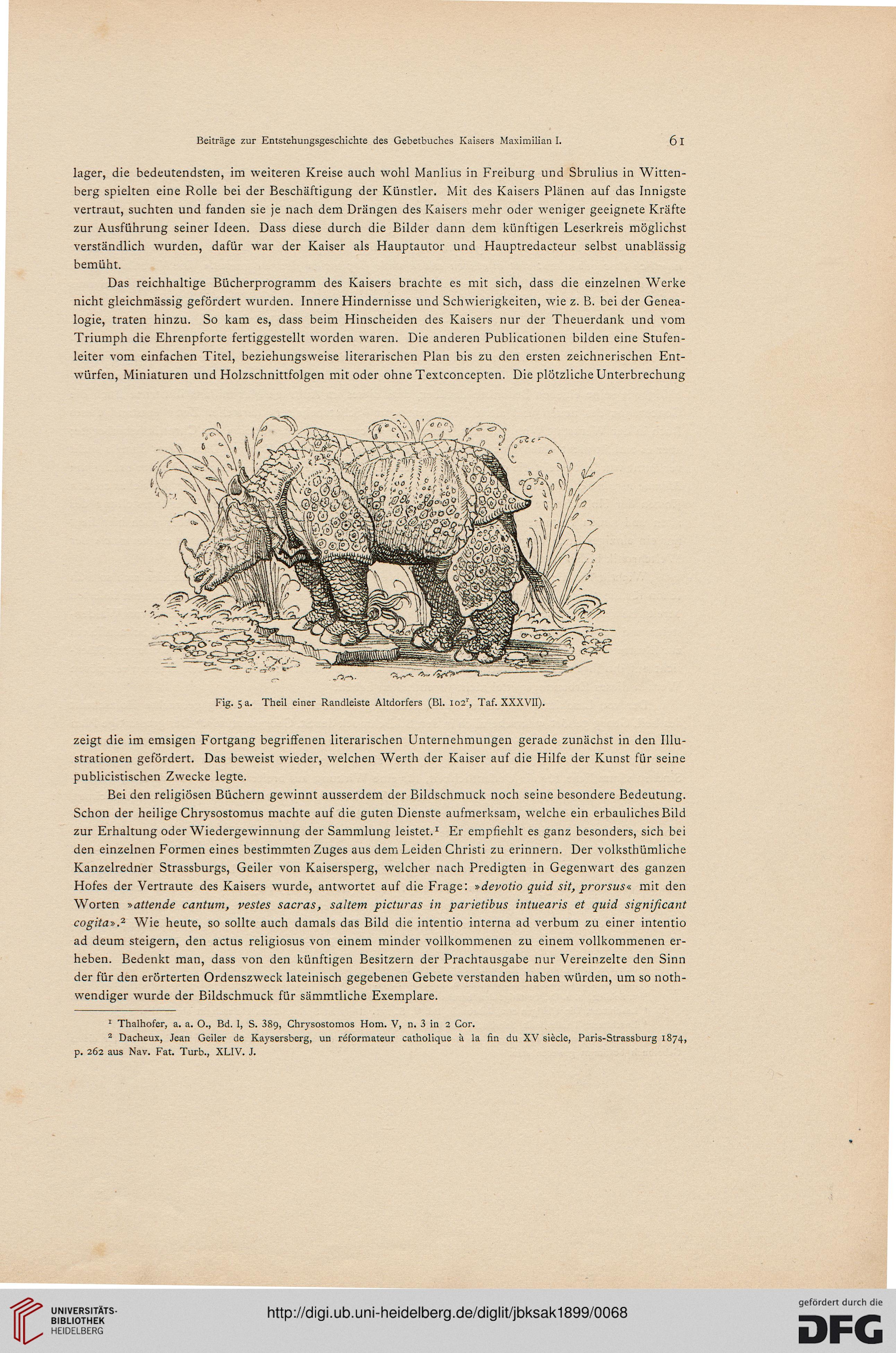Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebetbuches Kaisers Maximilian I.
61
lager, die bedeutendsten, im weiteren Kreise auch wohl Manlius in Freiburg und Sbrulius in Witten-
berg spielten eine Rolle bei der Beschäftigung der Künstler. Mit des Kaisers Plänen auf das Innigste
vertraut, suchten und fanden sie je nach dem Drängen des Kaisers mehr oder weniger geeignete Kräfte
zur Ausführung seiner Ideen. Dass diese durch die Bilder dann dem künftigen Leserkreis möglichst
verständlich wurden, dafür war der Kaiser als Hauptautor und Hauptredacteur selbst unablässig
bemüht.
Das reichhaltige Bücherprogramm des Kaisers brachte es mit sich, dass die einzelnen Werke
nicht gleichmässig gefördert wurden. Innere Hindernisse und Schwierigkeiten, wie z. B. bei der Genea-
logie, traten hinzu. So kam es, dass beim Hinscheiden des Kaisers nur der Theuerdank und vom
Triumph die Ehrenpforte fertiggestellt worden waren. Die anderen Publicationen bilden eine Stufen-
leiter vom einfachen Titel, beziehungsweise literarischen Plan bis zu den ersten zeichnerischen Ent-
würfen, Miniaturen und Holzschnittfolgen mit oder ohne Textconcepten. Die plötzliche Unterbrechung
/J« /£*>•-----!__
Fig. 5 a. Theil einer Randleiste Altdorfers (Bl. I021', Taf. XXXVII).
zeigt die im emsigen Fortgang begriffenen literarischen Unternehmungen gerade zunächst in den Illu-
strationen gefördert. Das beweist wieder, welchen Werth der Kaiser auf die Hilfe der Kunst für seine
publicistischen Zwecke legte.
Bei den religiösen Büchern gewinnt ausserdem der Bildschmuck noch seine besondere Bedeutung.
Schon der heilige Chrysostomus machte auf die guten Dienste aufmerksam, welche ein erbauliches Bild
zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der Sammlung leistet.1 Er empfiehlt es ganz besonders, sich bei
den einzelnen Formen eines bestimmten Zuges aus dem Leiden Christi zu erinnern. Der volksthümliche
Kanzelredner Strassburgs, Geiler von Kaisersperg, welcher nach Predigten in Gegenwart des ganzen
Hofes der Vertraute des Kaisers wurde, antwortet auf die Frage: -»devotio quid sit, prorsus« mit den
Worten mattende cantum, vestes sacras, saltern picturas in parietibus intuearis et quid significant
cogita».2 Wie heute, so sollte auch damals das Bild die intentio interna ad verbum zu einer intentio
ad deum steigern, den actus religiosus von einem minder vollkommenen zu einem vollkommenen er-
heben. Bedenkt man, dass von den künftigen Besitzern der Prachtausgabe nur Vereinzelte den Sinn
der für den erörterten Ordenszweck lateinisch gegebenen Gebete verstanden haben würden, um so noth-
wendiger wurde der Bildschmuck für sämmtliche Exemplare.
1 Thalhofer, a. a. O., Bd. 1, S. 389, Chrysostomos Hom. V, n. 3 in 2 Cor.
2 Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg, un reformateur catholique ä la fin du XV siecle, Paris-Strassburg 1874,
p. 262 aus Nav. Fat. Turb., XLIV. J.
61
lager, die bedeutendsten, im weiteren Kreise auch wohl Manlius in Freiburg und Sbrulius in Witten-
berg spielten eine Rolle bei der Beschäftigung der Künstler. Mit des Kaisers Plänen auf das Innigste
vertraut, suchten und fanden sie je nach dem Drängen des Kaisers mehr oder weniger geeignete Kräfte
zur Ausführung seiner Ideen. Dass diese durch die Bilder dann dem künftigen Leserkreis möglichst
verständlich wurden, dafür war der Kaiser als Hauptautor und Hauptredacteur selbst unablässig
bemüht.
Das reichhaltige Bücherprogramm des Kaisers brachte es mit sich, dass die einzelnen Werke
nicht gleichmässig gefördert wurden. Innere Hindernisse und Schwierigkeiten, wie z. B. bei der Genea-
logie, traten hinzu. So kam es, dass beim Hinscheiden des Kaisers nur der Theuerdank und vom
Triumph die Ehrenpforte fertiggestellt worden waren. Die anderen Publicationen bilden eine Stufen-
leiter vom einfachen Titel, beziehungsweise literarischen Plan bis zu den ersten zeichnerischen Ent-
würfen, Miniaturen und Holzschnittfolgen mit oder ohne Textconcepten. Die plötzliche Unterbrechung
/J« /£*>•-----!__
Fig. 5 a. Theil einer Randleiste Altdorfers (Bl. I021', Taf. XXXVII).
zeigt die im emsigen Fortgang begriffenen literarischen Unternehmungen gerade zunächst in den Illu-
strationen gefördert. Das beweist wieder, welchen Werth der Kaiser auf die Hilfe der Kunst für seine
publicistischen Zwecke legte.
Bei den religiösen Büchern gewinnt ausserdem der Bildschmuck noch seine besondere Bedeutung.
Schon der heilige Chrysostomus machte auf die guten Dienste aufmerksam, welche ein erbauliches Bild
zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der Sammlung leistet.1 Er empfiehlt es ganz besonders, sich bei
den einzelnen Formen eines bestimmten Zuges aus dem Leiden Christi zu erinnern. Der volksthümliche
Kanzelredner Strassburgs, Geiler von Kaisersperg, welcher nach Predigten in Gegenwart des ganzen
Hofes der Vertraute des Kaisers wurde, antwortet auf die Frage: -»devotio quid sit, prorsus« mit den
Worten mattende cantum, vestes sacras, saltern picturas in parietibus intuearis et quid significant
cogita».2 Wie heute, so sollte auch damals das Bild die intentio interna ad verbum zu einer intentio
ad deum steigern, den actus religiosus von einem minder vollkommenen zu einem vollkommenen er-
heben. Bedenkt man, dass von den künftigen Besitzern der Prachtausgabe nur Vereinzelte den Sinn
der für den erörterten Ordenszweck lateinisch gegebenen Gebete verstanden haben würden, um so noth-
wendiger wurde der Bildschmuck für sämmtliche Exemplare.
1 Thalhofer, a. a. O., Bd. 1, S. 389, Chrysostomos Hom. V, n. 3 in 2 Cor.
2 Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg, un reformateur catholique ä la fin du XV siecle, Paris-Strassburg 1874,
p. 262 aus Nav. Fat. Turb., XLIV. J.