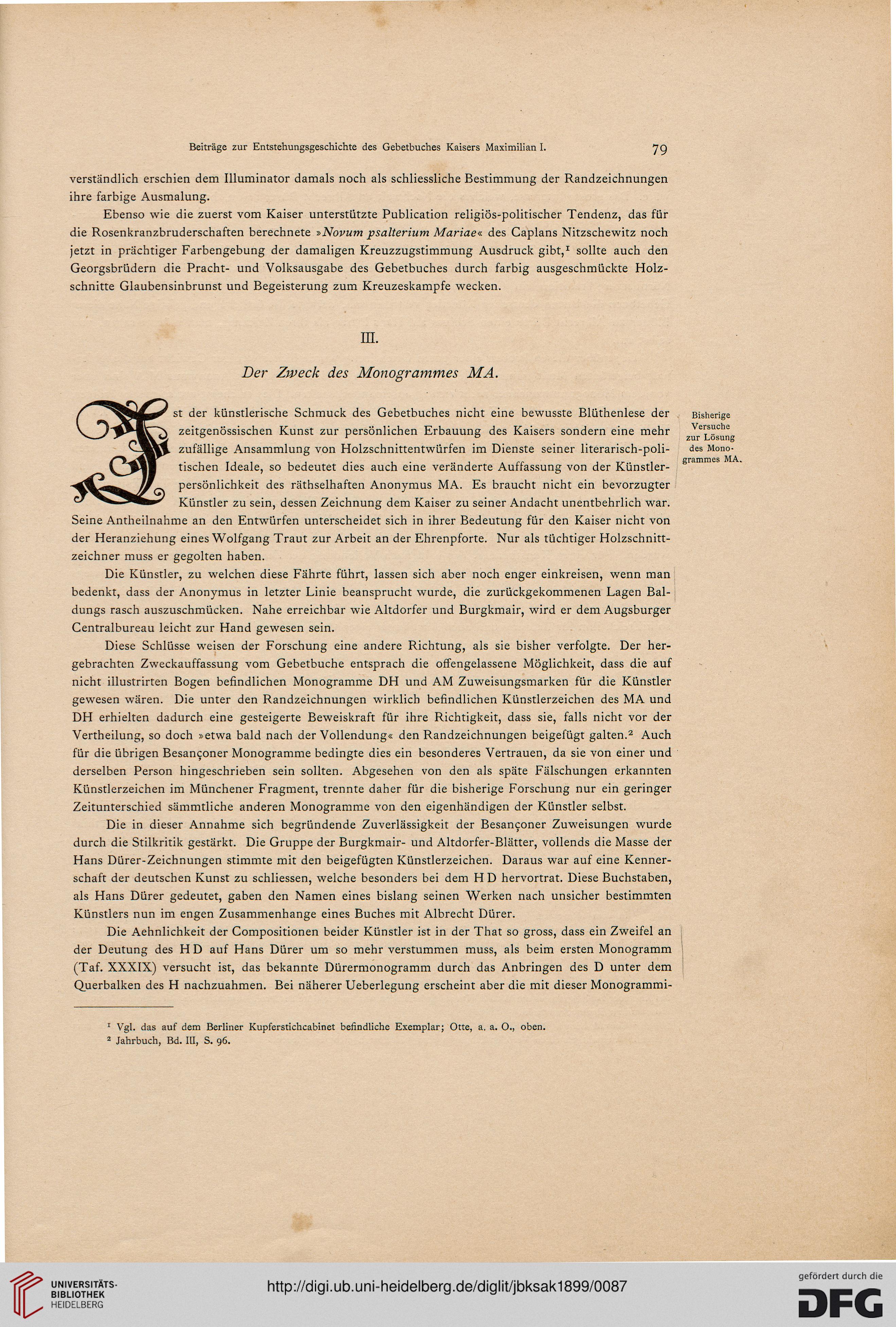Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebetbuches Kaisers Maximilian I.
79
verständlich erschien dem Illuminator damals noch als schliessliche Bestimmung der Randzeichnungen
ihre farbige Ausmalung.
Ebenso wie die zuerst vom Kaiser unterstützte Publication religiös-politischer Tendenz, das für
die Rosenkranzbruderschaften berechnete »Novum psalterium Mariae« des Caplans Nitzschewitz noch
jetzt in prächtiger Farbengebung der damaligen Kreuzzugstimmung Ausdruck gibt,1 sollte auch den
Georgsbrüdern die Pracht- und Volksausgabe des Gebetbuches durch farbig ausgeschmückte Holz-
schnitte Glaubensinbrunst und Begeisterung zum Kreuzeskampfe wecken.
III.
Der Zweck des Monogrammes MA.
st der künstlerische Schmuck des Gebetbuches nicht eine bewusste Blüthenlese der
zeitgenössischen Kunst zur persönlichen Erbauung des Kaisers sondern eine mehr
zufällige Ansammlung von Holzschnittentwürfen im Dienste seiner literarisch-poli-
tischen Ideale, so bedeutet dies auch eine veränderte Auffassung von der Künstler-
persönlichkeit des räthselhaften Anonymus MA. Es braucht nicht ein bevorzugter
Künstler zu sein, dessen Zeichnung dem Kaiser zu seiner Andacht unentbehrlich war.
Seine Antheilnahme an den Entwürfen unterscheidet sich in ihrer Bedeutung für den Kaiser nicht von
der Heranziehung eines Wolfgang Traut zur Arbeit an der Ehrenpforte. Nur als tüchtiger Holzschnitt-
zeichner muss er gegolten haben.
Die Künstler, zu welchen diese Fährte führt, lassen sich aber noch enger einkreisen, wenn man
bedenkt, dass der Anonymus in letzter Linie beansprucht wurde, die zurückgekommenen Lagen Bai-
dungs rasch auszuschmücken. Nahe erreichbar wie Altdorfer und Burgkmair, wird er dem Augsburger
Centralbureau leicht zur Hand gewesen sein.
Diese Schlüsse weisen der Forschung eine andere Richtung, als sie bisher verfolgte. Der her-
gebrachten Zweckauffassung vom Gebetbuche entsprach die offengelassene Möglichkeit, dass die auf
nicht illustrirten Bogen befindlichen Monogramme DH und AM Zuweisungsmarken für die Künstler
gewesen wären. Die unter den Randzeichnungen wirklich befindlichen Künstlerzeichen des MA und
DH erhielten dadurch eine gesteigerte Beweiskraft für ihre Richtigkeit, dass sie, falls nicht vor der
Vertheilung, so doch »etwa bald nach der Vollendung« den Randzeichnungen beigefügt galten.2 Auch
für die übrigen Besanconer Monogramme bedingte dies ein besonderes Vertrauen, da sie von einer und
derselben Person hingeschrieben sein sollten. Abgesehen von den als späte Fälschungen erkannten
Künstlerzeichen im Münchener Fragment, trennte daher für die bisherige Forschung nur ein geringer
Zeitunterschied sämmtliche anderen Monogramme von den eigenhändigen der Künstler selbst.
Die in dieser Annahme sich begründende Zuverlässigkeit der Besanconer Zuweisungen wurde
durch die Stilkritik gestärkt. Die Gruppe der Burgkmair- und Altdorfer-Blätter, vollends die Masse der
Hans Dürer-Zeichnungen stimmte mit den beigefügten Künstlerzeichen. Daraus war auf eine Kenner-
schaft der deutschen Kunst zu schliessen, welche besonders bei dem HD hervortrat. Diese Buchstaben,
als Hans Dürer gedeutet, gaben den Namen eines bislang seinen Werken nach unsicher bestimmten
Künstlers nun im engen Zusammenhange eines Buches mit Albrecht Dürer.
Die Aehnlichkeit der Compositionen beider Künstler ist in der That so gross, dass ein Zweifel an
der Deutung des H D auf Hans Dürer um so mehr verstummen muss, als beim ersten Monogramm
(Taf. XXXIX) versucht ist, das bekannte Dürermonogramm durch das Anbringen des D unter dem
Querbalken des H nachzuahmen. Bei näherer Ueberlegung erscheint aber die mit dieser Monogrammi-
Bisherige
Versuche
zur Lösung
des Mono-
grammes MA.
1 Vgl. das auf dem Berliner Kupferstichcabinet befindliche Exemplar; Otte, a. a. O., oben.
2 Jahrbuch, Bd. III, S. 96.
79
verständlich erschien dem Illuminator damals noch als schliessliche Bestimmung der Randzeichnungen
ihre farbige Ausmalung.
Ebenso wie die zuerst vom Kaiser unterstützte Publication religiös-politischer Tendenz, das für
die Rosenkranzbruderschaften berechnete »Novum psalterium Mariae« des Caplans Nitzschewitz noch
jetzt in prächtiger Farbengebung der damaligen Kreuzzugstimmung Ausdruck gibt,1 sollte auch den
Georgsbrüdern die Pracht- und Volksausgabe des Gebetbuches durch farbig ausgeschmückte Holz-
schnitte Glaubensinbrunst und Begeisterung zum Kreuzeskampfe wecken.
III.
Der Zweck des Monogrammes MA.
st der künstlerische Schmuck des Gebetbuches nicht eine bewusste Blüthenlese der
zeitgenössischen Kunst zur persönlichen Erbauung des Kaisers sondern eine mehr
zufällige Ansammlung von Holzschnittentwürfen im Dienste seiner literarisch-poli-
tischen Ideale, so bedeutet dies auch eine veränderte Auffassung von der Künstler-
persönlichkeit des räthselhaften Anonymus MA. Es braucht nicht ein bevorzugter
Künstler zu sein, dessen Zeichnung dem Kaiser zu seiner Andacht unentbehrlich war.
Seine Antheilnahme an den Entwürfen unterscheidet sich in ihrer Bedeutung für den Kaiser nicht von
der Heranziehung eines Wolfgang Traut zur Arbeit an der Ehrenpforte. Nur als tüchtiger Holzschnitt-
zeichner muss er gegolten haben.
Die Künstler, zu welchen diese Fährte führt, lassen sich aber noch enger einkreisen, wenn man
bedenkt, dass der Anonymus in letzter Linie beansprucht wurde, die zurückgekommenen Lagen Bai-
dungs rasch auszuschmücken. Nahe erreichbar wie Altdorfer und Burgkmair, wird er dem Augsburger
Centralbureau leicht zur Hand gewesen sein.
Diese Schlüsse weisen der Forschung eine andere Richtung, als sie bisher verfolgte. Der her-
gebrachten Zweckauffassung vom Gebetbuche entsprach die offengelassene Möglichkeit, dass die auf
nicht illustrirten Bogen befindlichen Monogramme DH und AM Zuweisungsmarken für die Künstler
gewesen wären. Die unter den Randzeichnungen wirklich befindlichen Künstlerzeichen des MA und
DH erhielten dadurch eine gesteigerte Beweiskraft für ihre Richtigkeit, dass sie, falls nicht vor der
Vertheilung, so doch »etwa bald nach der Vollendung« den Randzeichnungen beigefügt galten.2 Auch
für die übrigen Besanconer Monogramme bedingte dies ein besonderes Vertrauen, da sie von einer und
derselben Person hingeschrieben sein sollten. Abgesehen von den als späte Fälschungen erkannten
Künstlerzeichen im Münchener Fragment, trennte daher für die bisherige Forschung nur ein geringer
Zeitunterschied sämmtliche anderen Monogramme von den eigenhändigen der Künstler selbst.
Die in dieser Annahme sich begründende Zuverlässigkeit der Besanconer Zuweisungen wurde
durch die Stilkritik gestärkt. Die Gruppe der Burgkmair- und Altdorfer-Blätter, vollends die Masse der
Hans Dürer-Zeichnungen stimmte mit den beigefügten Künstlerzeichen. Daraus war auf eine Kenner-
schaft der deutschen Kunst zu schliessen, welche besonders bei dem HD hervortrat. Diese Buchstaben,
als Hans Dürer gedeutet, gaben den Namen eines bislang seinen Werken nach unsicher bestimmten
Künstlers nun im engen Zusammenhange eines Buches mit Albrecht Dürer.
Die Aehnlichkeit der Compositionen beider Künstler ist in der That so gross, dass ein Zweifel an
der Deutung des H D auf Hans Dürer um so mehr verstummen muss, als beim ersten Monogramm
(Taf. XXXIX) versucht ist, das bekannte Dürermonogramm durch das Anbringen des D unter dem
Querbalken des H nachzuahmen. Bei näherer Ueberlegung erscheint aber die mit dieser Monogrammi-
Bisherige
Versuche
zur Lösung
des Mono-
grammes MA.
1 Vgl. das auf dem Berliner Kupferstichcabinet befindliche Exemplar; Otte, a. a. O., oben.
2 Jahrbuch, Bd. III, S. 96.