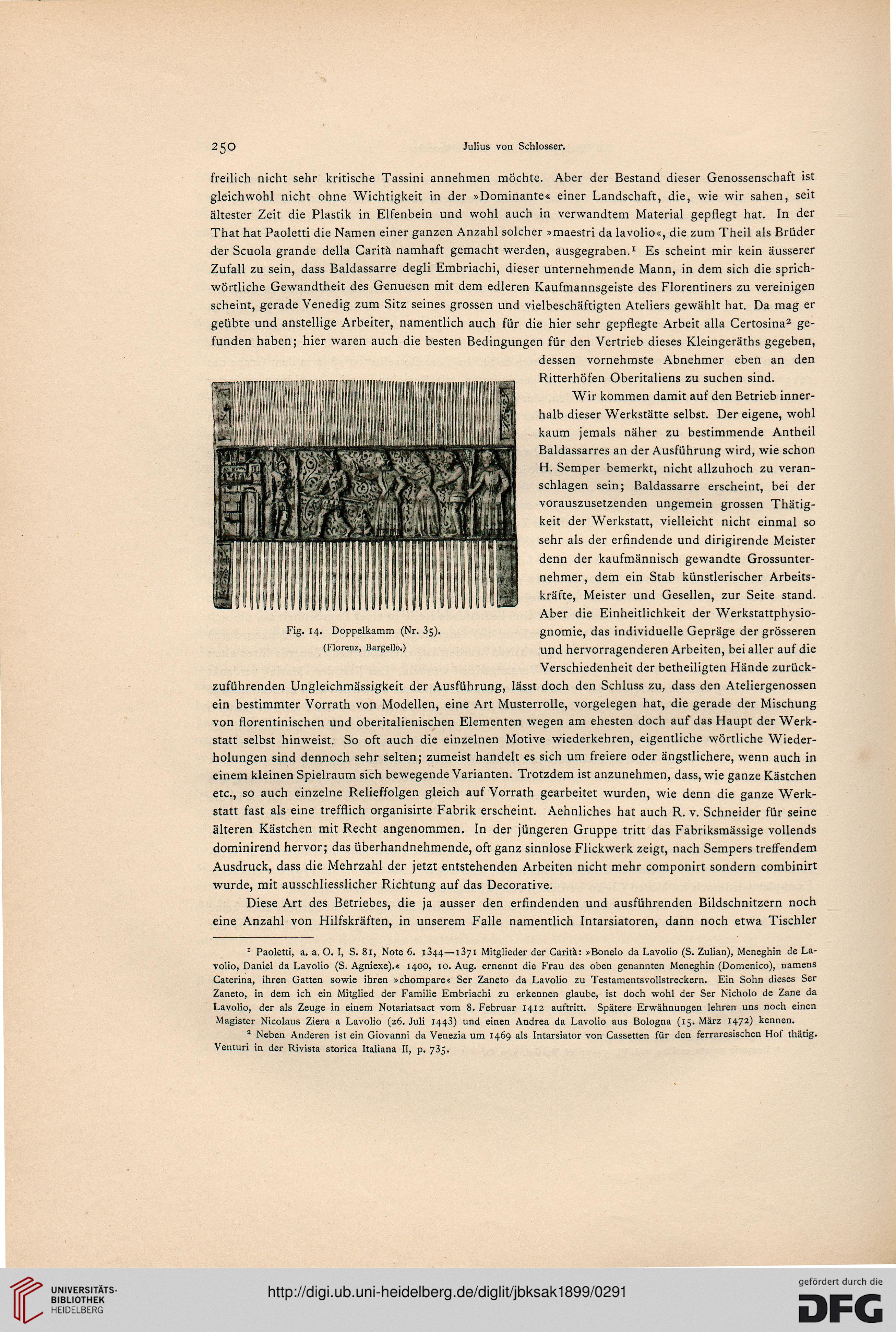250
Julius von Schlosser.
freilich nicht sehr kritische Tassini annehmen möchte. Aber der Bestand dieser Genossenschaft ist
gleichwohl nicht ohne Wichtigkeit in der »Dominante« einer Landschaft, die, wie wir sahen, seit
ältester Zeit die Plastik in Elfenbein und wohl auch in verwandtem Material gepflegt hat. In der
That hat Paoletti die Namen einer ganzen Anzahl solcher »maestri da lavolio«, die zum Theil als Brüder
der Scuola grande della Caritä namhaft gemacht werden, ausgegraben.1 Es scheint mir kein äusserer
Zufall zu sein, dass Baldassarre degli Embriachi, dieser unternehmende Mann, in dem sich die sprich-
wörtliche Gewandtheit des Genuesen mit dem edleren Kaufmannsgeiste des Florentiners zu vereinigen
scheint, gerade Venedig zum Sitz seines grossen und vielbeschäftigten Ateliers gewählt hat. Da mag er
geübte und anstellige Arbeiter, namentlich auch für die hier sehr gepflegte Arbeit alla Certosina2 ge-
funden haben; hier waren auch die besten Bedingungen für den Vertrieb dieses Kleingeräths gegeben,
dessen vornehmste Abnehmer eben an den
Ritterhöfen Oberitaliens zu suchen sind.
Wir kommen damit auf den Betrieb inner-
halb dieser Werkstätte selbst. Der eigene, wohl
kaum jemals näher zu bestimmende Antheil
Baldassarres an der Ausführung wird, wie schon
H. Semper bemerkt, nicht allzuhoch zu veran-
schlagen sein; Baldassarre erscheint, bei der
vorauszusetzenden ungemein grossen Thätig-
keit der Werkstatt, vielleicht nicht einmal so
sehr als der erfindende und dirigirende Meister
denn der kaufmännisch gewandte Grossunter-
nehmer, dem ein Stab künstlerischer Arbeits-
kräfte, Meister und Gesellen, zur Seite stand.
Aber die Einheitlichkeit der Werkstattphysio-
gnomie, das individuelle Gepräge der grösseren
und hervorragenderen Arbeiten, bei aller auf die
Verschiedenheit der betheiligten Hände zurück-
zuführenden Ungleichmässigkeit der Ausführung, lässt doch den Schluss zu, dass den Ateliergenossen
ein bestimmter Vorrath von Modellen, eine Art Musterrolle, vorgelegen hat, die gerade der Mischung
von florentinischen und oberitalienischen Elementen wegen am ehesten doch auf das Haupt der Werk-
statt selbst hinweist. So oft auch die einzelnen Motive wiederkehren, eigentliche wörtliche Wieder-
holungen sind dennoch sehr selten; zumeist handelt es sich um freiere oder ängstlichere, wenn auch in
einem kleinen Spielraum sich bewegende Varianten. Trotzdem ist anzunehmen, dass, wie ganze Kästchen
etc., so auch einzelne Relieffolgen gleich auf Vorrath gearbeitet wurden, wie denn die ganze Werk-
statt fast als eine trefflich organisirte Fabrik erscheint. Aehnliches hat auch R. v. Schneider für seine
älteren Kästchen mit Recht angenommen. In der jüngeren Gruppe tritt das Fabriksmässige vollends
dominirend hervor; das überhandnehmende, oft ganz sinnlose Flickwerk zeigt, nach Sempers treffendem
Ausdruck, dass die Mehrzahl der jetzt entstehenden Arbeiten nicht mehr componirt sondern combinirt
wurde, mit ausschliesslicher Richtung auf das Decorative.
Diese Art des Betriebes, die ja ausser den erfindenden und ausführenden Bildschnitzern noch
eine Anzahl von Hilfskräften, in unserem Falle namentlich Intarsiatoren, dann noch etwa Tischler
Fig. 14. Doppelkamm (Nr. 35).
(Florenz, Bargello.)
1 Paoletti, a. a. O. I, S. 81, Note 6. 1344—1371 Mitglieder der Caritä: »Bonelo da Lavolio (S. Zulian), Meneghin de La-
volio, Daniel da Lavolio (S. Agniexe).« 1400, 10. Aug. ernennt die Frau des oben genannten Meneghin (Domenico), namens
Caterina, ihren Gatten sowie ihren »chompare« Ser Zaneto da Lavolio zu Testamentsvollstreckern. Ein Sohn dieses Ser
Zaneto, in dem ich ein Mitglied der Familie Embriachi zu erkennen glaube, ist doch wohl der Ser Nicholo de Zane da
Lavolio, der als Zeuge in einem Notariatsact vom 8. Februar 1412 auftritt. Spätere Erwähnungen lehren uns noch einen
Magister Nicolaus Ziera a Lavolio (26. Juli 1443) und einen Andrea da Lavolio aus Bologna (15. März I472) kennen.
3 Neben Anderen ist ein Giovanni da Venezia um 1469 als Intarsiator von Cassetten für den ferraresischen Hof thätig.
Venturi in der Rivista storica Italiana II, p. 735.
Julius von Schlosser.
freilich nicht sehr kritische Tassini annehmen möchte. Aber der Bestand dieser Genossenschaft ist
gleichwohl nicht ohne Wichtigkeit in der »Dominante« einer Landschaft, die, wie wir sahen, seit
ältester Zeit die Plastik in Elfenbein und wohl auch in verwandtem Material gepflegt hat. In der
That hat Paoletti die Namen einer ganzen Anzahl solcher »maestri da lavolio«, die zum Theil als Brüder
der Scuola grande della Caritä namhaft gemacht werden, ausgegraben.1 Es scheint mir kein äusserer
Zufall zu sein, dass Baldassarre degli Embriachi, dieser unternehmende Mann, in dem sich die sprich-
wörtliche Gewandtheit des Genuesen mit dem edleren Kaufmannsgeiste des Florentiners zu vereinigen
scheint, gerade Venedig zum Sitz seines grossen und vielbeschäftigten Ateliers gewählt hat. Da mag er
geübte und anstellige Arbeiter, namentlich auch für die hier sehr gepflegte Arbeit alla Certosina2 ge-
funden haben; hier waren auch die besten Bedingungen für den Vertrieb dieses Kleingeräths gegeben,
dessen vornehmste Abnehmer eben an den
Ritterhöfen Oberitaliens zu suchen sind.
Wir kommen damit auf den Betrieb inner-
halb dieser Werkstätte selbst. Der eigene, wohl
kaum jemals näher zu bestimmende Antheil
Baldassarres an der Ausführung wird, wie schon
H. Semper bemerkt, nicht allzuhoch zu veran-
schlagen sein; Baldassarre erscheint, bei der
vorauszusetzenden ungemein grossen Thätig-
keit der Werkstatt, vielleicht nicht einmal so
sehr als der erfindende und dirigirende Meister
denn der kaufmännisch gewandte Grossunter-
nehmer, dem ein Stab künstlerischer Arbeits-
kräfte, Meister und Gesellen, zur Seite stand.
Aber die Einheitlichkeit der Werkstattphysio-
gnomie, das individuelle Gepräge der grösseren
und hervorragenderen Arbeiten, bei aller auf die
Verschiedenheit der betheiligten Hände zurück-
zuführenden Ungleichmässigkeit der Ausführung, lässt doch den Schluss zu, dass den Ateliergenossen
ein bestimmter Vorrath von Modellen, eine Art Musterrolle, vorgelegen hat, die gerade der Mischung
von florentinischen und oberitalienischen Elementen wegen am ehesten doch auf das Haupt der Werk-
statt selbst hinweist. So oft auch die einzelnen Motive wiederkehren, eigentliche wörtliche Wieder-
holungen sind dennoch sehr selten; zumeist handelt es sich um freiere oder ängstlichere, wenn auch in
einem kleinen Spielraum sich bewegende Varianten. Trotzdem ist anzunehmen, dass, wie ganze Kästchen
etc., so auch einzelne Relieffolgen gleich auf Vorrath gearbeitet wurden, wie denn die ganze Werk-
statt fast als eine trefflich organisirte Fabrik erscheint. Aehnliches hat auch R. v. Schneider für seine
älteren Kästchen mit Recht angenommen. In der jüngeren Gruppe tritt das Fabriksmässige vollends
dominirend hervor; das überhandnehmende, oft ganz sinnlose Flickwerk zeigt, nach Sempers treffendem
Ausdruck, dass die Mehrzahl der jetzt entstehenden Arbeiten nicht mehr componirt sondern combinirt
wurde, mit ausschliesslicher Richtung auf das Decorative.
Diese Art des Betriebes, die ja ausser den erfindenden und ausführenden Bildschnitzern noch
eine Anzahl von Hilfskräften, in unserem Falle namentlich Intarsiatoren, dann noch etwa Tischler
Fig. 14. Doppelkamm (Nr. 35).
(Florenz, Bargello.)
1 Paoletti, a. a. O. I, S. 81, Note 6. 1344—1371 Mitglieder der Caritä: »Bonelo da Lavolio (S. Zulian), Meneghin de La-
volio, Daniel da Lavolio (S. Agniexe).« 1400, 10. Aug. ernennt die Frau des oben genannten Meneghin (Domenico), namens
Caterina, ihren Gatten sowie ihren »chompare« Ser Zaneto da Lavolio zu Testamentsvollstreckern. Ein Sohn dieses Ser
Zaneto, in dem ich ein Mitglied der Familie Embriachi zu erkennen glaube, ist doch wohl der Ser Nicholo de Zane da
Lavolio, der als Zeuge in einem Notariatsact vom 8. Februar 1412 auftritt. Spätere Erwähnungen lehren uns noch einen
Magister Nicolaus Ziera a Lavolio (26. Juli 1443) und einen Andrea da Lavolio aus Bologna (15. März I472) kennen.
3 Neben Anderen ist ein Giovanni da Venezia um 1469 als Intarsiator von Cassetten für den ferraresischen Hof thätig.
Venturi in der Rivista storica Italiana II, p. 735.