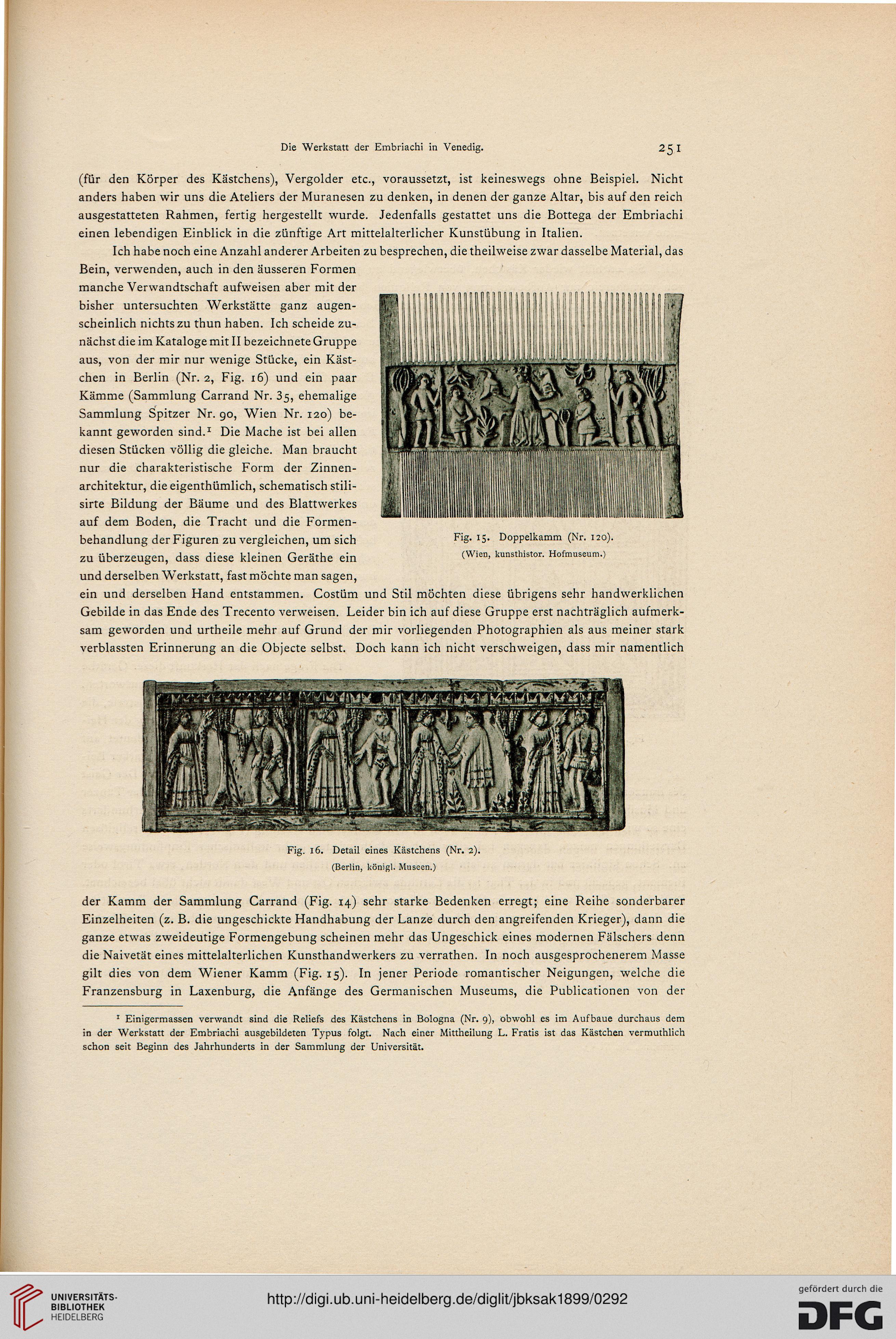Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.
251
(für den Körper des Kästchens), Vergolder etc., voraussetzt, ist keineswegs ohne Beispiel. Nicht
anders haben wir uns die Ateliers der Muranesen zu denken, in denen der ganze Altar, bis auf den reich
ausgestatteten Rahmen, fertig hergestellt wurde. Jedenfalls gestattet uns die Bottega der Embriachi
einen lebendigen Einblick in die zünftige Art mittelalterlicher Kunstübung in Italien.
Ich habe noch eine Anzahl anderer Arbeiten zu besprechen, die theilweise zwar dasselbe Material, das
Bein, verwenden, auch in den äusseren Formen
manche Verwandtschaft aufweisen aber mit der
bisher untersuchten Werkstätte ganz augen-
scheinlich nichts zu thun haben. Ich scheide zu-
nächst die im Kataloge mit II bezeichnete Gruppe
aus, von der mir nur wenige Stücke, ein Käst-
chen in Berlin (Nr. 2, Fig. 16) und ein paar
Kämme (Sammlung Carrand Nr. 35, ehemalige
Sammlung Spitzer Nr. 90, Wien Nr. 120) be-
kannt geworden sind.1 Die Mache ist bei allen
diesen Stücken völlig die gleiche. Man braucht
nur die charakteristische Form der Zinnen-
architektur, die eigenthümlich, schematisch stili-
sirte Bildung der Bäume und des Blattwerkes
auf dem Boden, die Tracht und die Formen-
behandlung der Figuren zu vergleichen, um sich
zu überzeugen, dass diese kleinen Geräthe ein
und derselben Werkstatt, fast möchte man sagen,
ein und derselben Hand entstammen. Costüm und Stil möchten diese übrigens sehr handwerklichen
Gebilde in das Ende des Trecento verweisen. Leider bin ich auf diese Gruppe erst nachträglich aufmerk-
sam geworden und urtheile mehr auf Grund der mir vorliegenden Photographien als aus meiner stark
verblassten Erinnerung an die Objecte selbst. Doch kann ich nicht verschweigen, dass mir namentlich
Fig. 15. Doppelkamm (Nr. 120).
(Wien, kunsthistor. Hofmuseum.)
Fig. 16. Detail eines Kästchens (Nr. 2).
(Berlin, königl. Museen.)
der Kamm der Sammlung Carrand (Fig. 14) sehr starke Bedenken erregt; eine Reihe sonderbarer
Einzelheiten (z. B. die ungeschickte Handhabung der Lanze durch den angreifenden Krieger), dann die
ganze etwas zweideutige Formengebung scheinen mehr das Ungeschick eines modernen Fälschers denn
die Naivetät eines mittelalterlichen Kunsthandwerkers zu verrathen. In noch ausgesprochenerem Masse
gilt dies von dem Wiener Kamm (Fig. 15). In jener Periode romantischer Neigungen, welche die
Franzensburg in Laxenburg, die Anfänge des Germanischen Museums, die Publicationen von der
1 Einigermassen verwandt sind die Reliefs des Kästchens in Bologna (Nr. 9), obwohl es im Aufbaue durchaus dem
in der Werkstatt der Embriachi ausgebildeten Typus folgt. Nach einer Mittheilung L. Fratis ist das Kästchen vermuthlich
schon seit Beginn des Jahrhunderts in der Sammlung der Universität.
251
(für den Körper des Kästchens), Vergolder etc., voraussetzt, ist keineswegs ohne Beispiel. Nicht
anders haben wir uns die Ateliers der Muranesen zu denken, in denen der ganze Altar, bis auf den reich
ausgestatteten Rahmen, fertig hergestellt wurde. Jedenfalls gestattet uns die Bottega der Embriachi
einen lebendigen Einblick in die zünftige Art mittelalterlicher Kunstübung in Italien.
Ich habe noch eine Anzahl anderer Arbeiten zu besprechen, die theilweise zwar dasselbe Material, das
Bein, verwenden, auch in den äusseren Formen
manche Verwandtschaft aufweisen aber mit der
bisher untersuchten Werkstätte ganz augen-
scheinlich nichts zu thun haben. Ich scheide zu-
nächst die im Kataloge mit II bezeichnete Gruppe
aus, von der mir nur wenige Stücke, ein Käst-
chen in Berlin (Nr. 2, Fig. 16) und ein paar
Kämme (Sammlung Carrand Nr. 35, ehemalige
Sammlung Spitzer Nr. 90, Wien Nr. 120) be-
kannt geworden sind.1 Die Mache ist bei allen
diesen Stücken völlig die gleiche. Man braucht
nur die charakteristische Form der Zinnen-
architektur, die eigenthümlich, schematisch stili-
sirte Bildung der Bäume und des Blattwerkes
auf dem Boden, die Tracht und die Formen-
behandlung der Figuren zu vergleichen, um sich
zu überzeugen, dass diese kleinen Geräthe ein
und derselben Werkstatt, fast möchte man sagen,
ein und derselben Hand entstammen. Costüm und Stil möchten diese übrigens sehr handwerklichen
Gebilde in das Ende des Trecento verweisen. Leider bin ich auf diese Gruppe erst nachträglich aufmerk-
sam geworden und urtheile mehr auf Grund der mir vorliegenden Photographien als aus meiner stark
verblassten Erinnerung an die Objecte selbst. Doch kann ich nicht verschweigen, dass mir namentlich
Fig. 15. Doppelkamm (Nr. 120).
(Wien, kunsthistor. Hofmuseum.)
Fig. 16. Detail eines Kästchens (Nr. 2).
(Berlin, königl. Museen.)
der Kamm der Sammlung Carrand (Fig. 14) sehr starke Bedenken erregt; eine Reihe sonderbarer
Einzelheiten (z. B. die ungeschickte Handhabung der Lanze durch den angreifenden Krieger), dann die
ganze etwas zweideutige Formengebung scheinen mehr das Ungeschick eines modernen Fälschers denn
die Naivetät eines mittelalterlichen Kunsthandwerkers zu verrathen. In noch ausgesprochenerem Masse
gilt dies von dem Wiener Kamm (Fig. 15). In jener Periode romantischer Neigungen, welche die
Franzensburg in Laxenburg, die Anfänge des Germanischen Museums, die Publicationen von der
1 Einigermassen verwandt sind die Reliefs des Kästchens in Bologna (Nr. 9), obwohl es im Aufbaue durchaus dem
in der Werkstatt der Embriachi ausgebildeten Typus folgt. Nach einer Mittheilung L. Fratis ist das Kästchen vermuthlich
schon seit Beginn des Jahrhunderts in der Sammlung der Universität.