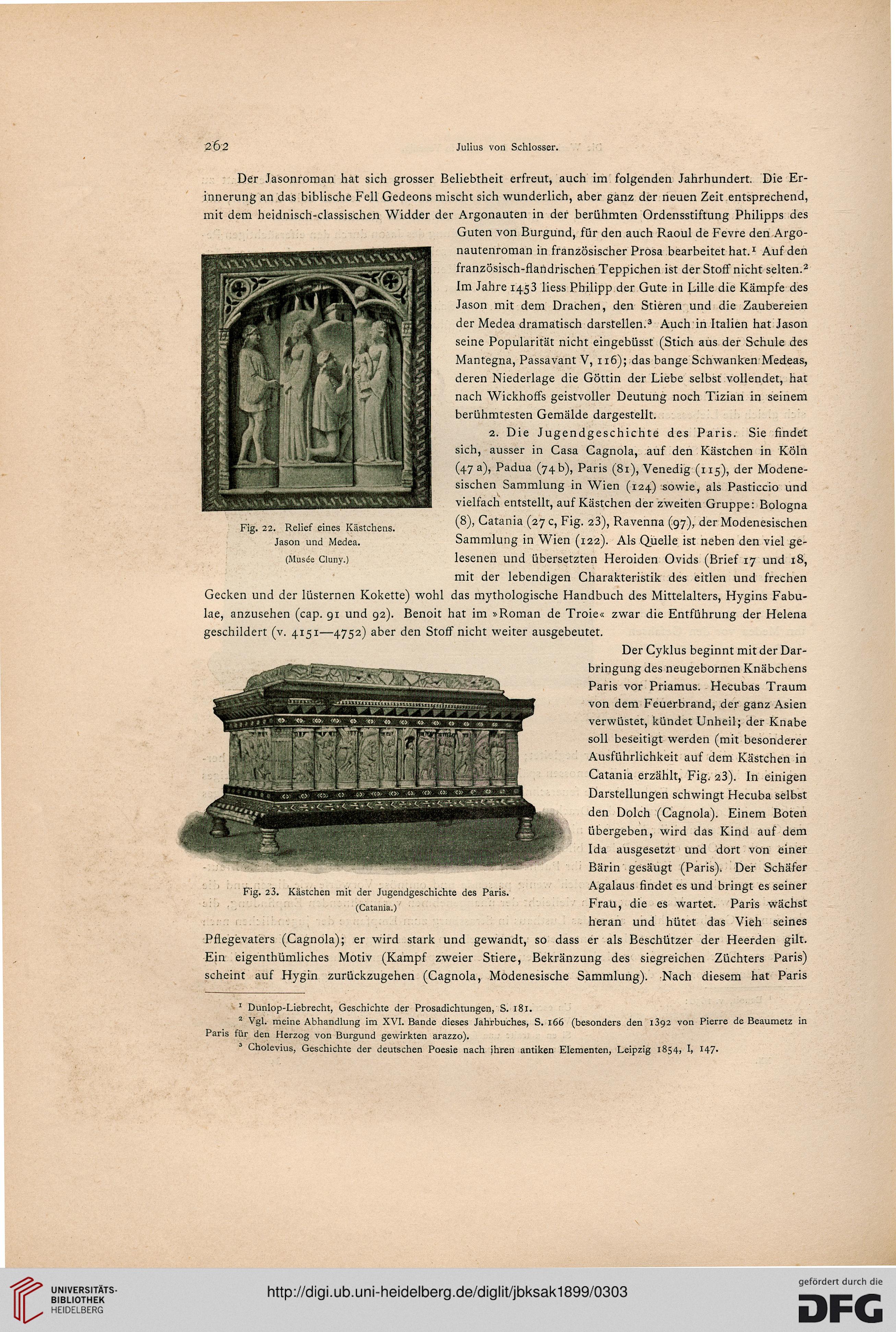2Ö2
Julius von Schlosser.
Fig. 22. Relief eines Kästchens.
Jason und Medea.
(Musee Cluny.)
Der Jasonroman hat sich grosser Beliebtheit erfreut, auch im folgenden Jahrhundert. Die Er-
innerung an das biblische Fell Gedeons mischt sich wunderlich, aber ganz der neuen Zeit entsprechend,
mit dem heidnisch-classischen Widder der Argonauten in der berühmten Ordensstiftung Philipps des
Guten von Burgund, für den auch Raoul de Fevre den Argo-
nautenroman in französischer Prosa bearbeitet hat.I Auf den
französisch-flandrischen Teppichen ist der Stoff nicht selten.2
Im Jahre 1453 Hess Philipp der Gute in Lille die Kämpfe des
Jason mit dem Drachen, den Stieren und die Zaubereien
der Medea dramatisch darstellen.3 Auch in Italien hat Jason
seine Popularität nicht eingebüsst (Stich aus der Schule des
Mantegna, Passavant V, 116); das bange Schwanken Medeas,
deren Niederlage die Göttin der Liebe selbst vollendet, hat
nach Wickhoffs geistvoller Deutung noch Tizian in seinem
berühmtesten Gemälde dargestellt.
2. Die Jugendgeschichte des Paris. Sie findet
sich, ausser in Casa Cagnola, auf den Kästchen in Köln
(47 a), Padua (74 b), Paris (81), Venedig (115), der Modene-
sischen Sammlung in Wien (124) sowie, als Pasticcio und
vielfach entstellt, auf Kästchen der zweiten Gruppe: Bologna
(8), Gatania (27 c, Fig. 23), Ravenna (97), der Modenesischen
Sammlung in Wien (122). Als Quelle ist neben den viel ge-
lesenen und übersetzten Heroiden Ovids (Brief 17 und 18,
mit der lebendigen Charakteristik des eitlen und frechen
Gecken und der lüsternen Kokette) wohl das mythologische Handbuch des Mittelalters, Hygins Fabu-
lae, anzusehen (cap. 91 und 92). Benoit hat im »Roman de Troie« zwar die Entführung der Helena
geschildert (v. 4151—4752) aber den Stoff nicht weiter ausgebeutet.
Der Cyklus beginnt mit der Dar-
bringung des neugebornen Knäbchens
Paris vor Priamus. Hecubas Traum
von dem Feuerbrand, der ganz Asien
verwüstet, kündet Unheil; der Knabe
soll beseitigt werden (mit besonderer
Ausführlichkeit auf dem Kästchen in
Catania erzählt, Fig. 23). In einigen
Darstellungen schwingt Hecuba selbst
den Dolch (Cagnola). Einem Boten
übergeben, wird das Kind auf dem
Ida ausgesetzt und dort von einer
Bärin gesäugt (Paris). Der Schäfer
Agalaus findet es und bringt es seiner
Frau, die es wartet. Paris wächst
heran und hütet das Vieh seines
Pflegevaters (Cagnola); er wird stark und gewandt, so dass er als Beschützer der Heerden gilt.
Ein eigenthümliches Motiv (Kampf zweier Stiere, Bekränzung des siegreichen Züchters Paris)
scheint auf Hygin zurückzugehen (Cagnola, Modenesische Sammlung). Nach diesem hat Paris
Fig. 23. Kästchen mit der Jugendgeschichte des Paris.
(Catania.)
1 Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, S. 181.
2 Vgl. meine Abhandlung im XVI. Bande dieses Jahrbuches, S. 166 (besonders den 1392 von Pierre de Beaumetz in
Paris für den Herzog von Burgund gewirkten arazzo).
3 Cholevius, Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, Leipzig 1854, I, 147.
Julius von Schlosser.
Fig. 22. Relief eines Kästchens.
Jason und Medea.
(Musee Cluny.)
Der Jasonroman hat sich grosser Beliebtheit erfreut, auch im folgenden Jahrhundert. Die Er-
innerung an das biblische Fell Gedeons mischt sich wunderlich, aber ganz der neuen Zeit entsprechend,
mit dem heidnisch-classischen Widder der Argonauten in der berühmten Ordensstiftung Philipps des
Guten von Burgund, für den auch Raoul de Fevre den Argo-
nautenroman in französischer Prosa bearbeitet hat.I Auf den
französisch-flandrischen Teppichen ist der Stoff nicht selten.2
Im Jahre 1453 Hess Philipp der Gute in Lille die Kämpfe des
Jason mit dem Drachen, den Stieren und die Zaubereien
der Medea dramatisch darstellen.3 Auch in Italien hat Jason
seine Popularität nicht eingebüsst (Stich aus der Schule des
Mantegna, Passavant V, 116); das bange Schwanken Medeas,
deren Niederlage die Göttin der Liebe selbst vollendet, hat
nach Wickhoffs geistvoller Deutung noch Tizian in seinem
berühmtesten Gemälde dargestellt.
2. Die Jugendgeschichte des Paris. Sie findet
sich, ausser in Casa Cagnola, auf den Kästchen in Köln
(47 a), Padua (74 b), Paris (81), Venedig (115), der Modene-
sischen Sammlung in Wien (124) sowie, als Pasticcio und
vielfach entstellt, auf Kästchen der zweiten Gruppe: Bologna
(8), Gatania (27 c, Fig. 23), Ravenna (97), der Modenesischen
Sammlung in Wien (122). Als Quelle ist neben den viel ge-
lesenen und übersetzten Heroiden Ovids (Brief 17 und 18,
mit der lebendigen Charakteristik des eitlen und frechen
Gecken und der lüsternen Kokette) wohl das mythologische Handbuch des Mittelalters, Hygins Fabu-
lae, anzusehen (cap. 91 und 92). Benoit hat im »Roman de Troie« zwar die Entführung der Helena
geschildert (v. 4151—4752) aber den Stoff nicht weiter ausgebeutet.
Der Cyklus beginnt mit der Dar-
bringung des neugebornen Knäbchens
Paris vor Priamus. Hecubas Traum
von dem Feuerbrand, der ganz Asien
verwüstet, kündet Unheil; der Knabe
soll beseitigt werden (mit besonderer
Ausführlichkeit auf dem Kästchen in
Catania erzählt, Fig. 23). In einigen
Darstellungen schwingt Hecuba selbst
den Dolch (Cagnola). Einem Boten
übergeben, wird das Kind auf dem
Ida ausgesetzt und dort von einer
Bärin gesäugt (Paris). Der Schäfer
Agalaus findet es und bringt es seiner
Frau, die es wartet. Paris wächst
heran und hütet das Vieh seines
Pflegevaters (Cagnola); er wird stark und gewandt, so dass er als Beschützer der Heerden gilt.
Ein eigenthümliches Motiv (Kampf zweier Stiere, Bekränzung des siegreichen Züchters Paris)
scheint auf Hygin zurückzugehen (Cagnola, Modenesische Sammlung). Nach diesem hat Paris
Fig. 23. Kästchen mit der Jugendgeschichte des Paris.
(Catania.)
1 Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, S. 181.
2 Vgl. meine Abhandlung im XVI. Bande dieses Jahrbuches, S. 166 (besonders den 1392 von Pierre de Beaumetz in
Paris für den Herzog von Burgund gewirkten arazzo).
3 Cholevius, Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, Leipzig 1854, I, 147.