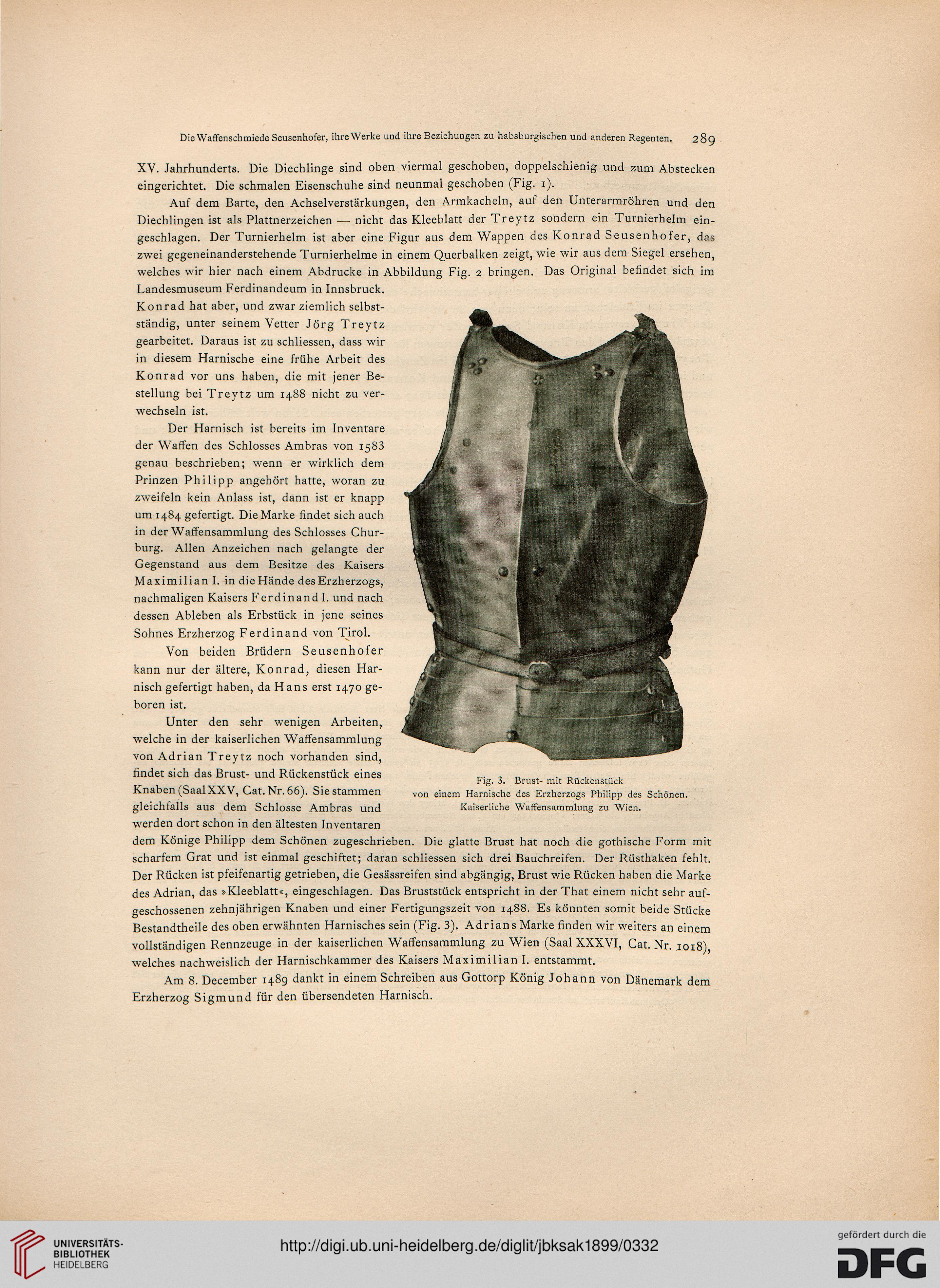Die Waffenschmiede Seusenhofer, ihre Werke und ihre Beziehungen zu habsburgischen und anderen Regenten. 289
XV. Jahrhunderts. Die Diechlinge sind oben viermal geschoben, doppelschienig und zum Abstecken
eingerichtet. Die schmalen Eisenschuhe sind neunmal geschoben (Fig. 1).
Auf dem Barte, den Achselverstärkungen, den Armkacheln, auf den Unterarmröhren und den
Diechlingen ist als Plattnerzeichen — nicht das Kleeblatt der Treytz sondern ein Turnierhelm ein-
geschlagen. Der Turnierhelm ist aber eine Figur aus dem Wappen des Konrad Seusenhofer, das
zwei gegeneinanderstehende Turnierhelme in einem Querbalken zeigt, wie wir aus dem Siegel ersehen,
welches wir hier nach einem Abdrucke in Abbildung Fig. 2 bringen. Das Original befindet sich im
Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck.
Konrad hat aber, und zwar ziemlich selbst-
ständig, unter seinem Vetter Jörg Treytz
gearbeitet. Daraus ist zu schliessen, dass wir
in diesem Harnische eine frühe Arbeit des
Konrad vor uns haben, die mit jener Be-
stellung bei Treytz um 1488 nicht zu ver-
wechseln ist.
Der Harnisch ist bereits im Inventare
der Waffen des Schlosses Ambras von 1583
genau beschrieben; wenn er wirklich dem
Prinzen Philipp angehört hatte, woran zu
zweifeln kein Anlass ist, dann ist er knapp
um 1484 gefertigt. Die Marke findet sich auch
in der Waffensammlung des Schlosses Chur-
burg. Allen Anzeichen nach gelangte der
Gegenstand aus dem Besitze des Kaisers
Maximilian I. in die Hände des Erzherzogs,
nachmaligen Kaisers Ferdinand I. und nach
dessen Ableben als Erbstück in jene seines
Sohnes Erzherzog Ferdinand von Tirol.
Von beiden Brüdern Seusenhofer
kann nur der ältere, Konrad, diesen Har-
nisch gefertigt haben, da Hans erst 1470 ge-
boren ist.
Unter den sehr wenigen Arbeiten,
welche in der kaiserlichen Waffensammlung
von Adrian Treytz noch vorhanden sind,
findet sich das Brust- und Rückenstück eines
Knaben (SaalXXV, Cat.Nr.66). Sie stammen
gleichfalls aus dem Schlosse Ambras und
werden dort schon in den ältesten Inventaren
dem Könige Philipp dem Schönen zugeschrieben. Die glatte Brust hat noch die gothische Form mit
scharfem Grat und ist einmal geschiftet; daran schliessen sich drei Bauchreifen. Der Rüsthaken fehlt.
Der Rücken ist pfeifenartig getrieben, die Gesässreifen sind abgängig, Brust wie Rücken haben die Marke
des Adrian, das »Kleeblatt«, eingeschlagen. Das Bruststück entspricht in der That einem nicht sehr auf-
geschossenen zehnjährigen Knaben und einer Fertigungszeit von 1488. Es könnten somit beide Stücke
Bestandtheile des oben erwähnten Harnisches sein (Fig. 3). Adrians Marke finden wir weiters an einem
vollständigen Rennzeuge in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien (Saal XXXVI, Cat. Nr. 1018)
welches nachweislich der Harnischkammer des Kaisers Maximilian I. entstammt.
Am 8. December 1489 dankt in einem Schreiben aus Gottorp König Johann von Dänemark dem
Erzherzog Sigmund für den übersendeten Harnisch.
Fig. 3. Brust- mit Rückenstück
von einem Harnische des Erzherzogs Philipp des Schönen.
Kaiserliche Waffensammlung zu Wien.
XV. Jahrhunderts. Die Diechlinge sind oben viermal geschoben, doppelschienig und zum Abstecken
eingerichtet. Die schmalen Eisenschuhe sind neunmal geschoben (Fig. 1).
Auf dem Barte, den Achselverstärkungen, den Armkacheln, auf den Unterarmröhren und den
Diechlingen ist als Plattnerzeichen — nicht das Kleeblatt der Treytz sondern ein Turnierhelm ein-
geschlagen. Der Turnierhelm ist aber eine Figur aus dem Wappen des Konrad Seusenhofer, das
zwei gegeneinanderstehende Turnierhelme in einem Querbalken zeigt, wie wir aus dem Siegel ersehen,
welches wir hier nach einem Abdrucke in Abbildung Fig. 2 bringen. Das Original befindet sich im
Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck.
Konrad hat aber, und zwar ziemlich selbst-
ständig, unter seinem Vetter Jörg Treytz
gearbeitet. Daraus ist zu schliessen, dass wir
in diesem Harnische eine frühe Arbeit des
Konrad vor uns haben, die mit jener Be-
stellung bei Treytz um 1488 nicht zu ver-
wechseln ist.
Der Harnisch ist bereits im Inventare
der Waffen des Schlosses Ambras von 1583
genau beschrieben; wenn er wirklich dem
Prinzen Philipp angehört hatte, woran zu
zweifeln kein Anlass ist, dann ist er knapp
um 1484 gefertigt. Die Marke findet sich auch
in der Waffensammlung des Schlosses Chur-
burg. Allen Anzeichen nach gelangte der
Gegenstand aus dem Besitze des Kaisers
Maximilian I. in die Hände des Erzherzogs,
nachmaligen Kaisers Ferdinand I. und nach
dessen Ableben als Erbstück in jene seines
Sohnes Erzherzog Ferdinand von Tirol.
Von beiden Brüdern Seusenhofer
kann nur der ältere, Konrad, diesen Har-
nisch gefertigt haben, da Hans erst 1470 ge-
boren ist.
Unter den sehr wenigen Arbeiten,
welche in der kaiserlichen Waffensammlung
von Adrian Treytz noch vorhanden sind,
findet sich das Brust- und Rückenstück eines
Knaben (SaalXXV, Cat.Nr.66). Sie stammen
gleichfalls aus dem Schlosse Ambras und
werden dort schon in den ältesten Inventaren
dem Könige Philipp dem Schönen zugeschrieben. Die glatte Brust hat noch die gothische Form mit
scharfem Grat und ist einmal geschiftet; daran schliessen sich drei Bauchreifen. Der Rüsthaken fehlt.
Der Rücken ist pfeifenartig getrieben, die Gesässreifen sind abgängig, Brust wie Rücken haben die Marke
des Adrian, das »Kleeblatt«, eingeschlagen. Das Bruststück entspricht in der That einem nicht sehr auf-
geschossenen zehnjährigen Knaben und einer Fertigungszeit von 1488. Es könnten somit beide Stücke
Bestandtheile des oben erwähnten Harnisches sein (Fig. 3). Adrians Marke finden wir weiters an einem
vollständigen Rennzeuge in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien (Saal XXXVI, Cat. Nr. 1018)
welches nachweislich der Harnischkammer des Kaisers Maximilian I. entstammt.
Am 8. December 1489 dankt in einem Schreiben aus Gottorp König Johann von Dänemark dem
Erzherzog Sigmund für den übersendeten Harnisch.
Fig. 3. Brust- mit Rückenstück
von einem Harnische des Erzherzogs Philipp des Schönen.
Kaiserliche Waffensammlung zu Wien.