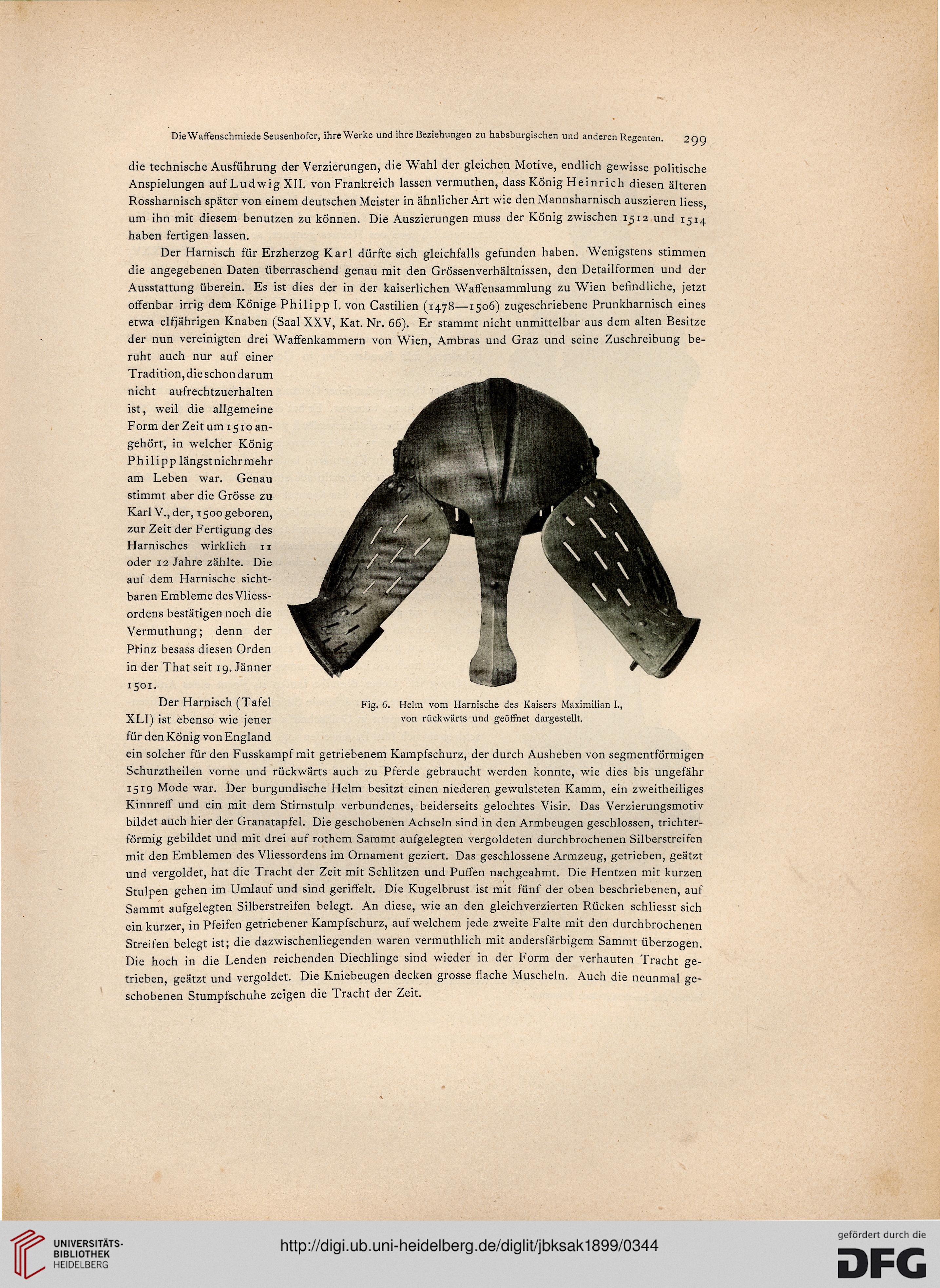DieWaffenschmiede Seusenhofer, ihre Werke und ihre Beziehungen zu habsburgischen und anderen Regenten. 2QQ
die technische Ausführung der Verzierungen, die Wahl der gleichen Motive, endlich gewisse politische
Anspielungen auf Ludwig XII. von Frankreich lassen vermuthen, dass König Heinrich diesen älteren
Rossharnisch später von einem deutschen Meister in ähnlicher Art wie den Mannsharnisch auszieren Hess,
um ihn mit diesem benutzen zu können. Die Auszierungen muss der König zwischen 1^12 und 1514
haben fertigen lassen.
Der Harnisch für Erzherzog Karl dürfte sich gleichfalls gefunden haben. Wenigstens stimmen
die angegebenen Daten überraschend genau mit den Grössenverhältnissen, den Detailformen und der
Ausstattung überein. Es ist dies der in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien befindliche, jetzt
offenbar irrig dem Könige Philipp I. von Castilien (1478—1506) zugeschriebene Prunkharnisch eines
etwa elfjährigen Knaben (Saal XXV, Kat. Nr. 66). Er stammt nicht unmittelbar aus dem alten Besitze
der nun vereinigten drei Waffenkammern von Wien, Ambras und Graz und seine Zuschreibung be-
ruht auch nur auf einer
Tradition, die schon darum
nicht aufrechtzuerhalten
ist, weil die allgemeine
Form der Zeit um 151 o an-
gehört, in welcher König
Philipp längstnichrmehr
am Leben war. Genau
stimmt aber die Grösse zu
Karl V., der, 1500 geboren,
zur Zeit der Fertigung des
Harnisches wirklich 11
oder 12 Jahre zählte. Die
auf dem Harnische sicht-
baren Embleme des Vliess-
ordens bestätigen noch die
Vermuthung; denn der
Prinz besass diesen Orden
in der That seit ig. Jänner
1501.
Der Harnisch (Tafel
XLI) ist ebenso wie jener
für den König von England
ein solcher für den Fusskampf mit getriebenem Kampfschurz, der durch Ausheben von segmentförmigen
Schurztheilen vorne und rückwärts auch zu Pferde gebraucht werden konnte, wie dies bis ungefähr
151g Mode war. Der burgundische Helm besitzt einen niederen gewulsteten Kamm, ein zweitheiliges
Kinnreff und ein mit dem Stirnstulp verbundenes, beiderseits gelochtes Visir. Das Verzierungsmotiv
bildet auch hier der Granatapfel. Die geschobenen Achseln sind in den Armbeugen geschlossen, trichter-
förmig gebildet und mit drei auf rothem Sammt aufgelegten vergoldeten durchbrochenen Silberstreifen
mit den Emblemen des Vliessordens im Ornament geziert. Das geschlossene Armzeug, getrieben, geätzt
und vergoldet, hat die Tracht der Zeit mit Schlitzen und Puffen nachgeahmt. Die Hentzen mit kurzen
Stulpen gehen im Umlauf und sind geriffelt. Die Kugelbrust ist mit fünf der oben beschriebenen, auf
Sammt aufgelegten Silberstreifen belegt. An diese, wie an den gleichverzierten Rücken schliesst sich
ein kurzer in Pfeifen getriebener Kampfschurz, auf welchem jede zweite Falte mit den durchbrochenen
Streifen belegt ist; die dazwischenliegenden waren vermuthlich mit andersfarbigem Sammt überzogen.
Die hoch in die Lenden reichenden Diechlinge sind wieder in der Form der verhauten Tracht ge-
trieben, geätzt und vergoldet. Die Kniebeugen decken grosse flache Muscheln. Auch die neunmal ge-
schobenen Stumpfschuhe zeigen die Tracht der Zeit.
Fig. 6. Helm vom Harnische des Kaisers Maximilian I..
von rückwärts und geöffnet dargestellt.
die technische Ausführung der Verzierungen, die Wahl der gleichen Motive, endlich gewisse politische
Anspielungen auf Ludwig XII. von Frankreich lassen vermuthen, dass König Heinrich diesen älteren
Rossharnisch später von einem deutschen Meister in ähnlicher Art wie den Mannsharnisch auszieren Hess,
um ihn mit diesem benutzen zu können. Die Auszierungen muss der König zwischen 1^12 und 1514
haben fertigen lassen.
Der Harnisch für Erzherzog Karl dürfte sich gleichfalls gefunden haben. Wenigstens stimmen
die angegebenen Daten überraschend genau mit den Grössenverhältnissen, den Detailformen und der
Ausstattung überein. Es ist dies der in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien befindliche, jetzt
offenbar irrig dem Könige Philipp I. von Castilien (1478—1506) zugeschriebene Prunkharnisch eines
etwa elfjährigen Knaben (Saal XXV, Kat. Nr. 66). Er stammt nicht unmittelbar aus dem alten Besitze
der nun vereinigten drei Waffenkammern von Wien, Ambras und Graz und seine Zuschreibung be-
ruht auch nur auf einer
Tradition, die schon darum
nicht aufrechtzuerhalten
ist, weil die allgemeine
Form der Zeit um 151 o an-
gehört, in welcher König
Philipp längstnichrmehr
am Leben war. Genau
stimmt aber die Grösse zu
Karl V., der, 1500 geboren,
zur Zeit der Fertigung des
Harnisches wirklich 11
oder 12 Jahre zählte. Die
auf dem Harnische sicht-
baren Embleme des Vliess-
ordens bestätigen noch die
Vermuthung; denn der
Prinz besass diesen Orden
in der That seit ig. Jänner
1501.
Der Harnisch (Tafel
XLI) ist ebenso wie jener
für den König von England
ein solcher für den Fusskampf mit getriebenem Kampfschurz, der durch Ausheben von segmentförmigen
Schurztheilen vorne und rückwärts auch zu Pferde gebraucht werden konnte, wie dies bis ungefähr
151g Mode war. Der burgundische Helm besitzt einen niederen gewulsteten Kamm, ein zweitheiliges
Kinnreff und ein mit dem Stirnstulp verbundenes, beiderseits gelochtes Visir. Das Verzierungsmotiv
bildet auch hier der Granatapfel. Die geschobenen Achseln sind in den Armbeugen geschlossen, trichter-
förmig gebildet und mit drei auf rothem Sammt aufgelegten vergoldeten durchbrochenen Silberstreifen
mit den Emblemen des Vliessordens im Ornament geziert. Das geschlossene Armzeug, getrieben, geätzt
und vergoldet, hat die Tracht der Zeit mit Schlitzen und Puffen nachgeahmt. Die Hentzen mit kurzen
Stulpen gehen im Umlauf und sind geriffelt. Die Kugelbrust ist mit fünf der oben beschriebenen, auf
Sammt aufgelegten Silberstreifen belegt. An diese, wie an den gleichverzierten Rücken schliesst sich
ein kurzer in Pfeifen getriebener Kampfschurz, auf welchem jede zweite Falte mit den durchbrochenen
Streifen belegt ist; die dazwischenliegenden waren vermuthlich mit andersfarbigem Sammt überzogen.
Die hoch in die Lenden reichenden Diechlinge sind wieder in der Form der verhauten Tracht ge-
trieben, geätzt und vergoldet. Die Kniebeugen decken grosse flache Muscheln. Auch die neunmal ge-
schobenen Stumpfschuhe zeigen die Tracht der Zeit.
Fig. 6. Helm vom Harnische des Kaisers Maximilian I..
von rückwärts und geöffnet dargestellt.