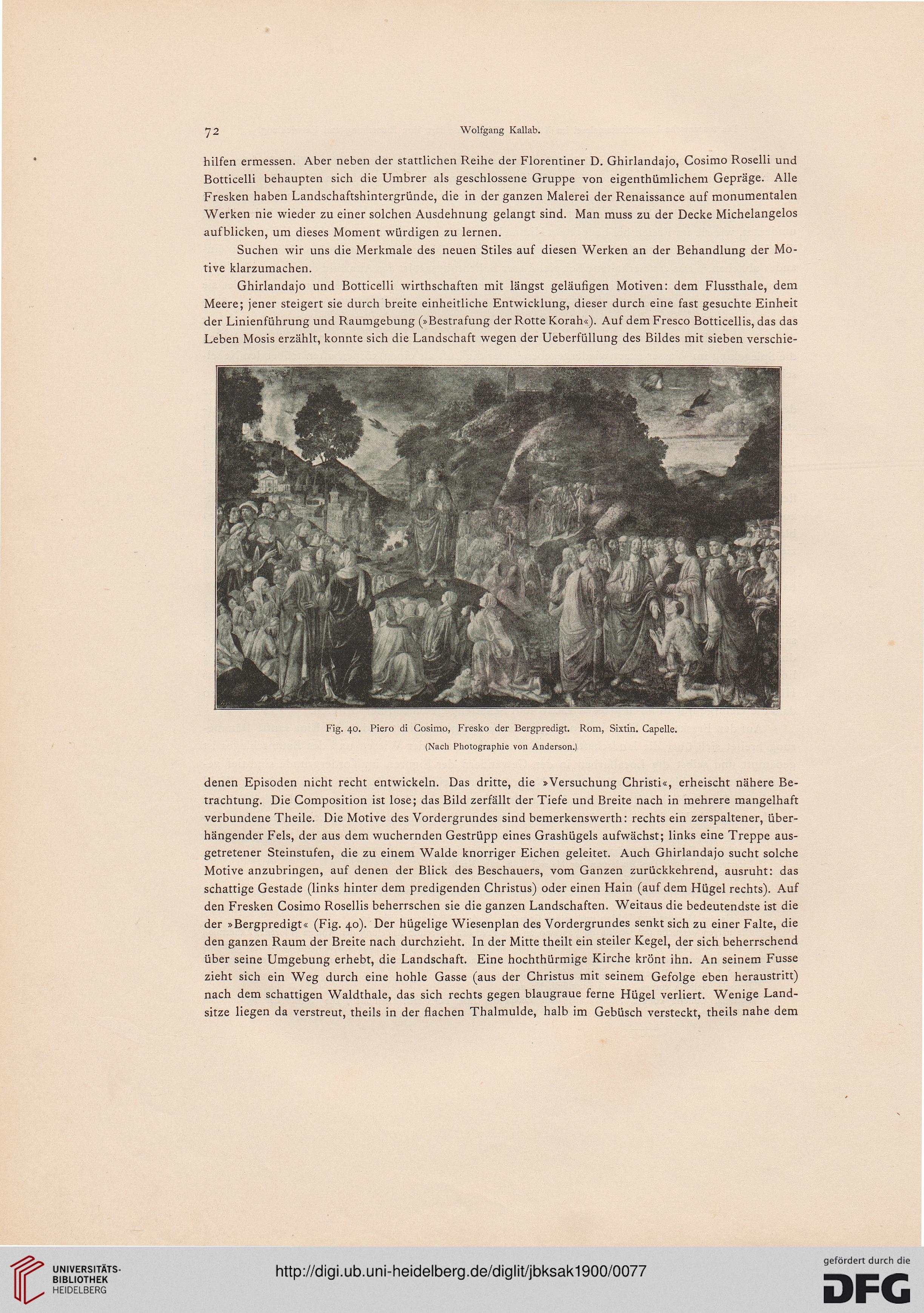72 Wolfgang Kallah.
hilfen ermessen. Aber neben der stattlichen Reihe der Florentiner D. Ghirlandajo, Cosimo Roselli und
Botticelli behaupten sich die Umbrer als geschlossene Gruppe von eigenthümlichem Gepräge. Alle
Fresken haben Landschaftshintergründe, die in der ganzen Malerei der Renaissance auf monumentalen
Werken nie wieder zu einer solchen Ausdehnung gelangt sind. Man muss zu der Decke Michelangelos
aufblicken, um dieses Moment würdigen zu lernen.
Suchen wir uns die Merkmale des neuen Stiles auf diesen Werken an der Behandlung der Mo-
tive klarzumachen.
Ghirlandajo und Botticelli wirthschaften mit längst geläufigen Motiven: dem Flussthale, dem
Meere; jener steigert sie durch breite einheitliche Entwicklung, dieser durch eine fast gesuchte Einheit
der Linienführung und Raumgebung (»Bestrafung der Rotte Korah«). Auf dem Fresco Botticellis, das das
Leben Mosis erzählt, konnte sich die Landschaft wegen der Ueberfüllung des Bildes mit sieben verschie-
Fig. 40. Piero di Cosimo, Fresko der Bergpredigt. Rom, Sixtin. Capelle.
(Nach Photographie von Anderson.)
denen Episoden nicht recht entwickeln. Das dritte, die »Versuchung Christi«, erheischt nähere Be-
trachtung. Die Composition ist lose; das Bild zerfällt der Tiefe und Breite nach in mehrere mangelhaft
verbundene Theile. Die Motive des Vordergrundes sind bemerkenswerth: rechts ein zerspaltener, über-
hängender Fels, der aus dem wuchernden Gestrüpp eines Grashügels aufwächst; links eine Treppe aus-
getretener Steinstufen, die zu einem Walde knorriger Eichen geleitet. Auch Ghirlandajo sucht solche
Motive anzubringen, auf denen der Blick des Beschauers, vom Ganzen zurückkehrend, ausruht: das
schattige Gestade (links hinter dem predigenden Christus) oder einen Hain (auf dem Hügel rechts). Auf
den Fresken Cosimo Rosellis beherrschen sie die ganzen Landschaften. Weitaus die bedeutendste ist die
der »Bergpredigt« (Fig. 40). Der hügelige Wiesenplan des Vordergrundes senkt sich zu einer Falte, die
den ganzen Raum der Breite nach durchzieht. In der Mitte theilt ein steiler Kegel, der sich beherrschend
über seine Umgebung erhebt, die Landschaft. Eine hochthürmige Kirche krönt ihn. An seinem Fusse
zieht sich ein Weg durch eine hohle Gasse (aus der Christus mit seinem Gefolge eben heraustritt)
nach dem schattigen Waldthale, das sich rechts gegen blaugraue ferne Hügel verliert. Wenige Land-
sitze liegen da verstreut, theils in der flachen Thalmulde, halb im Gebüsch versteckt, theils nahe dem
hilfen ermessen. Aber neben der stattlichen Reihe der Florentiner D. Ghirlandajo, Cosimo Roselli und
Botticelli behaupten sich die Umbrer als geschlossene Gruppe von eigenthümlichem Gepräge. Alle
Fresken haben Landschaftshintergründe, die in der ganzen Malerei der Renaissance auf monumentalen
Werken nie wieder zu einer solchen Ausdehnung gelangt sind. Man muss zu der Decke Michelangelos
aufblicken, um dieses Moment würdigen zu lernen.
Suchen wir uns die Merkmale des neuen Stiles auf diesen Werken an der Behandlung der Mo-
tive klarzumachen.
Ghirlandajo und Botticelli wirthschaften mit längst geläufigen Motiven: dem Flussthale, dem
Meere; jener steigert sie durch breite einheitliche Entwicklung, dieser durch eine fast gesuchte Einheit
der Linienführung und Raumgebung (»Bestrafung der Rotte Korah«). Auf dem Fresco Botticellis, das das
Leben Mosis erzählt, konnte sich die Landschaft wegen der Ueberfüllung des Bildes mit sieben verschie-
Fig. 40. Piero di Cosimo, Fresko der Bergpredigt. Rom, Sixtin. Capelle.
(Nach Photographie von Anderson.)
denen Episoden nicht recht entwickeln. Das dritte, die »Versuchung Christi«, erheischt nähere Be-
trachtung. Die Composition ist lose; das Bild zerfällt der Tiefe und Breite nach in mehrere mangelhaft
verbundene Theile. Die Motive des Vordergrundes sind bemerkenswerth: rechts ein zerspaltener, über-
hängender Fels, der aus dem wuchernden Gestrüpp eines Grashügels aufwächst; links eine Treppe aus-
getretener Steinstufen, die zu einem Walde knorriger Eichen geleitet. Auch Ghirlandajo sucht solche
Motive anzubringen, auf denen der Blick des Beschauers, vom Ganzen zurückkehrend, ausruht: das
schattige Gestade (links hinter dem predigenden Christus) oder einen Hain (auf dem Hügel rechts). Auf
den Fresken Cosimo Rosellis beherrschen sie die ganzen Landschaften. Weitaus die bedeutendste ist die
der »Bergpredigt« (Fig. 40). Der hügelige Wiesenplan des Vordergrundes senkt sich zu einer Falte, die
den ganzen Raum der Breite nach durchzieht. In der Mitte theilt ein steiler Kegel, der sich beherrschend
über seine Umgebung erhebt, die Landschaft. Eine hochthürmige Kirche krönt ihn. An seinem Fusse
zieht sich ein Weg durch eine hohle Gasse (aus der Christus mit seinem Gefolge eben heraustritt)
nach dem schattigen Waldthale, das sich rechts gegen blaugraue ferne Hügel verliert. Wenige Land-
sitze liegen da verstreut, theils in der flachen Thalmulde, halb im Gebüsch versteckt, theils nahe dem