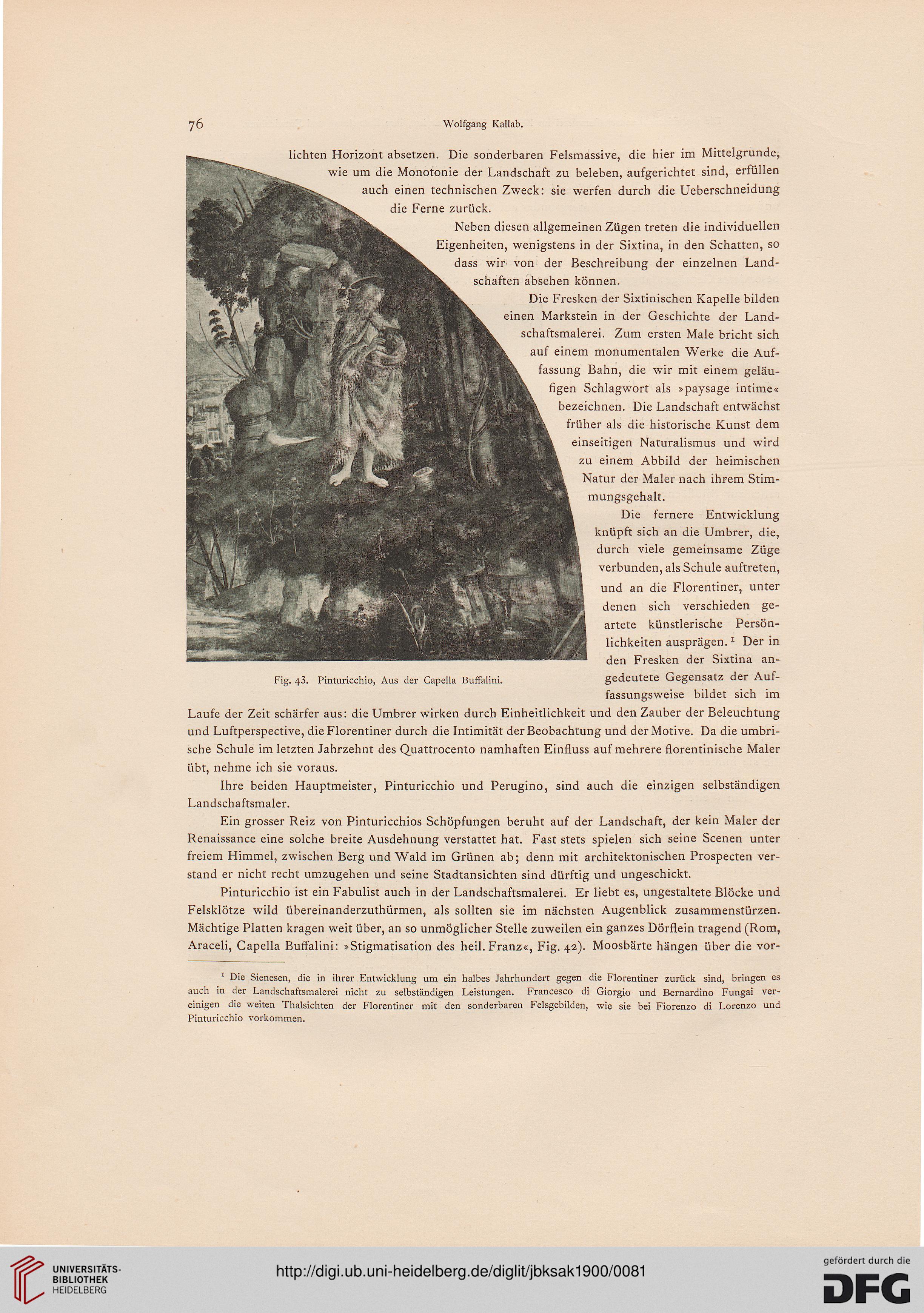76
Wolfgang Kallab.
lichten Horizont absetzen. Die sonderbaren Felsmassive, die hier im Mittelgrunde,
wie um die Monotonie der Landschaft zu beleben, aufgerichtet sind, erfüllen
auch einen technischen Zweck: sie werfen durch die Ueberschneidung
die Ferne zurück.
Neben diesen allgemeinen Zügen treten die individuellen
Eigenheiten, wenigstens in der Sixtina, in den Schatten, so
dass wir von der Beschreibung der einzelnen Land-
schaften absehen können.
Die Fresken der Sixtinischen Kapelle bilden
einen Markstein in der Geschichte der Land-
schaftsmalerei. Zum ersten Male bricht sich
auf einem monumentalen Werke die Auf-
fassung Bahn, die wir mit einem geläu-
figen Schlagwort als »paysage intime«
bezeichnen. Die Landschaft entwächst
früher als die historische Kunst dem
einseitigen Naturalismus und wird
zu einem Abbild der heimischen
Natur der Maler nach ihrem Stim-
mungsgehalt.
Die fernere Entwicklung
knüpft sich an die Umbrer, die,
durch viele gemeinsame Züge
verbunden, als Schule auftreten,
und an die Florentiner, unter
denen sich verschieden ge-
artete künstlerische Persön-
lichkeiten ausprägen.1 Der in
den Fresken der Sixtina an-
gedeutete Gegensatz der Auf-
fassungsweise bildet sich im
Laufe der Zeit schärfer aus: die Umbrer wirken durch Einheitlichkeit und den Zauber der Beleuchtung
und Luftperspective, die Florentiner durch die Intimität der Beobachtung und der Motive. Da die umbri-
sche Schule im letzten Jahrzehnt des Quattrocento namhaften Einfluss auf mehrere florentinische Maler
übt, nehme ich sie voraus.
Ihre beiden Hauptmeister, Pinturicchio und Perugino, sind auch die einzigen selbständigen
Landschaftsmaler.
Ein grosser Reiz von Pinturicchios Schöpfungen beruht auf der Landschaft, der kein Maler der
Renaissance eine solche breite Ausdehnung verstattet hat. Fast stets spielen sich seine Scenen unter
freiem Himmel, zwischen Berg und Wald im Grünen ab; denn mit architektonischen Prospecten ver-
stand er nicht recht umzugehen und seine Stadtansichten sind dürftig und ungeschickt.
Pinturicchio ist ein Fabulist auch in der Landschaftsmalerei. Er liebt es, ungestaltete Blöcke und
Felsklötze wild übereinanderzuthürmen, als sollten sie im nächsten Augenblick zusammenstürzen.
Mächtige Platten kragen weit über, an so unmöglicher Stelle zuweilen ein ganzes Dörflein tragend (Rom,
Araceli, Capella Buffalini: »Stigmatisation des heil. Franz«, Fig. 42). Moosbärte hängen über die vor-
Fig. 43. Pinturicchio, Aus der Capella Buffalini.
1 Die Sienesen, die in ihrer Entwicklung um ein halbes Jahrhundert gegen die Florentiner zurück sind, bringen es
auch in der Landschaftsmalerei nicht zu selbständigen Leistungen. Francesco di Giorgio und Bernardino Fungai ver-
einigen die weiten Thalsichten der Florentiner mit den sonderbaren Felsgebilden, wie sie bei Fiorenzo di Lorenzo und
Pinturicchio vorkommen.
Wolfgang Kallab.
lichten Horizont absetzen. Die sonderbaren Felsmassive, die hier im Mittelgrunde,
wie um die Monotonie der Landschaft zu beleben, aufgerichtet sind, erfüllen
auch einen technischen Zweck: sie werfen durch die Ueberschneidung
die Ferne zurück.
Neben diesen allgemeinen Zügen treten die individuellen
Eigenheiten, wenigstens in der Sixtina, in den Schatten, so
dass wir von der Beschreibung der einzelnen Land-
schaften absehen können.
Die Fresken der Sixtinischen Kapelle bilden
einen Markstein in der Geschichte der Land-
schaftsmalerei. Zum ersten Male bricht sich
auf einem monumentalen Werke die Auf-
fassung Bahn, die wir mit einem geläu-
figen Schlagwort als »paysage intime«
bezeichnen. Die Landschaft entwächst
früher als die historische Kunst dem
einseitigen Naturalismus und wird
zu einem Abbild der heimischen
Natur der Maler nach ihrem Stim-
mungsgehalt.
Die fernere Entwicklung
knüpft sich an die Umbrer, die,
durch viele gemeinsame Züge
verbunden, als Schule auftreten,
und an die Florentiner, unter
denen sich verschieden ge-
artete künstlerische Persön-
lichkeiten ausprägen.1 Der in
den Fresken der Sixtina an-
gedeutete Gegensatz der Auf-
fassungsweise bildet sich im
Laufe der Zeit schärfer aus: die Umbrer wirken durch Einheitlichkeit und den Zauber der Beleuchtung
und Luftperspective, die Florentiner durch die Intimität der Beobachtung und der Motive. Da die umbri-
sche Schule im letzten Jahrzehnt des Quattrocento namhaften Einfluss auf mehrere florentinische Maler
übt, nehme ich sie voraus.
Ihre beiden Hauptmeister, Pinturicchio und Perugino, sind auch die einzigen selbständigen
Landschaftsmaler.
Ein grosser Reiz von Pinturicchios Schöpfungen beruht auf der Landschaft, der kein Maler der
Renaissance eine solche breite Ausdehnung verstattet hat. Fast stets spielen sich seine Scenen unter
freiem Himmel, zwischen Berg und Wald im Grünen ab; denn mit architektonischen Prospecten ver-
stand er nicht recht umzugehen und seine Stadtansichten sind dürftig und ungeschickt.
Pinturicchio ist ein Fabulist auch in der Landschaftsmalerei. Er liebt es, ungestaltete Blöcke und
Felsklötze wild übereinanderzuthürmen, als sollten sie im nächsten Augenblick zusammenstürzen.
Mächtige Platten kragen weit über, an so unmöglicher Stelle zuweilen ein ganzes Dörflein tragend (Rom,
Araceli, Capella Buffalini: »Stigmatisation des heil. Franz«, Fig. 42). Moosbärte hängen über die vor-
Fig. 43. Pinturicchio, Aus der Capella Buffalini.
1 Die Sienesen, die in ihrer Entwicklung um ein halbes Jahrhundert gegen die Florentiner zurück sind, bringen es
auch in der Landschaftsmalerei nicht zu selbständigen Leistungen. Francesco di Giorgio und Bernardino Fungai ver-
einigen die weiten Thalsichten der Florentiner mit den sonderbaren Felsgebilden, wie sie bei Fiorenzo di Lorenzo und
Pinturicchio vorkommen.