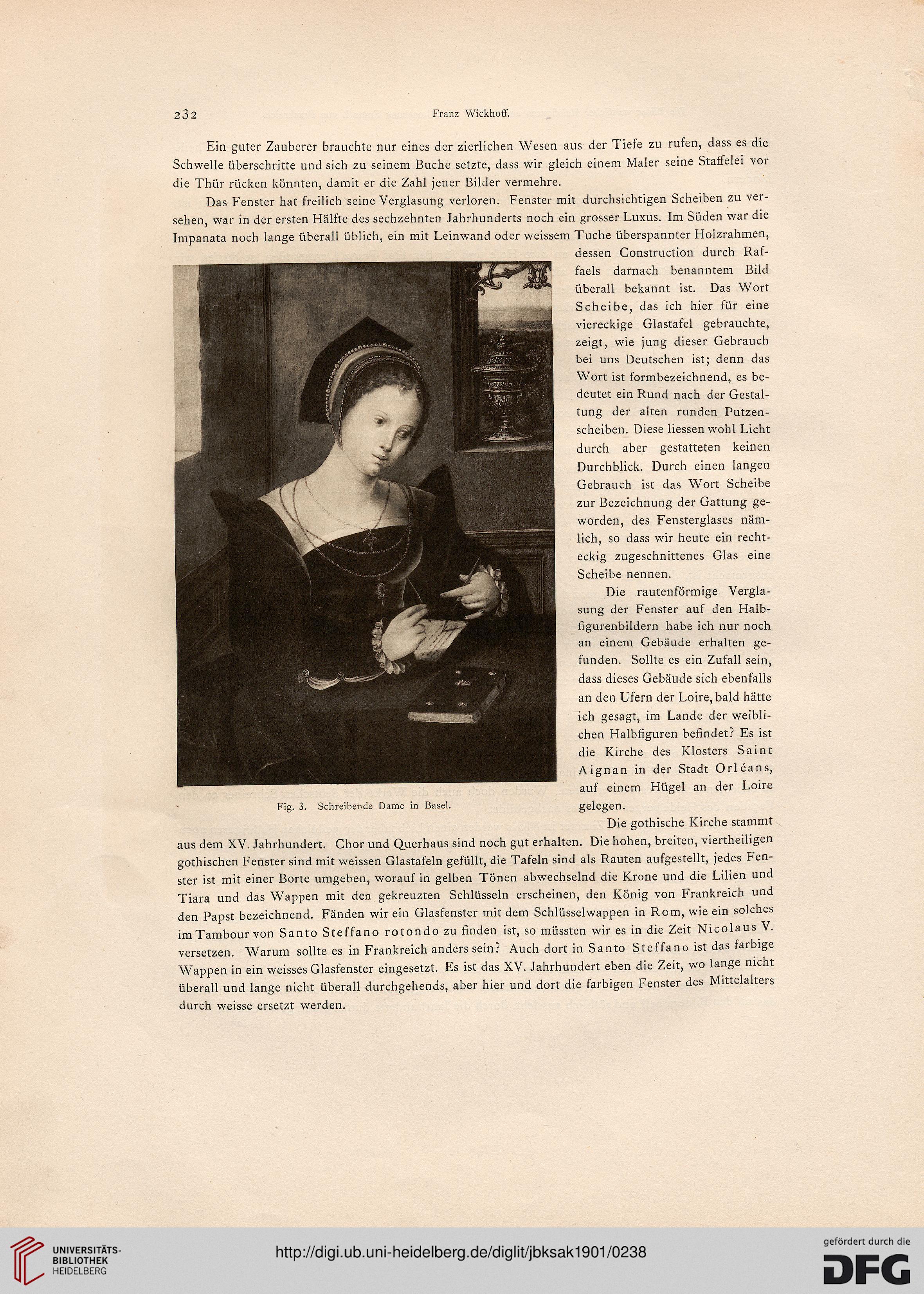232
Franz Wickhoff'.
Ein guter Zauberer brauchte nur eines der zierlichen Wesen aus der Tiefe zu rufen, dass es die
Schwelle überschritte und sich zu seinem Buche setzte, dass wir gleich einem Maler seine Staffelei vor
die Thür rücken könnten, damit er die Zahl jener Bilder vermehre.
Das Fenster hat freilich seine Verglasung verloren. Fenster mit durchsichtigen Scheiben zu ver-
sehen, war in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts noch ein grosser Luxus. Im Süden war die
Impanata noch lange überall üblich, ein mit Leinwand oder weissem Tuche überspannter Holzrahmen,
dessen Construction durch Raf-
faels darnach benanntem Bild
überall bekannt ist. Das Wort
Scheibe, das ich hier für eine
viereckige Glastafel gebrauchte,
zeigt, wie jung dieser Gebrauch
bei uns Deutschen ist; denn das
Wort ist formbezeichnend, es be-
deutet ein Rund nach der Gestal-
tung der alten runden Putzen-
scheiben. Diese Hessen wohl Licht
durch aber gestatteten keinen
Durchblick. Durch einen langen
Gebrauch ist das Wort Scheibe
zur Bezeichnung der Gattung ge-
worden, des Fensterglases näm-
lich, so dass wir heute ein recht-
eckig zugeschnittenes Glas eine
Scheibe nennen.
Die rautenförmige Vergla-
sung der Fenster auf den Halb-
figurenbildern habe ich nur noch
an einem Gebäude erhalten ge-
funden. Sollte es ein Zufall sein,
dass dieses Gebäude sich ebenfalls
an den Ufern der Loire, bald hätte
ich gesagt, im Lande der weibli-
chen Halbfiguren befindet? Es ist
die Kirche des Klosters Saint
Aignan in der Stadt Orleans,
auf einem Hügel an der Loire
gelegen.
Die gothische Kirche stammt
aus dem XV. Jahrhundert. Chor und Querhaus sind noch gut erhalten. Die hohen, breiten, viertheiligen
gothischen Fenster sind mit weissen Glastafeln gefüllt, die Tafeln sind als Rauten aufgestellt, jedes Fen-
ster ist mit einer Borte umgeben, worauf in gelben Tönen abwechselnd die Krone und die Lilien und
Tiara und das Wappen mit den gekreuzten Schlüsseln erscheinen, den König von Frankreich und
den Papst bezeichnend. Fänden wir ein Glasfenster mit dem Schlüsselwappen in Rom, wie ein solches
im Tambour von Santo Steffano rotondo zu finden ist, so müssten wir es in die Zeit Nicolaus V.
versetzen. Warum sollte es in Frankreich anders sein? Auch dort in Santo Steffano ist das farbige
Wappen in ein weisses Glasfenster eingesetzt. Es ist das XV. Jahrhundert eben die Zeit, wo lange nicht
überall und lange nicht überall durchgehends, aber hier und dort die farbigen Fenster des Mittelalters
durch weisse ersetzt werden.
BP*'
Fig. 3. Schreibende Dame in Basel.
Franz Wickhoff'.
Ein guter Zauberer brauchte nur eines der zierlichen Wesen aus der Tiefe zu rufen, dass es die
Schwelle überschritte und sich zu seinem Buche setzte, dass wir gleich einem Maler seine Staffelei vor
die Thür rücken könnten, damit er die Zahl jener Bilder vermehre.
Das Fenster hat freilich seine Verglasung verloren. Fenster mit durchsichtigen Scheiben zu ver-
sehen, war in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts noch ein grosser Luxus. Im Süden war die
Impanata noch lange überall üblich, ein mit Leinwand oder weissem Tuche überspannter Holzrahmen,
dessen Construction durch Raf-
faels darnach benanntem Bild
überall bekannt ist. Das Wort
Scheibe, das ich hier für eine
viereckige Glastafel gebrauchte,
zeigt, wie jung dieser Gebrauch
bei uns Deutschen ist; denn das
Wort ist formbezeichnend, es be-
deutet ein Rund nach der Gestal-
tung der alten runden Putzen-
scheiben. Diese Hessen wohl Licht
durch aber gestatteten keinen
Durchblick. Durch einen langen
Gebrauch ist das Wort Scheibe
zur Bezeichnung der Gattung ge-
worden, des Fensterglases näm-
lich, so dass wir heute ein recht-
eckig zugeschnittenes Glas eine
Scheibe nennen.
Die rautenförmige Vergla-
sung der Fenster auf den Halb-
figurenbildern habe ich nur noch
an einem Gebäude erhalten ge-
funden. Sollte es ein Zufall sein,
dass dieses Gebäude sich ebenfalls
an den Ufern der Loire, bald hätte
ich gesagt, im Lande der weibli-
chen Halbfiguren befindet? Es ist
die Kirche des Klosters Saint
Aignan in der Stadt Orleans,
auf einem Hügel an der Loire
gelegen.
Die gothische Kirche stammt
aus dem XV. Jahrhundert. Chor und Querhaus sind noch gut erhalten. Die hohen, breiten, viertheiligen
gothischen Fenster sind mit weissen Glastafeln gefüllt, die Tafeln sind als Rauten aufgestellt, jedes Fen-
ster ist mit einer Borte umgeben, worauf in gelben Tönen abwechselnd die Krone und die Lilien und
Tiara und das Wappen mit den gekreuzten Schlüsseln erscheinen, den König von Frankreich und
den Papst bezeichnend. Fänden wir ein Glasfenster mit dem Schlüsselwappen in Rom, wie ein solches
im Tambour von Santo Steffano rotondo zu finden ist, so müssten wir es in die Zeit Nicolaus V.
versetzen. Warum sollte es in Frankreich anders sein? Auch dort in Santo Steffano ist das farbige
Wappen in ein weisses Glasfenster eingesetzt. Es ist das XV. Jahrhundert eben die Zeit, wo lange nicht
überall und lange nicht überall durchgehends, aber hier und dort die farbigen Fenster des Mittelalters
durch weisse ersetzt werden.
BP*'
Fig. 3. Schreibende Dame in Basel.