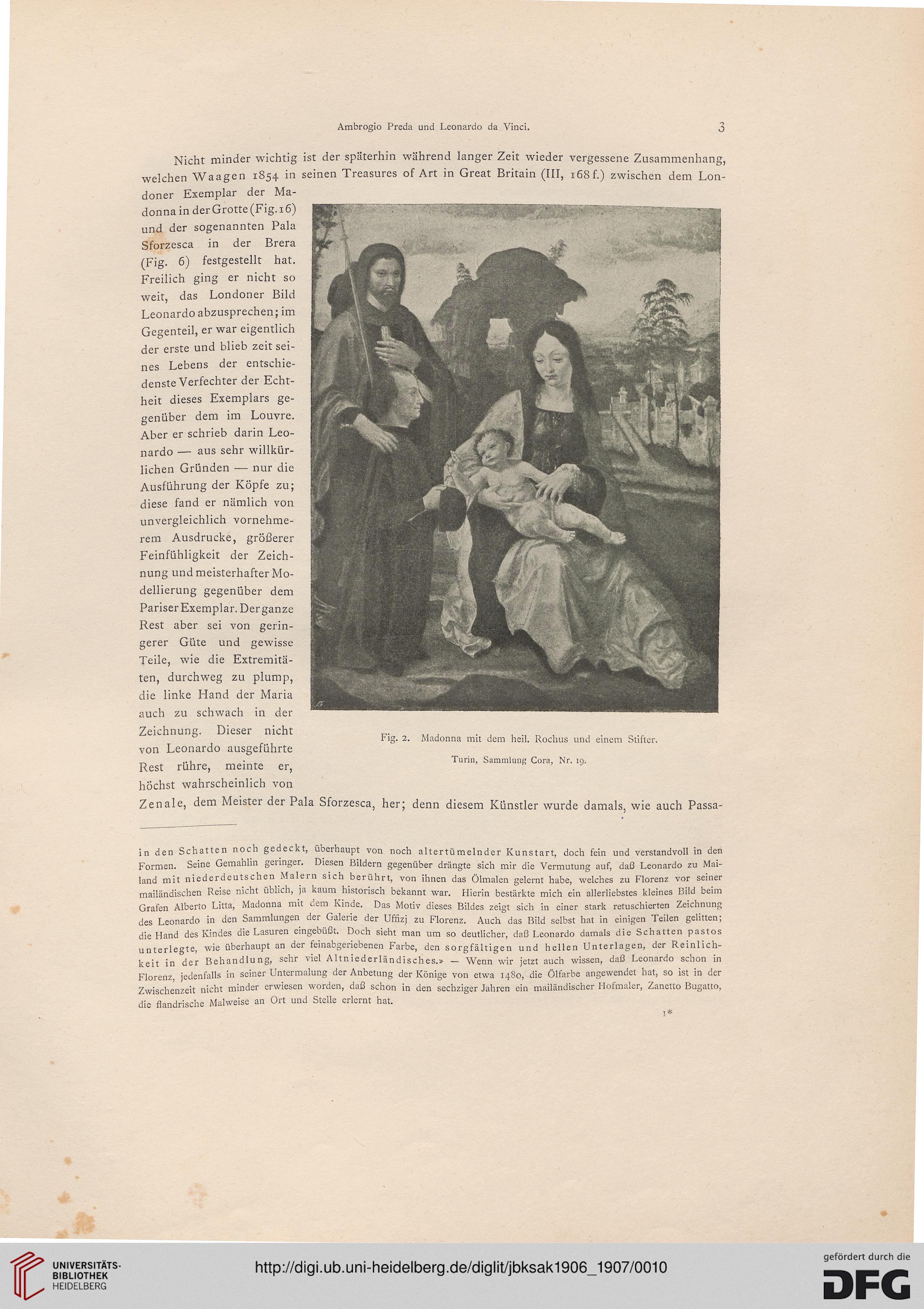Ambrogio Preda und Leonardo da Vinci.
Nicht minder wichtig ist der späterhin während langer Zeit wieder vergessene Zusammenhang,
welchen Waagen 1854 in seinen Treasures of Art in Great Britain (III, 168 f.) zwischen dem Lon-
doner Exemplar der Ma-
donna in der Grotte (Fig. 16)
und der sogenannten Pala
Sforzesca in der Brera
(Fig. 6) festgestellt hat.
Freilich ging er nicht so
weit, das Londoner Bild
Leonardo abzusprechen; im
Gegenteil, er war eigentlich
der erste und blieb zeit sei-
nes Lebens der entschie-
denste Verfechter der Echt-
heit dieses Exemplars ge-
genüber dem im Louvre.
Aber er schrieb darin Leo-
nardo — aus sehr willkür-
lichen Gründen — nur die
Ausführung der Köpfe zu;
diese fand er nämlich von
unvergleichlich vornehme-
rem Ausdrucke, größerer
Feinfühligkeit der Zeich-
nung und meisterhafter Mo-
dellierung gegenüber dem
Pariser Exemplar. Der ganze
Rest aber sei von gerin-
gerer Güte und gewisse
Teile, wie die Extremitä-
ten, durchweg zu plump,
die linke Hand der Maria
auch zu schwach in der
Zeichnung. Dieser nicht
von Leonardo ausgeführte
Rest rühre, meinte er,
höchst wahrscheinlich von
Zenale, dem Meister der Pala Sforzesca, her; denn diesem Künstler wurde damals, wie auch Passa-
Fig. 2.
Madonna mit dem heil. Rochus und einem Stifter.
Turin, Sammlung Cora, Nr. 19.
aupt von noch altertümelnder Kunstart, doch fein und verstandvoll in de
in den Schatten noch gedeckt, überh
Formen. Seine Gemahlin geringer. Diesen Bilde
land mit niederdeutschen Malern sich berührf^^f^rtf011 "* ^ Vermutun§ auf, daß Leonardo zu Mai-
mailändischen Reise nicht üblich, ja kaum historisch bekannt m cn Selcrnt habe, welches zu Florenz vor seiner
Grafen Alberto Litta, Madonna mit dem Kinde. Das Motiv di R " bestärkte micn ein allerliebstes kleines Bild beim
des Leonardo in den Sammlungen der Galerie der Uffizi zu FT^ ** "'^ S'Ch e'ner Stark retuschierten Zeichnung
die Hand des Kindes die Lasuren eingebüßt. Doch sieht orer>z- Auch das Bild selbst hat in einigen Teilen gelitten;
unterlegte, wie überhaupt an der feinabgeriebenen Farbe d™ *° deutllcher' daß Leonardo damals die Schatten pastos
keit in der Behandlung, sehr viel Altniederländis^'h " S°rgfaitiSen und hellen Unterlagen, der Reinlich-
Florenz, jedenfalls in seiner Untermalung der Anbetuno der Kö^'* ~ Wenn wir )et2t auch wissen, daß Leonardo schon in
Zwischenzeit nicht minder erwiesen worden, daß schon °n'se ^°n etwa '480, die Ölfarbe angewendet hat, so ist in der
die flandrische Malweise an Ort und Stelle erlernt hat " Z,ger Jahrcn ein inländischer Hofmaler, Zanetto Bugatto,
Nicht minder wichtig ist der späterhin während langer Zeit wieder vergessene Zusammenhang,
welchen Waagen 1854 in seinen Treasures of Art in Great Britain (III, 168 f.) zwischen dem Lon-
doner Exemplar der Ma-
donna in der Grotte (Fig. 16)
und der sogenannten Pala
Sforzesca in der Brera
(Fig. 6) festgestellt hat.
Freilich ging er nicht so
weit, das Londoner Bild
Leonardo abzusprechen; im
Gegenteil, er war eigentlich
der erste und blieb zeit sei-
nes Lebens der entschie-
denste Verfechter der Echt-
heit dieses Exemplars ge-
genüber dem im Louvre.
Aber er schrieb darin Leo-
nardo — aus sehr willkür-
lichen Gründen — nur die
Ausführung der Köpfe zu;
diese fand er nämlich von
unvergleichlich vornehme-
rem Ausdrucke, größerer
Feinfühligkeit der Zeich-
nung und meisterhafter Mo-
dellierung gegenüber dem
Pariser Exemplar. Der ganze
Rest aber sei von gerin-
gerer Güte und gewisse
Teile, wie die Extremitä-
ten, durchweg zu plump,
die linke Hand der Maria
auch zu schwach in der
Zeichnung. Dieser nicht
von Leonardo ausgeführte
Rest rühre, meinte er,
höchst wahrscheinlich von
Zenale, dem Meister der Pala Sforzesca, her; denn diesem Künstler wurde damals, wie auch Passa-
Fig. 2.
Madonna mit dem heil. Rochus und einem Stifter.
Turin, Sammlung Cora, Nr. 19.
aupt von noch altertümelnder Kunstart, doch fein und verstandvoll in de
in den Schatten noch gedeckt, überh
Formen. Seine Gemahlin geringer. Diesen Bilde
land mit niederdeutschen Malern sich berührf^^f^rtf011 "* ^ Vermutun§ auf, daß Leonardo zu Mai-
mailändischen Reise nicht üblich, ja kaum historisch bekannt m cn Selcrnt habe, welches zu Florenz vor seiner
Grafen Alberto Litta, Madonna mit dem Kinde. Das Motiv di R " bestärkte micn ein allerliebstes kleines Bild beim
des Leonardo in den Sammlungen der Galerie der Uffizi zu FT^ ** "'^ S'Ch e'ner Stark retuschierten Zeichnung
die Hand des Kindes die Lasuren eingebüßt. Doch sieht orer>z- Auch das Bild selbst hat in einigen Teilen gelitten;
unterlegte, wie überhaupt an der feinabgeriebenen Farbe d™ *° deutllcher' daß Leonardo damals die Schatten pastos
keit in der Behandlung, sehr viel Altniederländis^'h " S°rgfaitiSen und hellen Unterlagen, der Reinlich-
Florenz, jedenfalls in seiner Untermalung der Anbetuno der Kö^'* ~ Wenn wir )et2t auch wissen, daß Leonardo schon in
Zwischenzeit nicht minder erwiesen worden, daß schon °n'se ^°n etwa '480, die Ölfarbe angewendet hat, so ist in der
die flandrische Malweise an Ort und Stelle erlernt hat " Z,ger Jahrcn ein inländischer Hofmaler, Zanetto Bugatto,